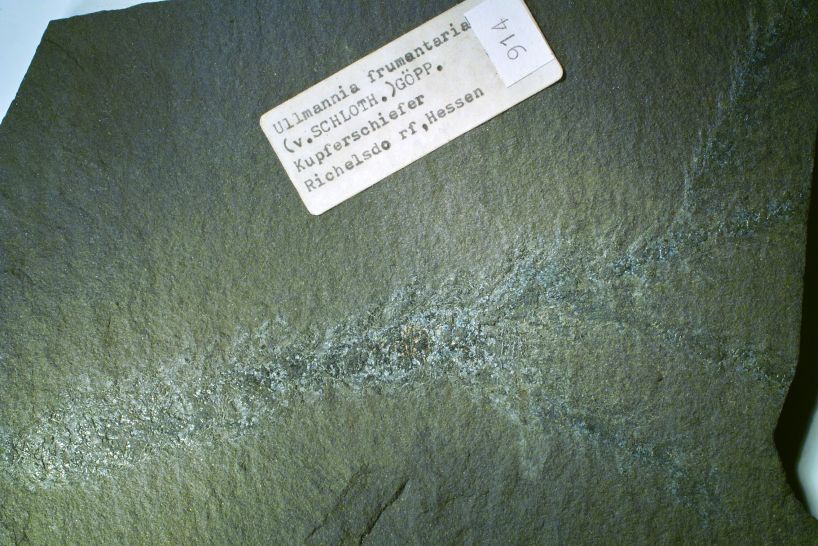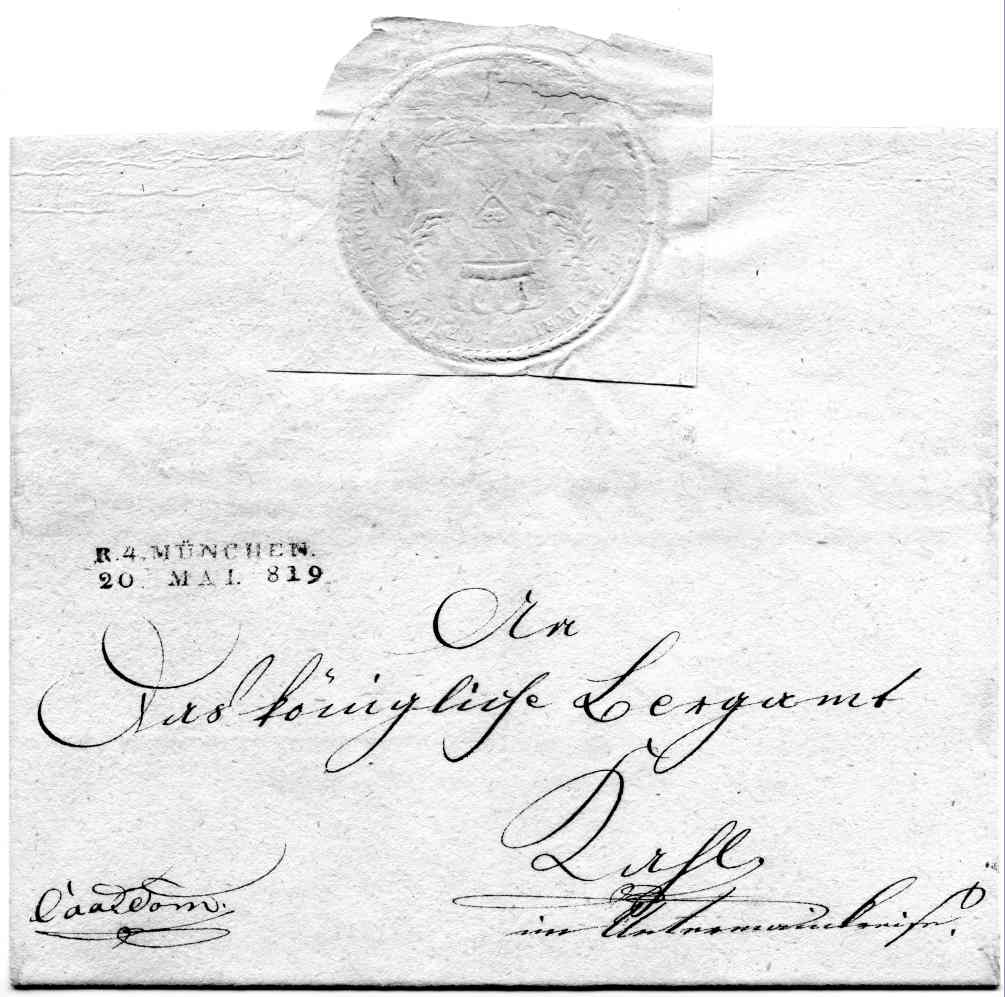Das Bergamt von Kahl - mit der
Grube „Hilfe Gottes“
bei Großkahl (heute Kleinkahl)
im Spessart
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Mit Wasser gefüllte Schachtpinge der Grube Hilfe Gottes bei
Großkahl, heute in der Gemeinde Kleinkahl gelegen,
aufgenommen 25.02.2006
Grube Hilfe
Gottes
Der Bergbau auf den hier anstehenden Kupferschiefer wurde zusammen
mit Huckelheim in einem Bergwerk 1703 unter der Regentschaft von
Graf M. F. von SCHÖNBORN begonnen und mit vielen Unterbrechungen
fortgeführt. Unter bayerischer Herrschaft (seit 1814) baute man ab
1815 das unscheinbare, schwarze und nur bis zu einem ½ m mächtige
Gestein in einem Stollensystem ab, welches durch den 1820
angeschlagenen Maximilians- (damals regierender König in Bayern)
und den mind. 70 Jahre älteren, oberen Kahler Stollen erschlossen
ist. Diese dienten auch zur Entwässerung. Die Mundlöcher kann man
im Gelände noch neben der Kahltalstraße erkennen, da das Wasser
weiterhin austritt. Über den Stollen erkennt man im Wald
zahlreiche Pingen (kreisrunde Wälle um einen zentralen,
verfallenen Schacht). Diese Schächte grub man jeweils bis zum
darunter befindlichen Stollen, um ihm mit Licht und Frischluft zu
versorgen.
1835 wurde der Bergbau aus Mangel an abbauwürdigen Erzen
aufgegeben. Die Anlagen verfielen und der Maximilians-Stollen
diente nur noch zum Wasserlösen. Das Mundloch wurde geschlossen
und somit ist der Stollen nicht mehr zugänglich. Der Stollen
befindet sich in den Kristallin-Gesteinen der Mömbris-Formation
(Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis).

Kupferschiefer von der Grube Hilfe Gottes, ohne mit dem bloßen
Auge
erkennbare Erzeeinschlüsse,
Bildbreite ca. 8 cm.



Unscheinbares Stück Kupferschiefer mit bis zu 2 mm großen
Tennantit-Kristallen, z. T. lagenweise angereichert. Das Stück ist
angeschliffen und poliert. Solche Kristalle
wurden von Bergmeister August BETZOLD gezeichnet - siehe unten,
links Bildbreite 12 cm, mitte 2,5 cm, rechts 5 mm
Zum Vergleich:
Kupferschiefer aus Mansfeld und Richelsdorf:

Kupferschiefer von Eisleben. Neben einer mm-dicken Lage aus
massivem Bornit sind besonders darüber die eingeregelten,
gelben Einschlüssen aus Chalkopyrit-Flittern zu erkennen
(angeschliffen und poliert).
Bildbreite 10 cm
|
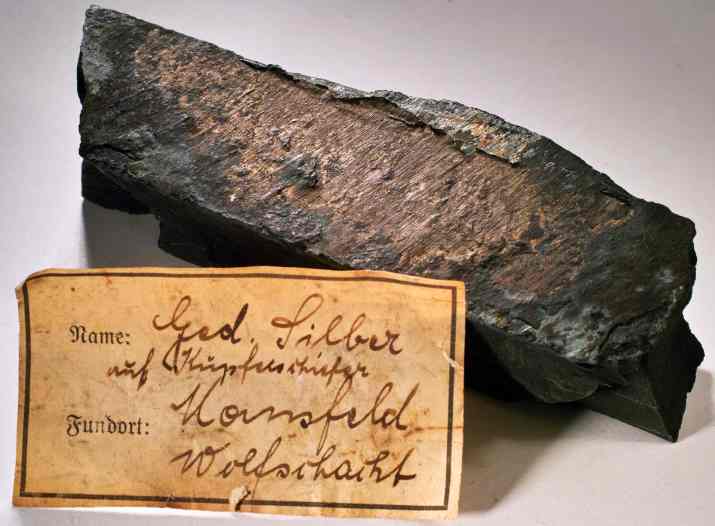
Typischer Kupferschiefer, hier mit ged. Silber als dünnes
Blech und Bornit, aus Mansfeld,
Bildbreite 11 cm.
|

Bruchrauhes Stück Kupferschiefer mit den linsenförmiges
Bornit-Linealen und den mit gelbem Chalkopyrit belegten
Flächen, Mansfeld, gefunden um 1930, Slg. Peter NITSCHKE,
Aschaffenburg
Bildbreite 8 cm
|

Kupferschiefer aus Mansfeld mit einem Wedel des
Pflanzenfossils (vermutlichUllmannia frumenttaria
(SCHLOTHEIM) GÖPPERT 1850), gefunden um 1930 im Raum
Mansfeld, Slg. Peter NITSCHKE, Aschaffenburg
Bildbreite 8 cm
|
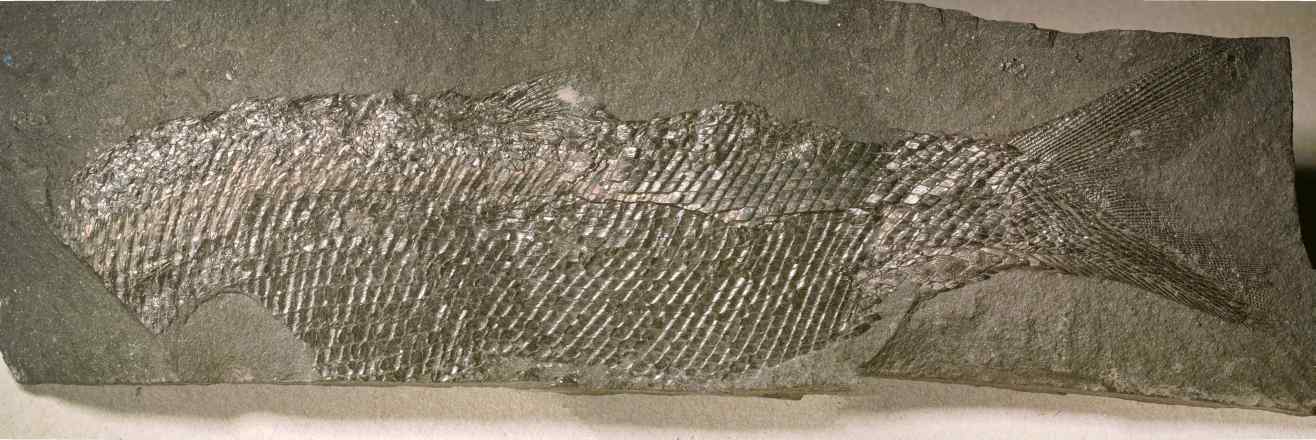
Teil eines Fischfossils aus dem Kupferschiefer (vermutlich Palaeoniscum
freieslebeni BLAINVILLE 1818), ohne Kopf (links) und
einem Teil der Flossen, gefunden um 1930 im Raum Mansfeld,
Slg. Peter NITZSCHKE, Aschaffenburg
Bildbreite 14 cm
|
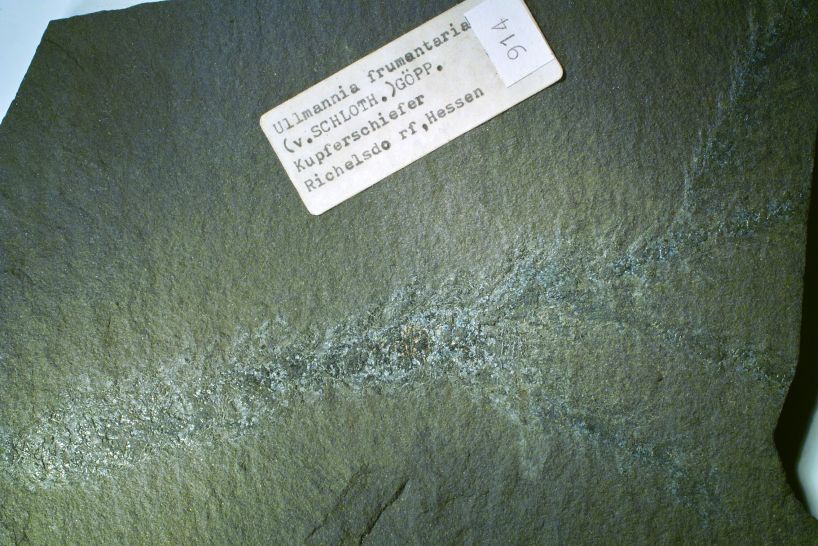
Zweig der permischen Konifere Ullmannia frumentaria
im Kupferschiefer von Richelsdorf,
Bildbreite 13 cm
|
Bei dem Kupferschiefer handelt es sich um einen Schwarzschiefer
aus einem ehemaligen Faulschlamm, der im Meer in einer Tiefe von
mehr als 200 m gebildet wurde. Durch geologische Indizien schließt
man auf einen Bildungszeitraum von unter 60.000 Jahren von etwa
258 Millionen Jahren. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom
Spessart bis nach England und bis nach Polen. Rezent ist so eine
marine Sitaution als Vergleich nicht vorhanden, so dass man zum
Ergründen ausschließlich auf die Fossilien und die Eigenschaften
des Gesteins angewiesen ist.
Der 20 cm bis zu 120 cm (max. bis 1,9 m) mächtige Kupferschiefer
enthält kleine Erzkörnchen aus Tennantit (Kupfer-Arsen-Sulfid),
Galenit (Bleisulfid), Sphalerit (Zinksulfid) und zahlreiche
weitere Erzmineralien. Das summiert sich zu einem
durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,4 bis 0,6 %. Der Tennantit
enthält neben etwas Antimon auch bis zu 0,5 % Silber. Nach der
Förderung des Kupferschiefers hat man diesen in einem Pochwerk
zerkleinert, dann mit Wasser aufgeschlämmt (Schliech) und
anschließend wurde mit einem „Waschherd“ das schwere Erz
abgetrennt. Das so erhaltene Erzkonzentrat konnte in einem sehr
komplexen Prozess aufgeschmolzen werden, um die Wertmetalle Kupfer
und Silber zu gewinnen. In Großkahl konnte nur Schwarzkupfer
hergestellt und verkauft werden. Das ebenfalls enthaltene Zink
wurde im Spessart nicht gewonnen. Der Kupferschiefer der Hilfe
Gottes war nur im Bereich von Störungen (Rissen im Gestein)
abbauwürdig.
Halden, Pingen und Schacht des ehemaligen Bergbaues ("Hilfe
Gottes") NE Großkahl, am SE-Hang des Habers Berges (TK 5821
Bieber, R 2040 H 5350, siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 289,
Aufschluss Nr. 272). Das verschlossene Mundloch entwässert zur
Kahl hin und ist mit einer alten, textlich falschen Tafel des
Naturparkes neben einem Grillplatz ausgeschildert. Die Halden
liegen neben einem Waldweg am Waldrand. Zu erreichen über die
Straße Schöllkrippen-Wiesen, bei Punkt 250,3 biegt links steil ein
Forstweg ab, dann nach ca. 100 wieder links dem Waldweg folgen,
nach ca. 50 m erreicht man die Halden(-reste). Ein Teil der Halden
wurde zu einer Aushubdeponie umfunktioniert, so dass man kaum mehr
Fundmöglichkeiten vorfindet. Die kaum mehr erkennbaren Reste des
Standortes des Pochwerkes und der Hütte sind am Wesemichshof etwas
weiter östlich zu erkennen.
Am östlichen Ende von Großkahl kann man noch kleine, zeitgemäße
Bergmannshäuser aus der Zeit um 1825 sehen (Jahreszahl im
Türstock).
Folgende Mineralien sind von hier bekannt:
Zum Teil nur in mikroskpisch kleinen Körnchen,
Kristallen, Einwachsungen oder Aggregaten:
- Antimonit
- Aragonit
- Arsenopyrit
- Asphalt

Schwarzer Asphalt
(Kohlenwasserstoff) als glaskopfartiger Belag auf
Dolomit;
Bildbreite 3 mm.
- Azurit
- Baryt
- Beyerit

Hellgrüner, schuppiger Beyerit als
Alterationsprodukt von Gediegen
Wismut (Slg. Gerhard ZELLMANN, Altenhaßlau);
Bildbreite 1,5 mm.
- Bismutit
- Brochantit
- Calcit
- Cerrusit
- Chalkopyrit
- Chalkosin
- Covellin
- amorph. Cu-Arsenat
- Chrysokoll

Blaugrüner Chrysokoll als dünner Belag neben
und auf Tennantit;
Bildbreite 1,5 mm
- Cuprit
- Dolomit
- Enargit
- Erythrin
- Galenit
- Gips
- Goethit
- ged. Kupfer
- Klinosafflorit
- Löllingit
- Malachit
- Markasit
- Mimetesit
- Pharmakosiderit
- Psilomelan
- Pyrit
- Quarz
- Realgar
- ged. Schwefel
- Siderit
- Siderogel
- Skutterudit
- Sphalerit
- Spionkopit
- Tetraedrit
- Tennantit
- Tirolit
- ged. Wismut
- Yarrowit.

Typischer, silbrig glänzender, derber Tennantit mit weißem Dolomit
im Dolomit(-gestein). Der Tennantit ist der Hauptträger der
Metalle
Kupfer und enthält in Spuren auch das einst begehrte Silber
Bildbreite ca. 2 cm
Königliches
Bergamt Kahl
(Groß-)Kahl war aufgrund seines, wenn auch kleinen, Bergamtes
weithin bekannt – das heutige Kahl am Main war ein Ort, den
niemand außerhalb der Region kannte. Die Aufbereitung des
Kupferschiefers geschah in dem Waschhaus, in dem auch die
Amtsstube des Bergamtes untergebracht war (vermutlich im 1 Stock).
Diese staatliche Stelle, als Außenstelle der Königlich Bayerischen
General Bergwerks und Salinen Administration in München,
verwaltete die Bergwerke im Spessart von Alzenau bis Lohr und von
Kahl bis nach Amorbach. Das Gebäude wurde nach der Auflösung 1837
abgebrochen und es ist Nichts mehr davon zu sehen. Da dies vor der
Erfindung der Fotografie passierte, gibt es kein Foto und leider
auch keine Zeichnung.
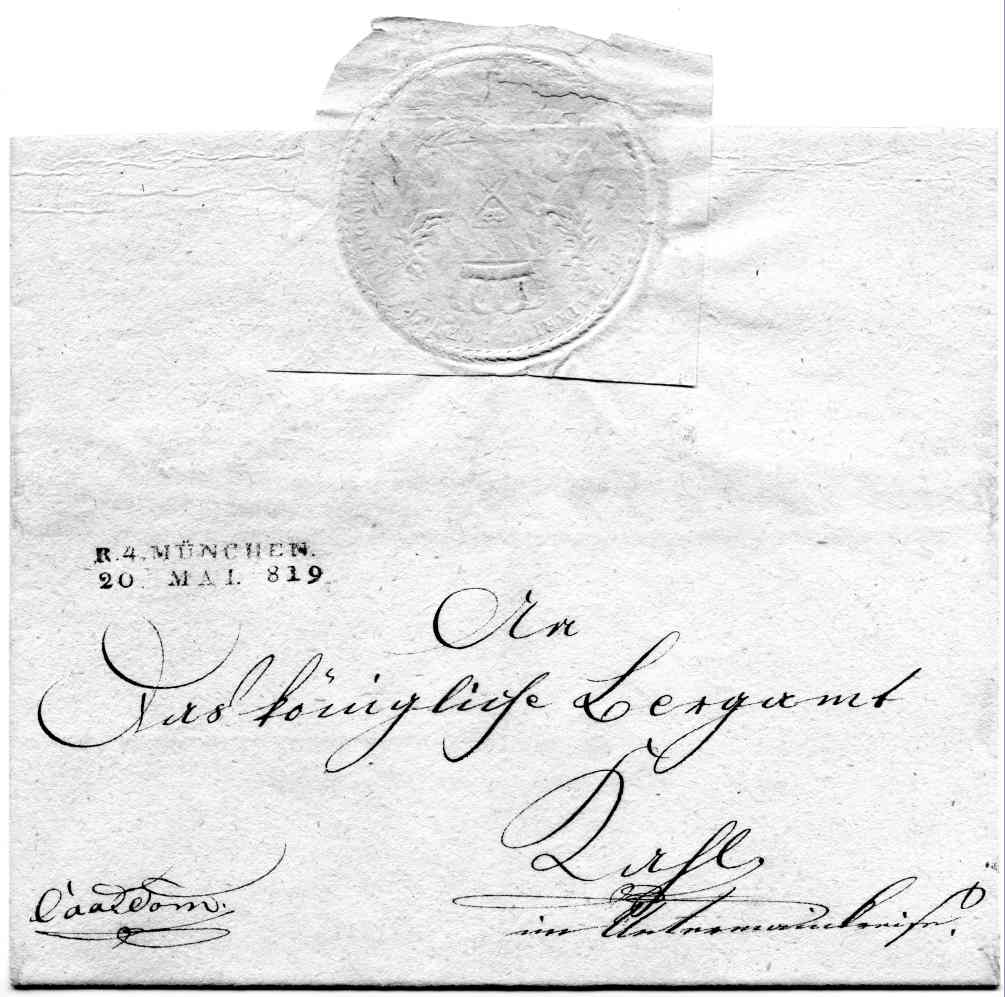

Brief vom 20. Mai 1819 an das Bergamt in Kahl mit einem Siegel der
Königlich Bayerischen General Bergwerks und Salinen Administration
in München
Augustin BEZOLD
(*1794 †1841)
In dem Bergamt lebte seit 1823 August BEZOLD. Er studierte in
München, Freiberg und Hettstedt Bergbau und Hüttenkunde und er
hatte Kontakt zum berühmten Mineralogen Carl Caesar VON LEONHARD.
Er brachte das Kahler Bergwerk zur Blüte, litt aber unter den
Widrigkeiten des Lebens in einer klimatisch nicht begünstigten
Region und der einsamen Lage des Waschhauses, in dem sich das
Bergamt und die Wohnung befand. Als er seine Verlobte Ulrike P.
LEHNER aus Weißenburg heiraten wollte, versagte dies sein
Arbeitgeber! Infolge alter Rechte gelang es ihm, beim Gräflich
Schönborn’schen Patrimonialgericht in Krombach gegen den Willen
seiner vorgesetzten Stelle auf polizeilichem Weg zu heiraten.
Durch die Stäube und Abgase aus dem Bergwerksbetrieb erkrankte er
und musste seinen Beruf aufgeben (heute würde man von einer
Berufskrankheit sprechen). 1827 wurde er zum Bergmeister
befördert. Er zog zunächst nach Aschaffenburg, ging 1835 als
Bergassessor zurück nach München und hörte dort an der Universität
bei Nepomuk FUCHS mineralogische Vorlesungen. Diese Kenntnisse
wollte er in einem Buch niederschreiben. 3 Tafeln mit den
Kristallskizzen hatte er bereits fertig, als er 1841 verstarb und
ihm so die Lehrbuchautorschaft versagt blieb. Die Kristallzkizzen
zieren im Anhang das Handbuch der Naturgeschichte von J. A. WAGNER
im 3. Band über das Mineralreich.
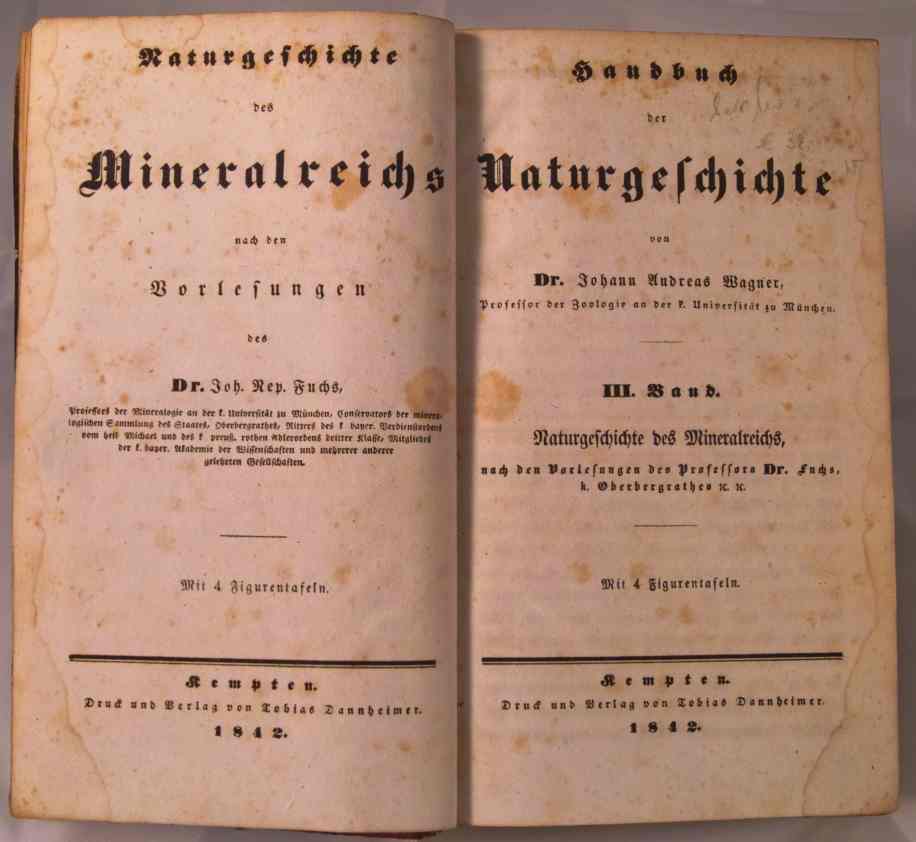
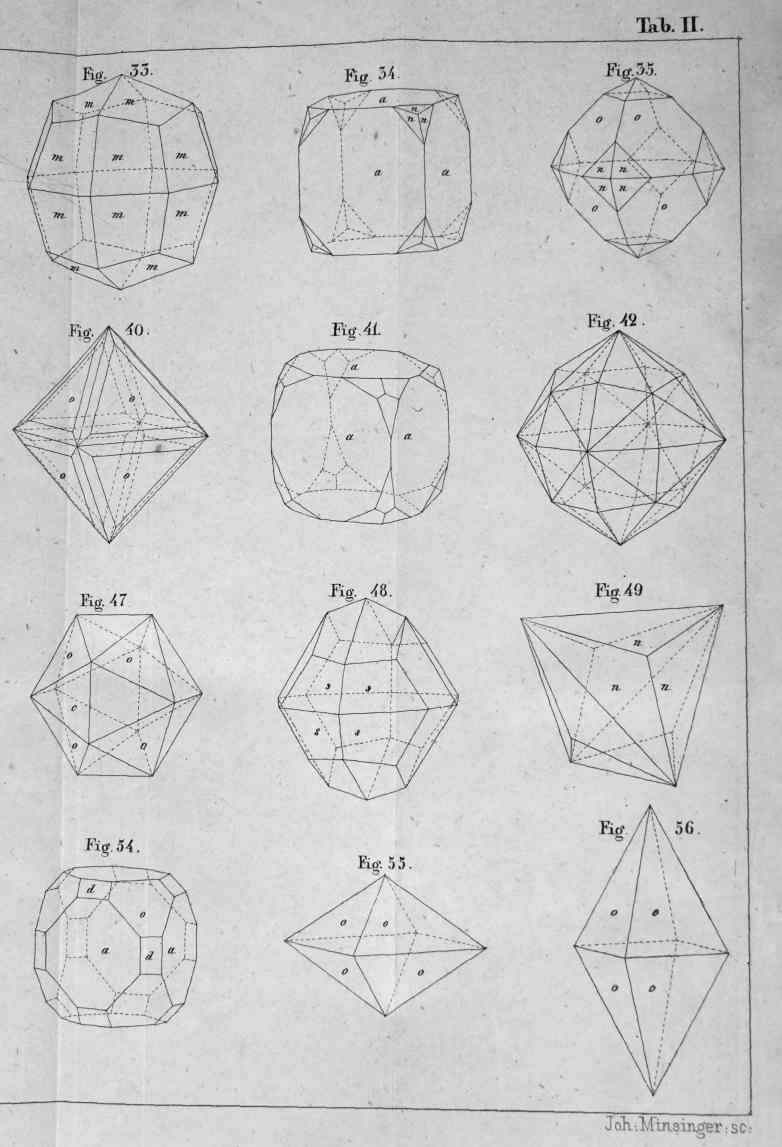
Links: Bild vom Buch (mit vielen Leerseiten), welches Augsut
Bezold schreiben wollte, rechts einer der Tafeln mit
Kristallskizzen aus der
Feder von BEZOLD aus dem Lehrbuch von WAGNER (1842) nach den
Vorlesungen von Johann Nepomuk (von) FUCHS (*1774 †1856).
Nach ihm wurde die grüne Muskovit-Variante "Fuchsit" benannt, die
es auch einigen Stellen im Spessart gibt.
Der Kulturrundweg
von Kleinkahl: "Über dem Horizont"

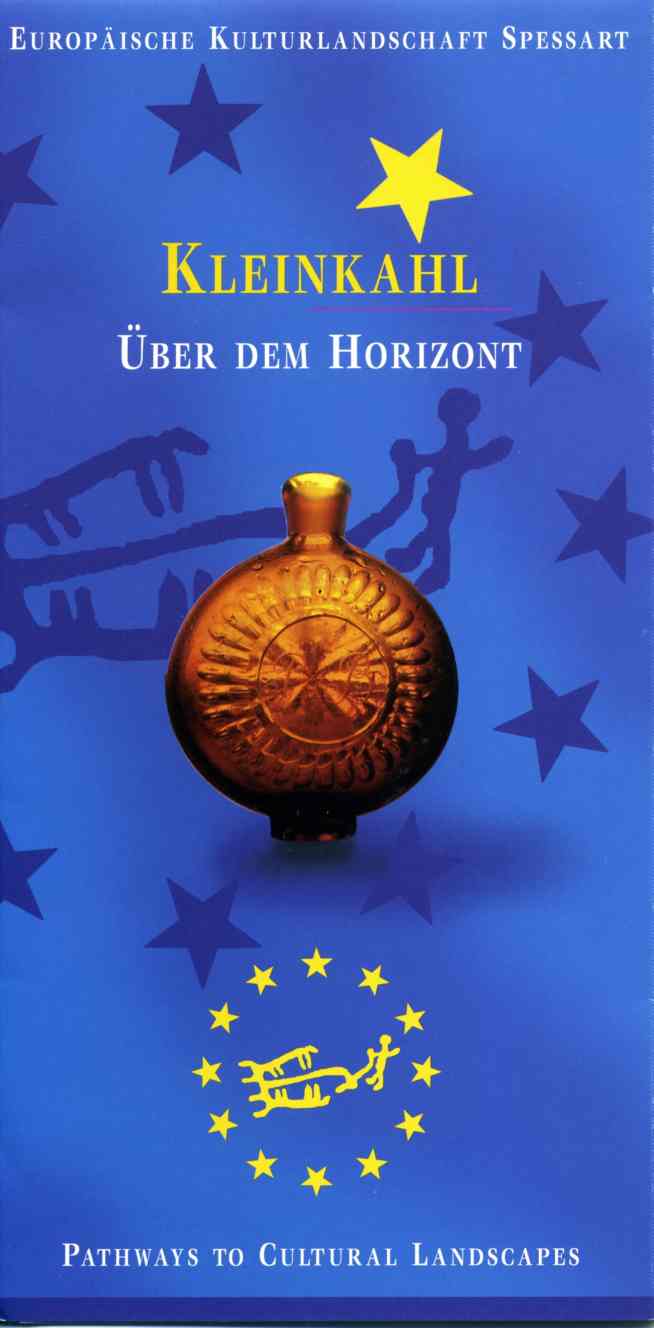
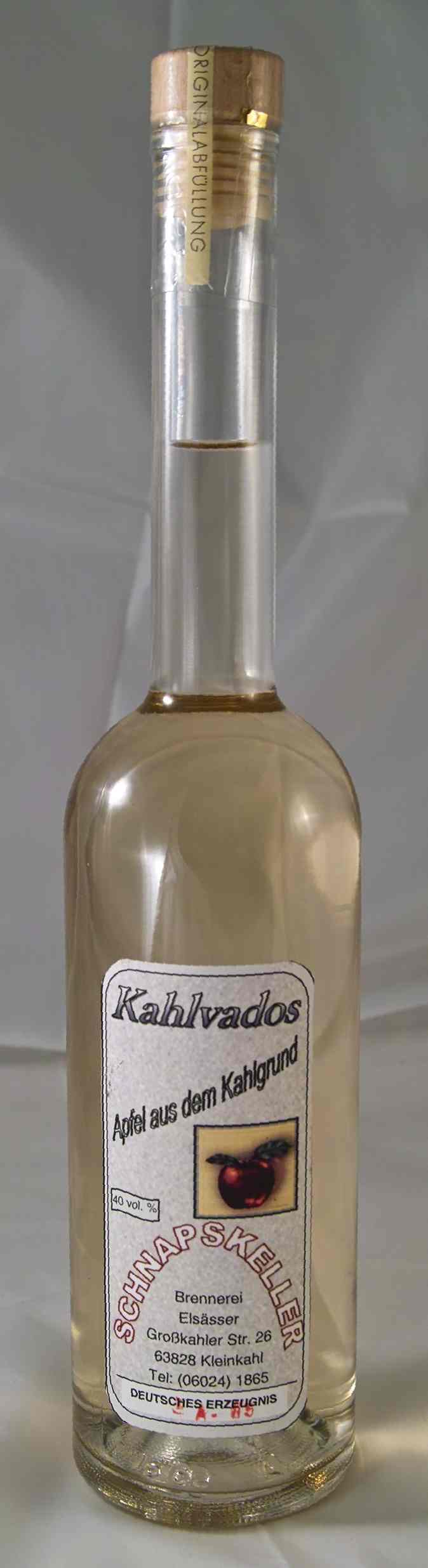
Links: Die Bürgermeisterin, Frau Angelika KREBS, eröffnet vor ca.
100 Zuhörern zwischen druckfrischen Faltblättern
und reifen Äpfeln den 66. Kulturrundweg des Spessarts in Kleinkahl
am 05.10.2008.
Mitte: Die Titelseite des Faltblattes mit einer Bockbeutelflasche
aus der Produktion der Kahler Glashütte
Rechts: Eine 0,5 l Flasche "Kahlvados", ein 40%iger Apfelschnaps
in Anlehnung an den Calvados von der Brennerei
Elsässer in Kleinkahl.
Am Sonntag, den 05.10.2008 wurde unter Mitwirkung und Beisein von
Dr. Gerrit HIMMELSBACH (Archäologisches Spessartprojekt
Aschaffenburg), Frau Angelika KREBS (Bürgermeisterin), Herrn Dr.
Klaus FREYMANN (Deutschen Museum in München), Dr. Gerhard
ERMISCHER (Archäologisches Spessartprojekt), Gerhard STÜHLER
(Bayerische Forsten), Dr. Gerhard KAMPFMANN (Glashüttenfachmann
Aschaffenburg), Peter STEPPUHN (Glasfachmann aus Wismar, *1956
†2018), Joachim LORENZ (Karlstein) und den Helfern der
Arbeitsgemeinschaft Rundweg der 66. Kulturrundweg des Spessarts in
Kleinkahl eröffnet und anschließend begangen.Dabei wurden an den
mit Tafeln ausgestatteten Stationen Ausführungen der Fachleute
vorgetragen und zusätzliche Informationen gegeben. Das Wetter war
entgegen des Wetterberichtes nur von seltenen und leichtem Regen
begleitet.
Das Essen kam nicht zu kurz: Zu Beginn gab es Äpfel, in der
Turnhalle wurden zum Mittag Untererdkohlrabi, Kümmelbauch und
(Hand-)Käse mit Musik (Quark mit Zwiebeln und Brot) gereicht, an
der Bamberger Mühle (Pension Kilgenstein) gab es Kaffee und
Kuchen. So gestärkt hielten die meisten der ca. 100
Mitläufer/innen bis zum Schluss durch.

Dr. Klaus FEYMANN spricht an der Tafel zum Bergamt Kahl und zum
Bergwerk
der Grube Hilfe Gottes (im Hintergrund am Habersberg infolge der
Bäume nicht
sichtbar).
Aufgenommen am 05.10.2008

Die Reste der Glashütte Epstein 1 in der Nähe der Kahlquelle nahe
der
Bamberger Mühle,
aufgenommen am 05.10.2008.
Dr. Gerrit HIMMELSBACH und Dr. Peter STEPPUHN erläuterten die
Funktion. Sie ist aus dem Jahre 1510 urkundlich belegt und besaß
Öfen aus Sandstein. Die Besucher stehen um den großen Hauptofen
mit der beidseitigen Erläuterungstafel. Im Vordergrund erkennt man
die 4 Nebenöfen mit den angedeuteten Schürkanälen. Diese Glashütte
wurde 1980 archäologisch untersucht und im Jahre 2008 konserviert
und der Befund ca. 0,5 m höher nachgebaut, so dass die Besucher
einen Eindruck von der Ausdehnung erhalten können, nur muss man
sich über den kuppelfömigen Öfen ein einfaches hölzernes Bauwerk
denken, der die Öfen und die ca. 15 hier arbeitenden Menschen vor
der Witterung schützten - deshalb Glashütte. Von diesen Bauten ist
jedoch nichts übrig geblieben.
Die ebenfalls nicht mehr vorhandene Kahler Glashütte am heutigen
Glashüttenhof wurde von 1761 bis 1854 betrieben. Gläser aus dieser
Hütte sind im Heimatmuseum in Wertheim und im Museum in Büdingen
zu sehen. Ein hier gefertigter Glaslüster hing in der Kirche in
Kleinkahl und wurde nach einer Restauration im Schloss
Johannisburg aufgehängt (im städtischen Teil der Museen).
Literatur:
AMRHEIN, A. (1896): Der Bergbau im Spessart unter der Regierung
der Kurfürsten von Mainz.- Archiv des historischen Vereins, Bd. 37,
S. 24ff, [Stahel´sche Buchhandlung] Würzburg.
BEHLEN, St. (1823): Der Spessart. Versuch einer Topographie dieser
Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-, Forst-, Erd-
und Volkskunde.- 1. Band, S. 34ff, 2. Band S. 158f, [Brockhaus]
Leipzig.
FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag
zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des
Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,
Aschaffenburg.
FRIEDRICH, G., DIEDEL, R., SCHMIDT, F. P. & SCHUMACHER, C.
(1984): Untersuchungen an Cu-As-Sulfiden und Arseniden des basalen
Zechsteins der Gebiete Spessart/Rhön und Richelsdorf.-
Fortschritte Mineralogie 41, Beiheft 1, S. 63 - 65.
KUGLER, J. (1991): Der Bergbau bei Großkahl (1. Teil).- Unser
Kahlgrund 36, S. 158 - 163, Alzenau.
KUGLER, J. (1993): Der Bergbau bei Großkahl (2. Teil).- Unser
Kahlgrund 38, S. 129 - 134, Alzenau.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 41, 642ff.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart.
Geologische Entwicklung und Struktur, Gesteine und Minerale.- 2.
Aufl., Sammlung Geologischer Führer Band 106, VIII, 368
Seiten, 103 größtenteils farbige Abbildungen, 2 farbige
geologische Karten (43 x 30 cm) [Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
PAUL, J. (2006): Der Kupferschiefer: Lithologie, Stratigraphie,
Fazies und Metallogenese eines Schwarzschiefers.- Zeitschrift der
Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften Band 157, 2006, Heft
1, S. 57 – 76, 7 Abb., 1 Tab., [Schweizerbart´sche
Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
PRÜFERT, J. (1969): Der Zechstein im Gebiet des Vorspessarts und
der Wetterau.- Sonderveröffentlichung d. Geologischen Inst. d.
Univ. zu Köln, Heft 16, 176 + X Seiten, Bonn.
SCHMITT, R. T. (1991): Buntmetallmineralisation im Zechstein 1
(Werra-Folge) des nordwestlichen Vorspessarts
(Großkahl-Huckelheim-Altenmittlau).- Diplomarbeit am Institut f.
Mineralogie der Uni. Würzburg, 228 S., Würzburg
[unveröffentlicht].
SCHMITT, R. T. (1993): Sulfide und Arsenide aus den Gruben Segen
Gottes bei Huckelheim und Hilfe Gottes bei Großkahl im Spessart.-
Aufschluss 44, S. 111 - 122, Heidelberg.
SCHMITT, R. T. (2001): Zur Petrographie, Geochemie und
Buntmetallmineralisation des Zechstein 1 (Werra-Folge) im Gebiet
Huckelheim - Großkahl (Nordwestlicher Spessart).- Mitteilungen des
Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Bd. 20,
100 S., 42 Abb. (davon 5 farbig), 23 Tab., Hrsg. vom
Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg.
WAGNER, J. A. (1842): Naturgeschichte des Mineralreichs nach den
Vorlesungen des Dr. Joh. Nep. Fuchs.- Handbuch der Naturgeschichte
III. Band, 352 S., 4 Figurentafeln (ausklappbar) im Anhang,
[Verlag von Tobias Danheimer] Kempten.
Zurück zur
Homepage oder zum Anfang der Seite