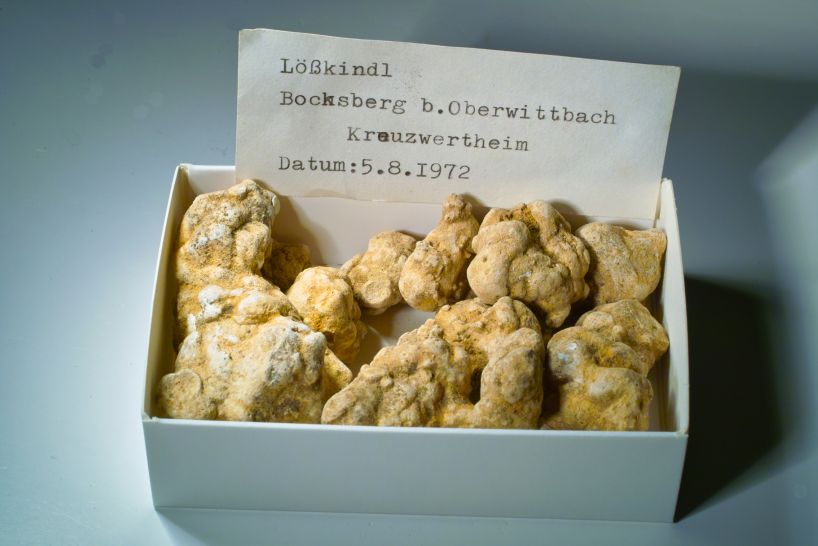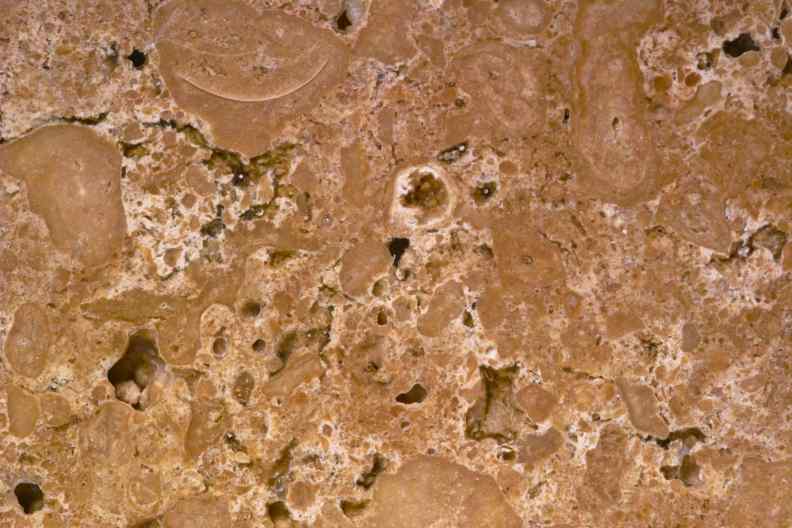Über einen Rest von echtem Kalkstein*
im Spessart.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main
Am südöstlichsten Zipfel des Spessarts liegt als
kahle Höhe der unscheinbare Bocksberg,
nahe der Ortschaften Rettersheim und Unterwittbach.
 Der flache Bocksberg bei Unterwittbach im
landwirtschaftlich geprägten,
Der flache Bocksberg bei Unterwittbach im
landwirtschaftlich geprägten,
südöstlichen Spessart;
aufgenommen am 16.05.2005 
Hier wurde in einem weitläufigen und sehr
flachen Steinbruch Kalkstein
abgebaut;
aufgenommen am 16.10.2005
Lage:
Ehemaliger, weitläufiger und flacher Kalksteinbruch (Unterer
Wellenkalk über dem Grenzgelbkalk) auf dem Bocksberg NE
Unterwittbach (TK 6123 Marktheidenfeld, R 4080 H 1890, siehe Okrusch
et al. 2011, S. 275, Aufschluss Nr. 254). Auf der Straße
Kreuzwertheim-Marktheidenfeld bis zur Abzweigung nach Oberwittbach
(zwischen km 7 und 6), dort nach rechts in Richtung SE zu der
flachen, ausgedehnten Bruchanlage.
Der Steinbruch mit den sehr wenigen und niedrigen Felsen ist sicher
seit 1980 oder früher aufgelassen und teilweise verfüllt. Das Geläde
ist inzwischen mit einer typischen Kalkflora verwachsen und als
Naturdenkmal geschützt. Es wurde dort ein Hochbehälter für die
öffentliche Wasserversorgung errichtet. Die beginnende, krautige und
sehr kümmerliche Vegetation zeichnet auf der ebenen Bruchsohle das
Kluftnetz nach. Auf den wenigen mineralisierten Kluftflächen kann
man etwas Calcit erkennen; stellenweise ist auch erdiger Goethit zu
finden.

Einer der wenigen noch sichtbaren Felsen von ca. 2
m Höhe;
aufgenommen am 16.10.2005
Der Steinbruch ist seit langer Zeit im Abbau. Hier wurden in der
Ziegelei im nahen Rettersheim zu den Ziegeln auch der Kalk in
einem Schachtofen gebrannt. Die erste Erwähnung stammt aus dem
Jahr 1695, als man in den Folgejahren - bis 1803 - für das Kloster
in Triefenstein Kalk brannte. Der Kalkstein zum Brennen wurde am
nahen Boxberg gewonnen, den man dafür entwaldete. Die daraus
entstandene Ziegelei der Familie Nöth bestand von 1868 bis
1951. Noch 1919 wurde außerhalb des Ortes ein einfacher
Schachtofen1 erbaut. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde
statt Holz zum Brennen Kohle oder Koks verwendet, der mit der Bahn
ab Trennfeld geliefert werden konnte. Da der Kalkstein von
Bocksberg wenig Eisen und Ton enthielt, konnte auch weißer Kalk
zum Tünchen gebrannt werden. Die Verwendung des Grenzgelbkalks mit
seinem deutlichen Fe- und Mg-Gehalt führte zum schwarzen Kalk, der
zu Mauermörtel verarbeitet wurde (MÜLLER et al. 1998:272ff).
Der Kalkstein war einst von Löss überdeckt, der im Zuge der
Arbeiten abgetragen wurde. Davon künden noch erhaltene
Konkretionen, die Lösskindl oder auch Lösspuppen genannt werden.
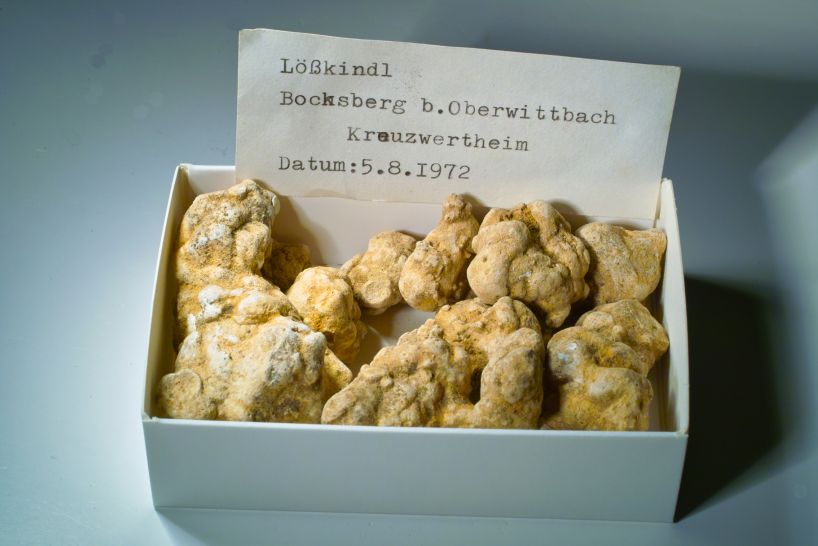
Lösskindl aus Calcit vom Löss des Bocksbergs aus
einer alten Mineraliensammlung;
aufgesammelt am 05.08.1972,
Bildreite 13 cm
Geologie:
Bei dem grauen, bröckeligen Kalk handelt es sich um ein Sediment
des Muschelkalkmeeres, welches vor ca. 240 bis 232 Millionen
Jahren hier über dem Spessart lag.
Es überflutete nach der Ablagerung des Buntsandsteines weite Teile
des heutigen Deutschlands. Die Ablagerungen beginnen über den
obersten (jüngsten) Schichten des Buntsandsteins mit einer
auffälligen, gelblichen, harten Lage aus Kalk ("Grenzgelbkalk",
die man nicht im Steinbruch selbst, sondern nur auf den
umliegenden Feldern als Lesesteine finden kann - siehe auch weiter
unten das Foto vom Aufschluss am
Zippammerweg). Darauf folgen dünne, merkwürdig wellig aussehende
Schichten des Unteren Wellenkalkes (treffender Name!). Diese
sondern sehr leicht plattig ab und bilden kam dickere
Einzelschichten als 5 cm. Die Schichtoberflächen (bzw. auch deren
Unterseiten) sehen durch unregelmäßige, napfförmige Vertiefungen
auf den Steinbruchsohle "pockennarbig" aus. Das nach der
Verfestigung entstandene Kluftnetz wird durch den sehr spärlichen
Pflanzenwuchs nachgezeichnet, da an den Klüften mehr Wasser als
auf den kahlen Flächen zur Verfügung steht. Der gesamte
Muschelkalk hatte einst eine Mächtigkeit von ca. 100 Meter.


Die Steinbruchsohle mit den Vertiefungen; der Kalk
ist im Schliff marmoriert (Bildbreite ca. 10 cm) und zeigt die
Spuren von Rutschungen.
Hier geht man auf ehemaligem Meeresboden umher!
Aufgenommen am 16.05.2005.
Es sind die Ablagerungen eines tiefen Meeres, welches nicht durch
Lebewesen umgeschichtet wurden und die durch Rutschungen und
unterschiedliche Kompaktion dieses Aussehen erhielten. Der Kalk
selbst besteht aus den zahllosen und winzigen Hartteilen von
marinen Lebewesen, die nach dem Absterben auf den Meeresgrund
sanken. Daraus wurde ein schlammiges Sediment, welches mit
zunehmender Dicke zusammensackte und entwässert wurde. Mit dem
Anwachsen der Kalkschicht wird der Druck in den darunter liegenden
Lagen größer und das Gestein wird auch durch Lösung und
Wiederausscheiden von Calcit zu einem festen Gestein.
Darüberhinaus kann auch Magnesium zu- oder abgeführt werden.


Der Kalk ist außen unscheinbar Bildbreite ca. 50
cm - aufgenommen am 16.05.2005); im Schliff rechts offenbart
sich ein geflecktes Inneres mit den zahlreichen Rissen;
Bildbreite ca. 12 cm
Und wie ging es weiter? Nach dem Ablagern von ca. 100 m Kalk
wurden nochmals ca. 700 m Sedimente des Keuper abgelagert; ihm
folgten die Meeressedimente des Juras. Ob diese jedoch auch im
Spessart je vorhanden waren, weiß man nicht, da keine Reste mehr
davon zu finde sind. Während des Kreidemeeres war der Spessart
bereits sicher eine Abtragungsgebiet.
Die höheren und damit jüngeren Schichten des Muschelkalkes sind
hier wegerodiert worden und lassen sich nur noch auf der von hier
aus im Osten sichtbaren (bei schönem Wetter) Wand des Kalmut bei
Homburg studieren.
Das kleine und heute isolierte im Spessart liegende Vorkommen
belegt, dass die Sedimente des Muschelkalkes einst eine größere
Verbreitung hatte, als man sie heute noch finden kann. Infolge der
ostwärts geneigten Verkippung des Spessarts wurden sie zuerst im
Westen wegerodiert, so dass die Ausdehnung nach Westen - bis nach
Aschaffenburg? - nur vermutet werden kann.
Fossilien:
Der Beweis sind die wenigen Fossilien aus Brachiopoden, Schnecken
und Seeigelstacheln. Es handelt sich um Steinkerne, bei denen die
harte Schale weggelöst wurde und das Sediment im Innern die Form
überliefert hat. Sie sind zudem schlecht erhalten und meist
verdrückt. Diese fossilen Überreste sind nicht sammelwürdig und
infolge des seit langem ruhenden Abbaues sind kaum mehr Funde
möglich, da die Fossilien in diesen Schichten des Muschelkalkes
selten und die Flächen weitgehend abgesucht sind.


Brachiopoden (?) als Schalenabdrücke;
links ca. 14 cm breit, rechts Steinkerne ca. 7 cm breit

Lage aus einem Schnecken- und Muschelschill mit
Seeigelstacheln bestehend aus
Steinkernen. Die eigentlichen Schalen wurden weggelöst, so dass
nur noch die
Sedimentfüllungen erhalten sind. Der Fund stammt aus dem Jahr
1980;
Bildbreite ca. 20 cm.
Die gleiche Folge von Sedimentgesteinen sind auch im großen
Steinbruch des Zementwerks in Lengfurt auf der anderen Mainseite
aufgeschlossen.

Gelblicher Kalksinter in rundlicher Ausbildung und
überkrustet von einer weiteren Lage aus braunem Calcit,
Bildbreite 4 cm
|

Außergewöhnliches Stück einer muschelreichen Bank aus dem
Unteren Muschelkalk,
Bildbreite 10 cm
|

Kalkstein, randlich von dem Kluftnetz entfärbt (gebleicht),
aufgenommen am 30.05.2013
|
Homburg (Triefenstein):
In Homburg steht auf einem Kalkfelsen (Kalksinter) ein kleines
Schloss. Dieser Kalkfelsen ist eine Bildung aus rezentem
Süßwasserkalk (Kalktuff), wie man unterhalb des weithin sichtbaren
Bauwerkes sehen kann (am besten von der Mainseite aus). Im Innern
des Felsens befindet sich auch eine Grotte mit Tropfsteinen,
ausgebaut zu einer Kapelle (durch eine Treppe neben dem Schloss
zugänglich).
Das Wasser einer Quelle führt größere Mengen an gelösten Calcium
("Kalk"), der sich dann beim Kontakt mit der Atmosphäre unter
Hilfe von Pflanzen (wie Algen, Moose, aber wohl auch Bakterien)
abscheidet. Dieser über Jahrtausende zu verfolgende Vorgang bildet
dann diesen wachsenden Felsen. Das Überkragen der Bildungszone
führt zur Entstehung von Hohlräumen, die dann zu Tropfsteinhöhlen
werden können.
Das spätere Durchsickern mit Wasser und die fortwährende
Abscheidung von Kalk führt dann zur Bildung des bekannten Gesteins
Travertin (aus anderen Orten wird dieser zu Platten gesägt und
wegen der hübschen Bänderung an Fassaden montiert).

Blick vom Kallmuth auf den Ort Homburg mit dem
Main und dem Schloss auf dem
markanten Felsen;
aufgenommen am 16.10.2005.
Der Vorgang der reztenten Kalkabscheidung ist noch zu sehen, da
man auf der Nordseite das kalkhaltige Wasser über einen
wachsenden, runden, durch Bewuchs grünlichen Felsen laufen lässt.
Grenze Buntsandstein - Muschelkalk!
Im Weinberg des Hombuger Kallmuth ist am Zippammerweg ein
phantastischer Aufschluss des Grenzgelbkalkes zu sehen: Unten die
obersten Schichten des Buntsandsteins, daürber die untersten Lagen
des Muschelkalks! Es ist in der Region die einzige Stelle, an der
man mit den Füßen auf dem obersten (festländisch entstandenen)
Buntsandstein steht und mit den Händen den marin entstandenen
Muschelkalk greifen kann.


Links: Die Weinreben wachsen auf den Röttonen des
Oberen Buntsandsteins, darüber die Geländeversteilung und die
kahlen
Felsen bestehen aus dem Unteren Muschelkalk,
aufgenommen am 30.09.2012.
Rechts: Der Zipammerweg verläuft genau über die Grenze des Grenzgelbkalks;
aufgenommen am 10.02.2008.
Kulturrundweg "Wein & Stein" Triefenstein
Route 2
Der etwa 8,5 km lange Weg erschließt den Kallmuth, das Zementwerk
der HeidelbergCement im Unteren Muschelkalk, den Schlossfelsen im
Homburg und das Museum Papiermühle Homburg. Der Weg wurde unter
reger Teilnahme der Bevölkerung und der lokalen Politik am
30.09.2012 eröffnet; es kamen bei herrlichem Herbstwetter über 250
Wanderer! Eine Arbeitsgemeinschaft unter Leitung von Frau Nöth und
Dr. Gerrit Himmelsbach vom Archäologischen Spessartprojekt plante
die Ziele, Wegführung und die Tafeln.
Bildergalerie von der Eröffnung:


Links: Die Segnung der aus Sandstein
(Buntsandstein) bestehenden Dreifaltigkeitsstäule von 1728 auf
dem Marktplatz in Lengfurt am 30.09.2012 bei Frühnebel.
Rechts: Die einem Obelisken nachempfundene Säule von der
Renovierung 2012 am 31.08.2009 aus einer anderen Perspektive.


Die Abkürzung führte mitten durch die Anlagen des
Zementwerks der Fa. HeidelbergCement und dessen großer
Steinbruch am 30.09.2012, der den Unteren Muschelkalk in
seiner gesamten Mächtigkeit von ca. 80 m erschließt. Der
Aussichtspunkt ist nach einem steilen Anstieg erreichbar.

Schriften, Faltblätter und Bücher gab´s bei Patric
NIETZKE aus Triefenstein aus einem
Bauchladen, wie ich ihn aus meiner Kindheit vom Kino und
Fußballplatz mit Kaugummi
und Zigaretten kenne!

Das Museum Papiermühle Homburg aus dem Jahr 1807
aufgenommen am 30.09.2012


Der aus Kalksinter (Kalktuff) bestehende
Schlossfelsen in Homrburg mit seinen Höhlen aus rezemtem Kalk.
Der Kalk wurde abgebaut und fand als Leichtbaustein
beispielsweise
Verwendung in der Decke der Residenz von Würzburg und der
Glasproduktion des spessarter Glashütten in der Neuzeit. Der
Abbau wurde erst im 18. Jahrhundert eingestellt,
nachdem die Gebäude auf dem Felsen Risse zeigten,
aufgenommen am 30.09.2012

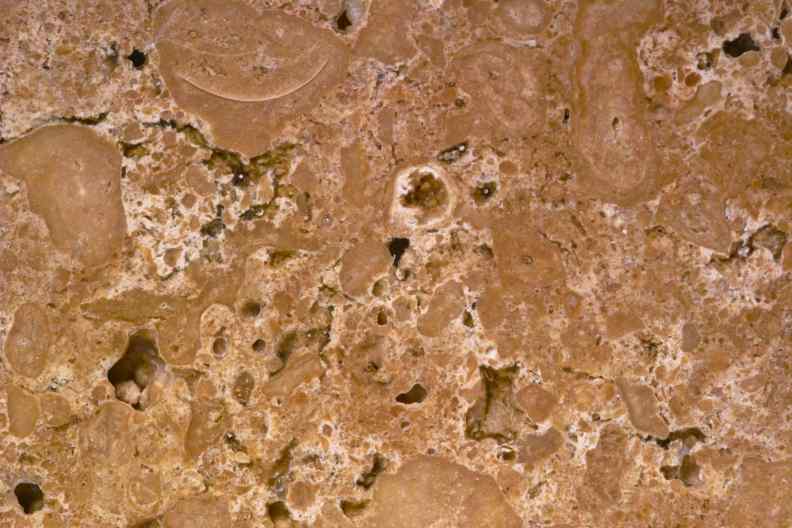
Geschliffen und poliertes Stück des porösen
Kalksinters, links Bildbreite 8 cm, rechts ein Ausschnitt
Bildbreite 2 cm (das Stück wurde
freundlicherweise von Familie TRABEL aus Homburg aus alten
Beständen zur Verfügung gestellt).

Ein 10 cm langer Abschnitt einer Wasserleitung in
DN 200 aus Homburg (geborgen von
der Baufirma Michael TRABEL aus Triefenstein und gesägt vom Steinmetz Ralf
DETZNER
in Großkrotzenburg). Diese unglaubliche Menge an einem sehr
porösen Kalksinter hat
sich in einer kurzen Zeitspanne von nur ca. 20 Jahren gebildet!

Die Speisung der 250 hungrigen Wanderer auf dem
Schlossplatz in Homburg - bei sonnigem
Wetter und Musik. Neben Zwiebelkuchen gab es Kochkäse und
Kürbissuppe, dazu Wein
und Most,
aufgenommen am 30.09.2012.

Das Gespräch zwischen den Machern: (v. l.)
Johannes FOLLMER vom Museum
Papiermühle Homburg, Patric NIETZKE vom Tourismus-Verband
Triefenstein und
Dr. Gerrit HIMMELSBACH vom Archäologischen Spessartprojet
Aschaffenburg
(im Vordergrund der Herr Sohn) am 30.09.2012.
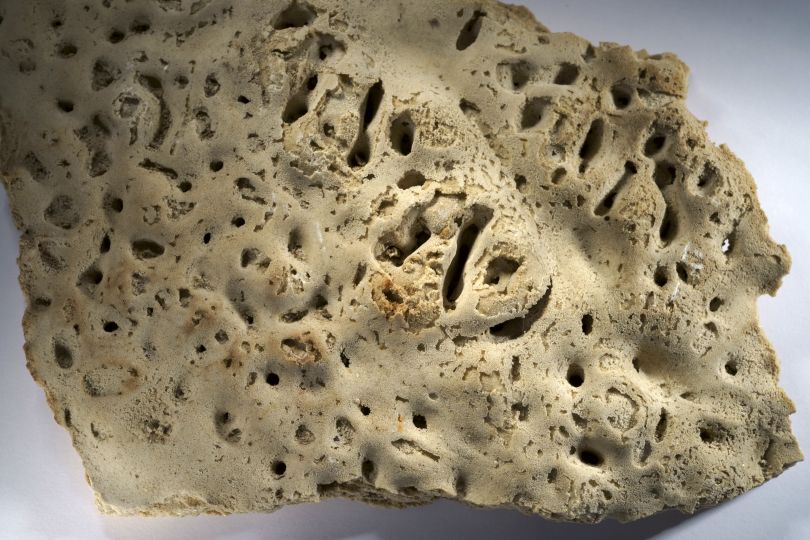
Ungefähr 1 cm dicker Kalksinter vom stählernen
Mühlrad der Papiermühle in Homburg,
zur Verfügung gestellt von Hartmut STAHL, Schweinfurt,
Bildbreite 15 cm.
Literatur:
GEYER, G. (2002): Geologie von Unterfranken und angrenzenden
Regionen.- Fränkische Landschaft Arbeiten zur Geolgraphie von
Franken Band 2, 588 S., 234 Abb., 5 Tab., 1 Geologische
Karte lose im Anhang, [Klett-Perthes] Gotha.
GRÄTER, C. (1995): Kallmuth, ein Berg und ein Wein "von fast
beängstigendem Feuer". Eine Weinberglage am Mainviereck, die als
"Historischer Weinberg" seit 1981 unter Denkmalschutz
steht.- Spessart Heft 6 1995, S. 3 - 6, 2 Abb., [Druck und
Verlag Main-Echo Kirsch GmbH & Co.] Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 123ff, 628.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 88ff, 94f, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,
Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei
Joh. Walch] Augsburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, S. 171 f, Berlin.
MÜLLER, E., KUHN, B. & NÖTH-GREIS, G. (1998): Rettersheim.
Chronik eines kleinen Dorfes.- Beiträge zur Geschichte des Marktes
Triefenstein Band 5, 303 S., zahlreiche, teils farb. Abb.,
Gemeinde Markt Triefenstein, [Hinckel-Druck] Wertheim.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
SCHWARZMEIER, J. (1980): Geologische Karte von Bayern 1:25000
Erläuterungen zu Blatt Nr. 6023 Lohr a. Main.- 159 S., 23 Abb., 5
Tab., 6 Beilagen, 1 Karte, Bayerisches Geologisches Landesamt
München.
*im Gegensatz zu den magnesiumhaltigen permischen Kalken und
Dolomiten des westlichen Spessarts.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite