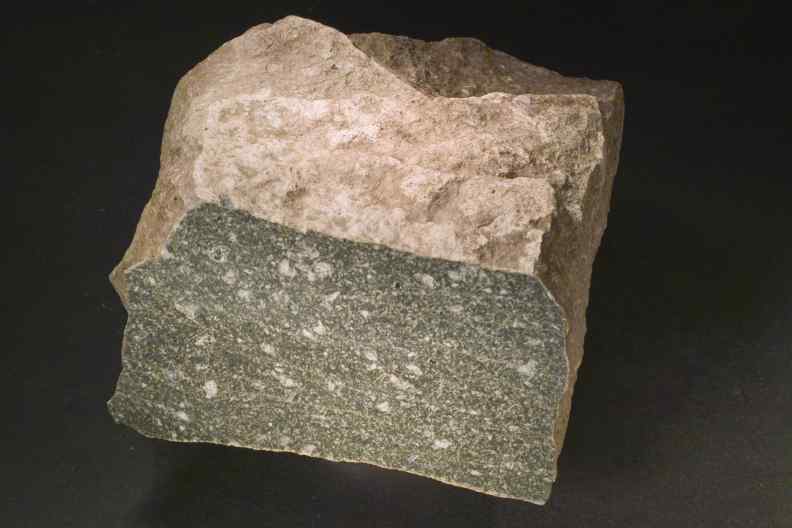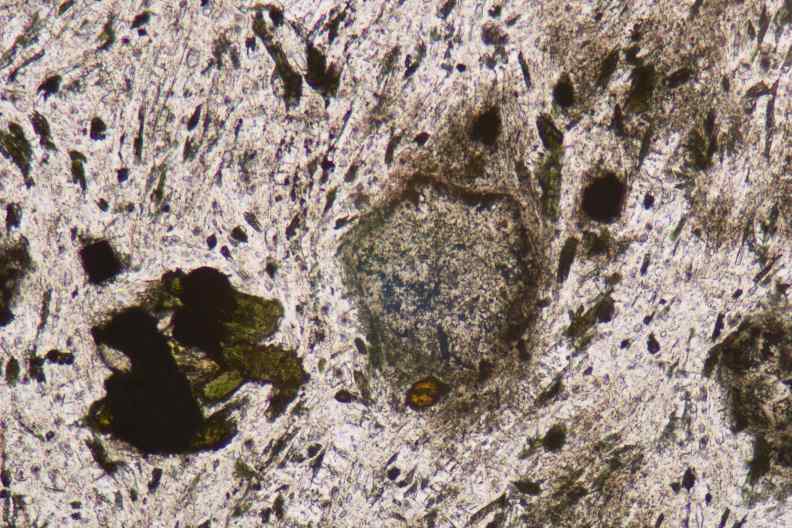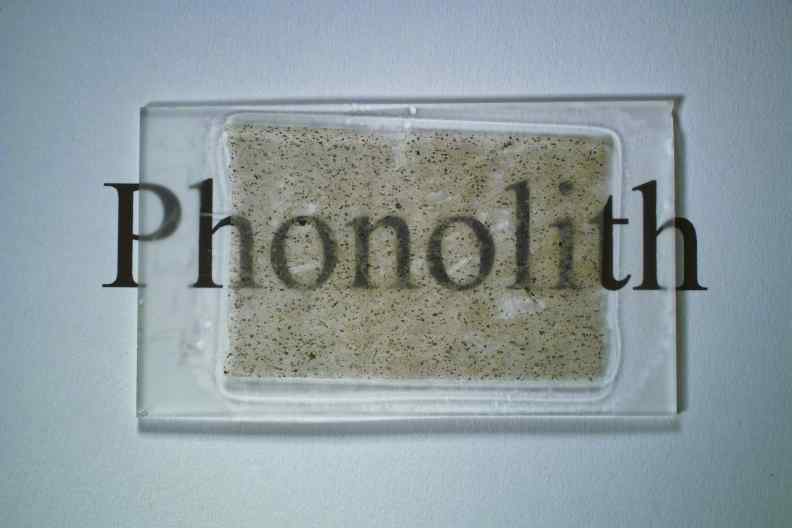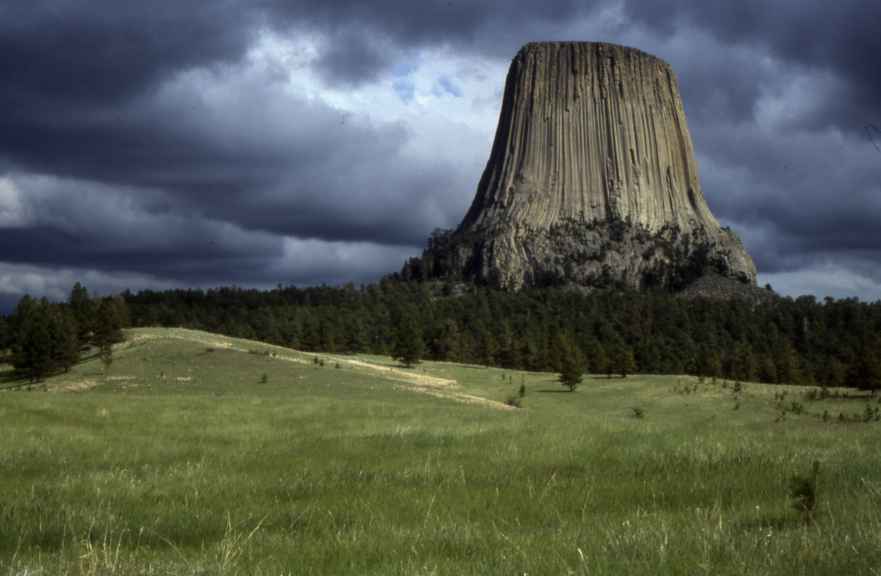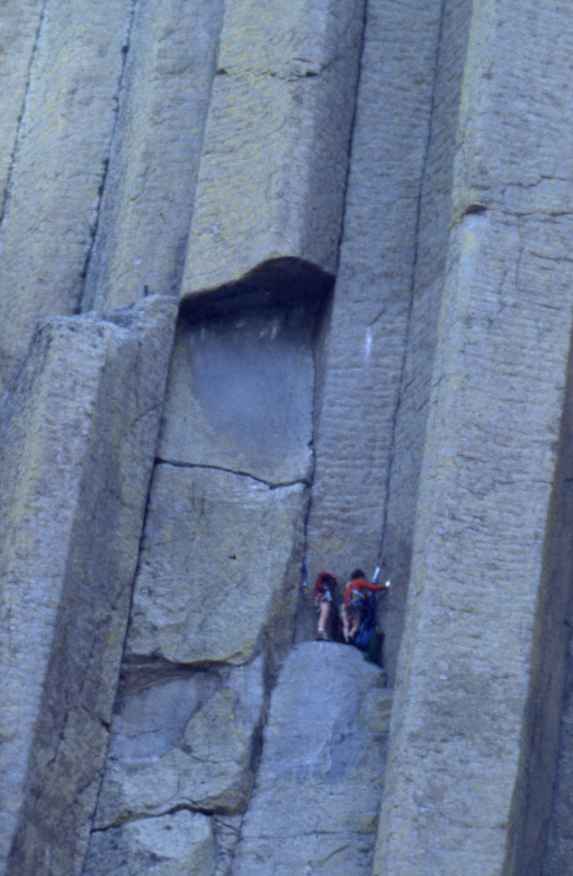Der Phonolith*
in der Rückersbacher Schlucht und im Lindig bei
Kleinostheim im Spessart
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Der kleine, alte und völlig überwachsene Steinbruch, links
aufgenommen am 7.12.2003, rechts am 14.02.2014. In den letzten
Jahren sind
zahlreiche Bäume umgefallen und der Steinbruch ist schwer
zugänglich.
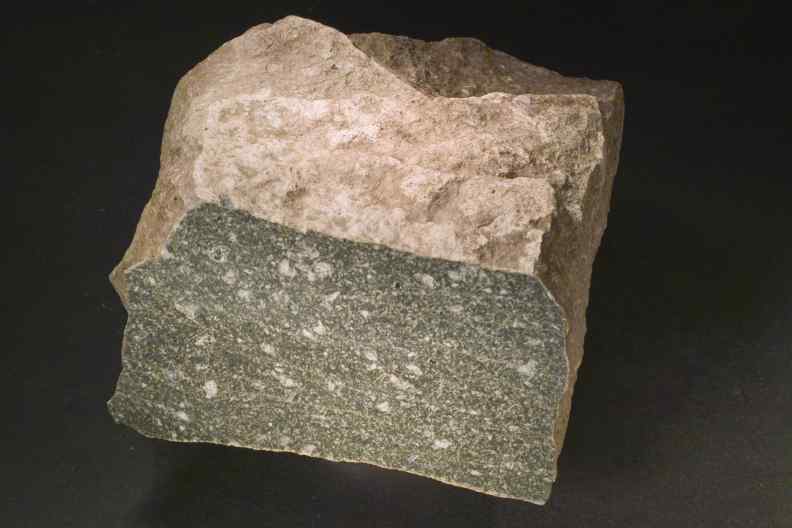
Handstück aus Phonolith, eine Seite angeschliffen und poliert,
in der
man den gesprenkelten Gesteinsaufbau mit den großen
Sanidin-Kristallen
erkennen kann. Die Oberfläche ist ganz typisch hellgrau
verwittert, so
dass man die vulkanische Natur des Gesteins erst am frischen
Bruch
erkennen kann;
Bildbreite 14 cm
*Phonolithe sind aus natürlichen Schmelzen erstarrte
Ergussgesteine (Alkaligestein, im Streckeisendiagramm Feld 11).
Solche Magmen entstehen durch Differenzierung in Magmenkammern
innerhalb von Kontinentalplatten, bei denen es zu einer Trennung
der Schmelzanteilen kommt. Sie sind extrem untersättigt mit SiO2,
so dass sich die sonst üblichen Minerale in Ergussgesteinen
nicht bilden können. Sie enthalten hauptsächlich Feldspäte
(Sanidin), Nephelin und in geringem Umfang weitere Bestandteile
wie Hauyn, Ägirinaugit, Ägirin, Magnetit, Titanit, Hornblende, -
aber überhaupt keinen Quarz. Dazu findet sich noch etwas
Gesteinsglas.
Der Name (griechisch "Klingstein") leitet sich von der plattigen
Absonderung her; diese plattigen Stücke klingen hell beim
Anschlagen (das tun Platten aus anderen Gesteinen die reich an
Glas sind und Keramiken aber auch, so dass das kein
Bestimmungsmerkmal ist).
Weitere Phonolith-Vorkommen sind (teilweise nach HOFBAUER
2016):
- Odenwald: Katzenbuckel im
südlichen Odenwald bei Waldkatzenbach; der Berg ist mit 626
m die höchste Erhebung des Odenwalds,
- Rhön: Milseburg 835 m, Kesselkopf bei Rupsroth,
Steinwand bei Poppenhausen,
- Haßberge: Burgberg bei Heldburg,
- Hegau: Mägdeberg, Hohentwiel, Hohenkrähen,
- Eifel: Kempenich, Riedener Kessel, Wehrer Kessel,
Laacher-See-Vulkan, Engelner Kopf,
- Kaiserstuhl: Bötzingen, Oberrothweil,
- Erzgebirge: Hammerunterwiesenthal (Steinbruch
Richter),
- Oberlausitz: Oberroderwitzer Spitzberg im Zittauer
Gebirge,
- Auvergne in Frankreich,
- Vesuv in Italien,
- Kanarische Inseln: Teneriffa,
- Rift Valley in Ostafrika,
- St. Helena, Süd-Atlantik,
- Devils Tower in Wyoming,
- Mount Erebus in der Antarktis. Der 3.800 m hohe aktive,
südlichste Vulkan weltweit besitzt einer der wenigen
Lavaseen mit einem phonolithischen Magma. Das aus der Lava
kristallisierende Gestein Phonolith enthält als Besonderheit
bis zu 10 cm große Anorthoklas-Kristalle (KLEINSCHMIDT
2021:180ff).
- ...
Verwendung: Sie ist grundsätzlich ähnlich dem des
Basaltes, Schotter, Splitte, Edelsplitt für den Straßenbau und
als Zuschlag für den Beton. Als Zuschlag für Kellersteine,
Fassadenplatten, als Naturstein im Gartenbau, gemahlen als
Zuschlag im Gemenge für Farbglas, Glasur- und Emailfritten,
als Düngemittel und Bodenverbesserer und für Fangoanwendungen
in der Naturheilkunde.
Phonolith wurde vom Berufsverband Deutscher
Geowissenschaftler (BDG) zum Gestein des Jahres 2014 gekürt.


Links: Bruchrauhe Fläche des Phonoliths; man beachte die hell
glänzenden Sanindin-Kristallen,
Bildbreite 7 cm
Rechts: angeschliffen und polierte Fläche des Phonoliths. Man
erkennt die vielen weißen, leistenförmigen Sanidin-Kristalle,
dazwischen einzelne
dunkle Augit-Körner und wenige Risse,
Bildbreite 2 cm.
Lage:
Kleiner Steinbruch an der Althoburg am Ende eines Seitentälchens E
"Eichelberg" nahe der Rückersbaches Schlucht bei Kleinostheim
(Geologische Karte Blatt 5920 „Alzenau i. Ufr.“, R 3506232
H 5543458, siehe auch OKRUSCH et al. S. 211,
Aufschluss Nr. 104). Zu erreichen über den geteerten Weg,
beginnend an der Gaststätte "Schluchthof", nach ca. 800 m zweigt
links ein kleiner Weg ab, nachdem man das Schlammabsetzbecken
passiert hat.
Man sah 1977 noch Reste (Mauerwerk) des ehemaligen Bruchbetriebes.
Hier wurde wahrscheinlich im 19. und vielleicht auch noch im 20.
Jahrhundert der Phonolith als Rohmaterial zur Schotter- und
Pflastersteingewinnung von Hand abgebaut. Über die Mengen und
Zeiten ist derzeit nichts bekannt. Im Steinbruch ist noch eine
ringförmig verlaufende Berme am oberen Rand erkennbar, die
angelegt wurde, damit kein Wasser in den Abbau läuft.
Der nach heutigen Maßstäben recht kleine Steinbruch aufgelassen,
verwachsen und kaum mehr als solcher erkennbar (siehe Foto oben).
Obwohl das Vorkommen bei WEINIG et al. (1984:90f) erwähnt wird,
ist aufgrund der Kleinheit des Gesteinskörpers wie auch der Lage
im Wald eines Ballungsraumes nicht mit einer Wiederinbetriebnahme
zu rechnen. Nach heutigen Kalkulationen müsste man für einen
wirtschfaftlichen Betrieb mind. 500 - 1.000 t Gestein (Schotter)
gewinnen können, so dass das kleine Vorkommen nach wenigen Monaten
ausgebeutet wäre.
Das Vorkommen ist in der Geotopliste des Bayerisches Landesamt für
Umwelt unter Geotop-Nummer:671A001 aufgelistet und mit
"überregional bedeutend" und "wertvoll" eingestuft.


Im Steinbruch ist frisches Gestein an den Wänden nur an wenigen
Stellen aufgeschlossen. In der Umgebung finden sich noch einige
größere
Felsen, die mit Moos und Flechten bewachsen, kaum als Phonolithe
erkennbar sind,
aufgenommen am 14.02.2014.
Durch das Bekanntwerden wurde der Zugang freundlicherweise von
der Gemeinde Kleinostheim frei geschnitten, so dass man einfach in
den alten Abbau gehen kann.


Infotafel am Abzweig des Weges von der Rückersbacher Schlucht,
daneben ein ca. 100 kg schwerer Phonolith-Fels,
der im Winter 2016/17 im Rahmen des 95. Kulturrundweges "10 Jahre
länger leben ..." in Kleinostheim poliert wurde.
Unter der weißen Verwitterungsrinde kommt das dunkle, porphyrische
Gestein zum Vorschein. Der weiße Riss zeigt
die beginnende Verwitterung entlang von Klüften; Länge des
Geologenhammes 33 cm.
aufgenommen am 21.04.2014 (links) und rechts am 26.01.2017

Die Arbeitsgemeinschaft des Kulturrundwegs aus Kleinostheim machte
sich am 13.02.2016 ein Bild über die Verhältnisse in dem kleinen
Steinbruch, aufgenommen von Herrn Alfred GLAAB.
Der Phonolith heißt zwar übersetzt "Klingstein", aber
auch der klingt nur in plattigen Stücken. Es ist also sinnlos,
einfach auf den Stein zu hauen und zu erwarten, dass man da
einen Klang hört. Wenn es ein Klang sein soll, dann bräuchte
man ein plattiges, rissfreies Stück und das würde man am
Besten aufhängen.
Ergänzend kann man sagen, dass alle dichten und massigen
Gestein in plattigen Formen klingen (auch technische Produkte
wie Keramiken, z. B. Fliesen!). Wenn ein Riss darin ist, dann
ist der Klang nicht hell. Diesen Test machen die Steinmetze
bereits seit undenklichen Zeiten - als einfache Prüfung der
Qualität.
Die Herkunft das Namens ist einfach zu erklären, leider
aber nicht wer ihn schuf:
-
Der Name Phonolith wurde von dem französischen Geo-
und Mineralogen P. Louis CORDIER (*31.3.1777 †30.3.1861; Prof.
für Mineralogie am Museum für Naturkunde in Paris und
Mitbegründer der franzöischen Geologischen Gesellschaft)
geschaffen. Nach ihm wurde das Mineral Cordierit ((Mg,Fe)2[Al4Si5O18])
benannt,
welches einen ausgeprägten Farbwechsel zeigen kann, je nachdem
aus welcher Richtung man durch einen durchsichtigen Kristall
blickt (Pleochroismus).
Die erste Erwähnung des Namens Phonolith findet sich auf Seite
380 in:
CORDIER, P. L. (1816): Sur les Substances minérales dites en
masse, qui entrent dans la composition des Roches volcaniques
de tous les âges.- Journal de Physique, de Chimie, D´Historie
Naturelle et des Arts, avec des Planches en Taille-Douce; par
J.-C. Delametherie, Juillet an 1816, Tome LXXXIII, S. 352 -
386, ohne Abb., [Mme Ve Courcier]
Paris.
-
Nach anderen Quellen ist der Schöpfer des Namens Phonolith
der Berliner Chemiker Martin Heinrich KLAPROTH (*01.12.1743
†01.01.1817) mit einem Zitat (1801) bzw. (1804); aber nach
Prüfung fand sich in den Texten nur der Klingstein,
allerdings mit einer ersten chemischen Analyse.
-
Und wieder andere Autoren nennen den französischen
Geologen und Ingenieur Jean François D’AUBUISSON de Voisins
(*17.08.1768 †20.08.1841) als Urheber mit dem Zitat in
einer seltenen Schrift:
AUBUISSON [de Voisins], J[ean] F[rancois] d´ (1804):
Description minéralogique du Puy-de-Dôme.- Journal de
Physique, de Chimie, d´Historie Naturelle et des Arts, avec
des Planches en Taille-douce, tome LVIII, p. 422 - 427, ohne
Abb., [J. J. Fuchs] Paris.
So ist es derzeit offen, wer den Namen Phonolith wirklich
zuerst verwandte.
Geologie:
Das kleine Phonolith-Vorkommen besteht aus 2 nahe nebeneinander
liegende Schlotfüllungen, die durch stark verwachsene Steinbrüche
aufgeschlossen sind. Das Vorkommen einer Brekzie (heute nicht mehr
sichtbar) weist auf eine explosive Entstehung hin. Zum Zeitpunkt
der Erstarrung der Schmelze lagen hier noch einige hundert Meter
Buntsandstein über der heutigen Oberfläche, so dass wir hier das
Unterste eines Ausbruches sehen können. Alle anderen Spuren des
Ausbruches sind weg erodiert worden. Daher ist es nicht möglich,
eine Aussage zu einem Vulkan zu machen. Es ist auch möglich, dass
es nur einen Ausbruchstrichter gab, den wir heute als Maar
bezeichnen würden.
Es handelt sich bei dem Vorkommen in dem kleinen Seitental der
Rückersbacher Schlucht um die einzigen dieser hellen Gesteinsart
im Spessart (und auch in Bayern - in der hessischen Rhön liegen
die nächsten Vorkommen). Das graue, unscheinbare Ergussgestein
steckt in metamorphen Gesteinen, die hier als recht harte
Staurolith-Gneise vorliegen. Für das Gestein aus der Rückersbacher
Schlucht wurde ein Kalium-Argon-Alter von 55 Millionen Jahren
ermittelt (LIPPOLT et al. 1975).

Im Bild oben sind drei verschiedene Phonolith-Stücke abgebildet
Bildbreite ca. 25 cm:
- Das in der Mitte zeigt die Oberfläche im Bruch ohne dass man
bei dieser Auflösung einzelne Minerale erkennen kann. In der
Mitte der bruchrauhen Fläche sitzt ein briefkuvertförmiger,
honigfarbener Titanit-Kristall (bei der Auflösung nicht
erkennbar)
- Das angeschliffen und polierte Stück links aus frischem
Gestein lässt die typischen, bis zu 4 mm großen, farblosen
Sanidin-Einsprenglinge mit einem weißen Saum hervortreten
(porphyrisches Gefüge). Auch erkennt man die parallel
verlaufenden Klüfte, die eine leicht Spaltung des Gesteins
ermöglicht. Die im Steinbruch liegenden Gesteinsbrocken sind
außen hellgrau und zeigen die frische Natur des Felsens erst
nach dem Anschlagen.
- Das angeschliffen und polierte Stück rechts ist randlich
bereits erheblich angewittert und die Verwitterung schreitet gut
sichtbar entlang der Klüfte in das Gestein vor. An diesem Stück
erkennt man wenige, dunkle Einschlüsse aus Ägirin und etwas Erz.
An dem Stück erkennt man das Prinzip der Verwitterung solcher
Massengesteine. Das Wasser beginnt an den kaum erkennbaren
Rissen und zersetzt das Gestein in weiße Tonminerale. Übrig
bleiben die Kerne, meist als rundliche Reste. Je nach dem
Abstand der Klüfte sind die Stücke dann unterschiedlich groß. Je
kleiner das Kluftnetz, umso schneller schreitet die Verwitterung
voran. Im Falle eines weitmaschigen Kluftnetzes bleiben größere
Brocken übrig und diese zeigen dann rundliche Formen. Wenn die
tonigen Zersatzmassen weggeführt werden bleiben die (großen)
Steine übrig. In vielen Fällen entstehen so die Blockmeere.

Angeschliffen und poliertes Stück Phonolith mit der beginnenden
Verwitterung entlang der Risse von links,
Bildbreite 11 cm.

Alterierter Gneis-Xenolith mit einem braun-schwarzen Hof aus
Eisen-
und Manganoxiden im Phonolith. Solche Einschlüsse sind sehr
selten,
weil es nur wenige Flächen des Gesteins zu sehen gibt;
Bildbreite 9 cm.
In der Rückersbacher Schlucht konnte bei der geologischen
Kartierung ein weiteres Vorkommen aus einem weißlich verwitterten
Phonolith aufgefunden werden. Dies liegt im Bereich eines
Forstweges und ist heute kaum mehr als solches erkennbar.
Petrographie:
Ausführliche Beschreibungen der Petrographie des Phonoliths
von Kleinostheim finden sich in der Literatur bei WEINELT,
SCHMEER & WILD (1965:321ff), OKRUSCH, STREIT &
WEINELT (1967:123ff) und bei MATTHES & OKRUSCH
(1965:82ff)):
Das Gestein besteht aus einer sehr feinkörnigen Grundmasse
(aus Feldspäten) mit Einsprenglingen. Dem bloßen Auge
auffallend sind dabei die bis zu 4 mm große
Sanidin-Einsprenglinge. Weiter wurden im Dünnschliff
nachgewiesen: Hauyn, Ägirinaugit, Ägirin, Apatit,
Erzmineralien und Titanit. Der im frischen Zustand sehr
harte Phonolith verwittert zu einer weißlichen Masse und
auch die heute noch im Wald herumliegenden Steine sind mit
einer hellgrauen oder weißen Kruste überzogen.
Bilder von Dünnschliffen:

Heller, großer Sanidin-Kristalle und ein zonierter
Ägirin-Augit (oben rechts) als auffällige Bestandteile mit
Hauyn, Gesteinsglas und etwas Erz in der
Grundmasse des Phonoliths; Dünnschlifffoto unter
polarisiertem Licht bei gekreuzten Polarisatoren,
Bildbreite 7 mm
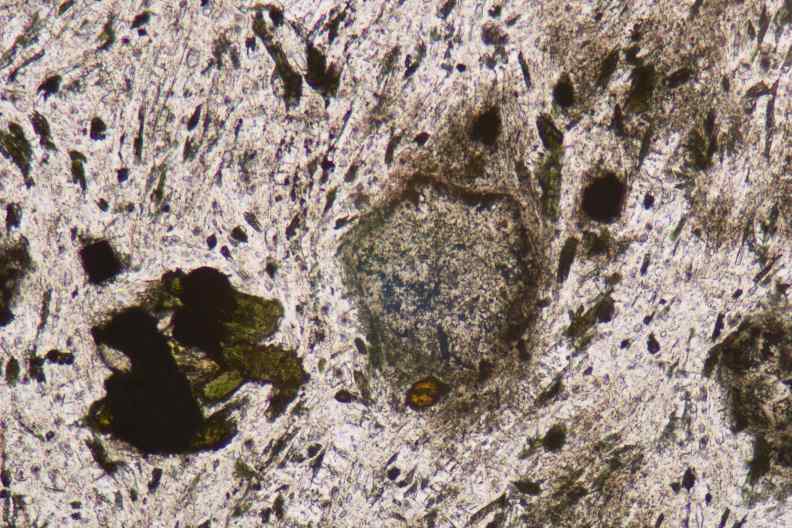
Alterierter Hauyn-Kristall in der hauptsächlich aus Sanidin,
Augit, Erz
und Gesteinsglas bestehenden Grundmasse des Phonoliths,
linear
polarisiertes Licht,
Bildbreite 1,25 mm

Verzwillingter Titanit-Kristall, der in einen Sanidin ragt,
Dünnschliff,
gekreuzte Polarisatoren;
Bildbreite 1,25 mm
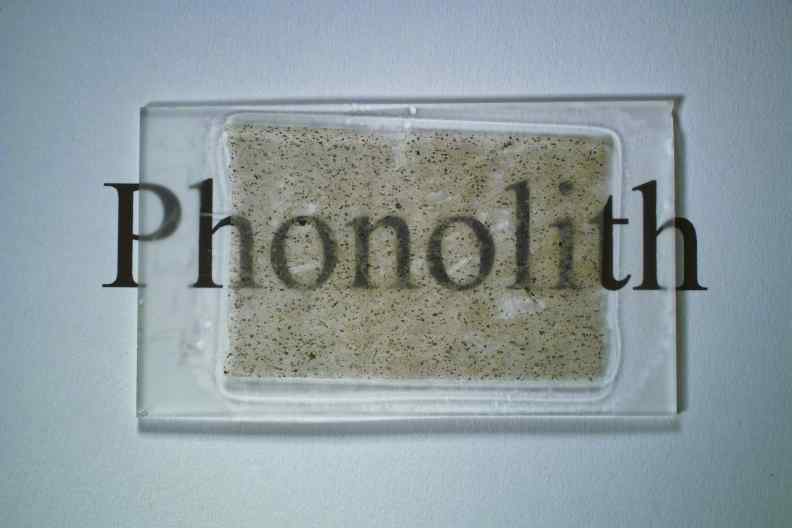
So sieht ein Dünnschliff des Phonoliths aus:
Ein unverwittertes und rissfreies Stück des Phonoliths aus
der Rückersbacher Schlucht wurde herausgesägt und dann bis
auf eine Dicke von 30 (±1) µm (des Durchmessers eines
Menschenhaars am Kopf) geschliffen und poliert - und mit
einem dauerhaften Kleber auf eine Glasplatte mit dem Maßen
48 x 28 mm bei 1,25 mm Dicke geklebt. Dann sind die meisten
Gesteine durchsichtig und man kann diesen Schliff mit einem
speziellen (Polarisations-)Mikroskop anschauen, in dem man
im Durchlicht polarisiertes Licht verwendet. Die dabei
sichtbaren Beugungen des Lichts (Interferenzen) an den
Mineralkörnern können als diagnostisches Merkmal verwandt
werden, so dass ein geübter Fachmann sehr viele
Eigenschaften herauslesen kann. Darüber hinaus auch die
Reihenfolge der gebildeten Mineralien in einem Gestein.
|
Chemische Zusammensetzung des Phonlithes der Rückersbacher
Schlucht
| Oxide: |
Gew.-%: |
| SiO2 |
56,82 |
| Al2O3 |
21,09 |
| Na2O |
8,51 |
| K2O |
5,72 |
| CaO |
1,95 |
| Fe2O3 |
1,81 |
| H2O |
1,64 |
| FeO |
1,29 |
| Cl2 |
0,35 |
| TiO2 |
0,21 |
| SO3 |
0,18 |
| MnO |
0,14 |
| P2O5 |
0,08 |
| MgO |
0,05 |
Der relativ hohe Gehalt an Kalium führte bereits im frühen 20.
Jahrhundert zur Überlegung, solche Phonolithe zu mahlen und das
Mehl als Dünger in der Landwirtschaft zu verwenden (BLANCK et al.
1911). Weitere technische Daten zu dem Gestein finden sich bei
WEINIG et al. 1984:90.

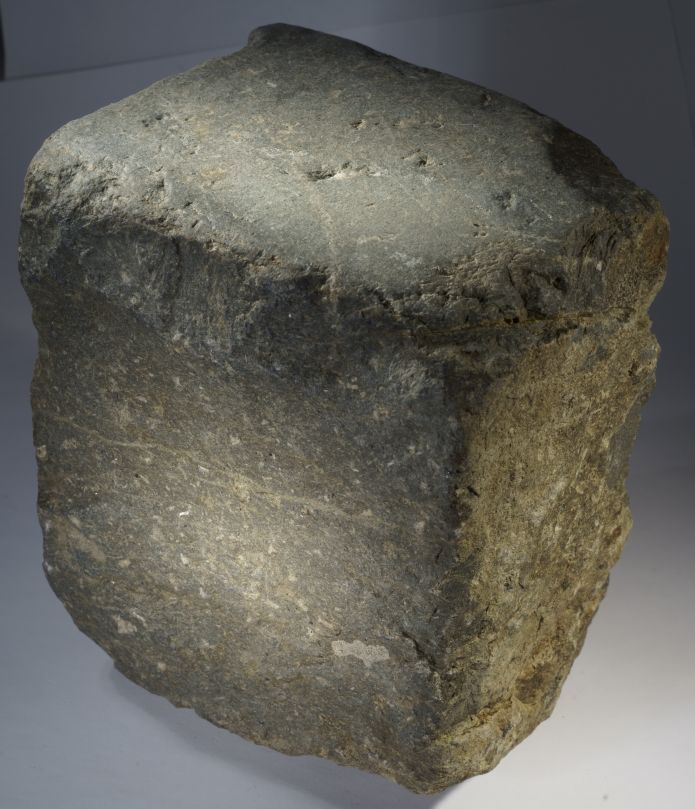
Links: Das Kopfsteinpflaster am Rand der Bayernstraße in
Kleinostheim besteht aus einem hellen, gesprenkelten
Phonolith, durchmischt von dunklen Basalten. Länge des
Geologenhammers 32,5 cm;
aufgenommen am 26.01.2025.
Rechts: Fachgerecht zurecht geschlagener, 4,66 kg schwerer
Pflasterstein aus dem Phonolith von Kleinostheim
(16,5 cm hoch, 14 cm lang und 10 cm breit). Der Stein war sicher
lange in einer Straßen eingelassen, denn die
Oberseite ist durch Fahrzeuge glatt geschliffen (zur Verfügung
gestellt vom Bauhof der Gemeinde Kleinostheim
unter Ralf GROHM);
Bildbreite 16 cm.
Gerölle des Phonolithes finden sich sehr selten in den Schottern
des Maines, die zwischen Kleinostheim und Kahl in Kiesgruben
zugänglich sind. Große Blöcke des auffällgen Gesteins wurden im
Pleistozän mittels Treibeis des Maines verdriftet. Ein solcher,
ca. 2 t schwerer, gut gerundeter Block mit der typischen weißen
Verwitterungsrinde fand sich ca. 1987 in der Kiesgrube VOLZ in
Kahl am Main und wurde von hier zur Gartengestaltung nach
Dettingen an das Anglerheim neben dem Fußballplatz gebracht.

An dem efeuüberrankten Block wurde eine Tafel der verstorbenen
Mitglieder angebracht. Inzwischen hatte der Efeu den Block ganz
überwachsen, so dass man ihn nicht mehr sehen konnte,
aufgenommen am 11.12.2003
In der älteren geologischen Literatur wird ein weiteres Vorkommen
im Lindigwald aufgeführt, welches später nicht mehr aufgefunden
werden konnte (KITTEL 1840:19). Es handelt sich um ein so kleines
Vorkommen, dass es dem Abbau so weit zum Opfer fiel, bis man das
Grundwasser erreichte. Der Steinbruch verfiel und wurde
zugeschüttet und überbaut. Nach meinem Kenntnisstand gibt es auch
in den öffentlichen Sammlungen nur ein Belegstück im
Naturkundemuseum in Berlin.

Bruchstück des Phonoliths von dem Driftblock am Anglerheim;
Bildbreite 8 cm.
Im Herbst 2024 wurde das Anglerheim erweitert. Der Driftblock
wurde weggehoben und zerbrach leider in mehrere Teile, was eine
Probennahme an dem sehr spröden Gestein ermöglichte. Der Block hat
weitere Risse und kann nicht mehr zusammen gesetzt werden. Das
Gestein ist so stark von trennenden Klüften durchzogen, dass es
kaum gelingt, an frische Bruchflächen zu gelangen. Das Gestein ist
sehr kleinkönig, so dass man kaum einzelne Komponenten erkennen
kann. Die chemische Analyse zeigte, dass der visuelle Ansprache
korrekt ist. Der Fels stammt aus dem Lindig Kleinostheims.

Das größte Stück des Steins ist vom Bauhof der Gemeinde Karlstein
(Dank an David
STRANSKY und Florian KNERR) an das Museum
in Karlstein transportiert worden. Die weiße Fläche ist eine
Kluft, in
der das Gestein dünn weißlich verwittert ist. Der Geologenhammer
als Maßstab ist 40 cm lang;
aufgenommen am 19.03.2025.
Durch die weiteren Forschungen ist inzwischen herausgefunden
worden, dass es in Kleinostheim mindestens unterschiedliche 3
Phonolith-Vorkommen gibt. Das seit mehr als 100 Jahren
verschollene Vorkommen befindet sich im Lindig unter der Waldstadt
und dieses Vorkommen ist die natürliche Quelle für den Stein vor
dem Museum in Dettingen. Der wurde als Eisdriftblock über etwa 6
km verlagert.
Die Überraschung im November 2025!

Etwa 1 t schwerer Eisdriftblock eines Phonoliths: die hellen
Kluftflächen
zeigen, dass der Fels vor dem Freilegen größer war; gefunden bei
den
Bauarbeiten desKreisels an der A45 im Industriegebiet Alzenau Süd.
Das Gestein stammt aus dem Vorkommen unter der Waldstadt bei
Kleinostheim. Länge des Geologenhammers 40 cm;
aufgenommen am 27.11.2025
Mineralien:
Das im Spessart ungewöhnliche Ergussgestein weist kaum sichtbare
und sammelwürdige Mineralien auf. Das sehr dichte Gestein enthält
außerdem überhaupt keine Drusen. Infolge der sehr schlechten
Aufschluss-Situation sind kaum Felsen zu sehen bzw. zu finden. Man
kann nur einzelne Lesesteine des bemerkenswerten Gesteins auf dem
Zufahrtsweg und in den alten Steinbrüchen auflesen.
Literatur:
BLANCK, E., FLÜGEL, M & PFEIFFER, TH. (1911): Die Bedeutung
des Phonoliths als Kalidüngemittel.- Mitteilungen der
Landwirtschaftlichen Institute des Königl. Universität Breslau VI.
Band, Heft 2, S. 233 – 272, ohne Abb., Tab., [Verlagsbuchhandlung
Paul Parey] Berlin.
GÜMBEL, C. W. (1866): Die geognostischen Verhältnisse des
fränkischen Triasgebietes.- Bavaria. Landes- und Volkskunde des
Königreichs Bayern, Band 4, I. Abtheilung: Unterfranken und
Aschaffenburg, S. 3 - 77, [Literarisch-artistische Anstalt d.
Gotta´schen Buchandlung] München.
HOFBAUER, G. (2016): Vulkane in Deutschland.- 224 S., zahlreiche
farb. Abb. und Karten, Zeichnungen und Fotos [Wissenschaftliche
Buchgesellschaft] Darmstadt.
KITTEL, M. B. (1839/1840): Skizze der geognostischen Verhältnisse
der Umgegend Aschaffenburgs.- Programm des Königl. Bayerischen
Lyceums zu Aschaffenburg für 1838 in 1839 63 S., zweite und letze
Abtheilung, 1839 in 1840, 23 S., 1 handcolorierte geologische
Karte und eine Tafel mit farb. Profilen im Anhang, [Wailandt´sche
Druckerei] Aschaffenburg.
KLEINSCHMIDT, G. [Hrsg.] (2021): The Geology of the Antarctic
Continent.- Beiträge zur regionalen Geologie der Erde 33,
613 p., 194 figs., 10 tab., [Borntraeger Science Publishers]
Stuttgart.
LIPPOLT, H. J., BARANYI, I. & TODT, W. (1975): Die
Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen
Oberrheingrabens.- Aufschluss Sonderband 27, S. 205 - 212,
2 Abb., Heidelberg.
LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte
Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 19, 3 Abb..- in Karlsteiner
Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom
Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 667ff.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, S. 82 - 84, Berlin.
OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen
zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- S.
123 ff., München 1967.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
WEGNER, G. (1975): Kleinostheim Dokumente und Beiträge zu seiner
Geschichte. - 285 S., 58 Abb., Hrsg. von der Gemeinde
Kleinostheim, [Stock & Körber] Aschaffenburg.
WEINELT, W., SCHMEER, D. & WILD, A. (1965): Durchbrüche
jungtertiärer Vulkanite im westlichen kristallinen Vorspessart.-
in Geologica Bavarica 55 Geologica Bavarica Varia, S. 317
- 340, 18 Abb., Bayer. Geolgisches Landesamt, München.
WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN, W., STREIT, R. &
WEINELT, W. (1984): Oberflächennahe mineralische Rohstoffe von
Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der Steine und
Erden.- Geologica Bavarica 86, S. 90 - 91, [Bayerisches
Geologisches Landesamt] München.
Hinweis:
Das Bachbett des Rückersbachs im unteren Teil der Schlucht
ist mit dem hier fremden Diorit aus Dörrmorsbach ausgebaut
worden. Auch das Schlammbecken und die Wege dorthin sind mit dem
Schotter belegt, so dass man hier völlig fremde Gesteine finden
kann.

Nach der Wanderung in die Schlucht bietet sich die Einkehr in den
Schluchtof (Speisegaststätte mit Biergarten) an;
aufgenommen am 16.02.2014
Der wohl schönste Phonolith der Welt:
Devils
Tower, Wyoming, USA:
Der Berg befindet sich - touristisch
recht abgelegen - im Nordosten von Wyoming in den USA. Der Felsen
und die Umgebung ist in einem National Monument seit 1906 geschützt.
Das der Verwitterung widerstehende, vukanische Gestein erstarrte vor
etwa 50 Millionen Jahren (Eozän) und steckt in weichen mesozoischen
Sedimentgesteinen, die leichter abgetragen wurden als der Phonolith.
Der ebene Gipfel wurde erst im späten 19. Jahrhundert erstmals durch
einen Bergsteiger betreten; man fand keine Rest einer früheren
Besteigung durch Indianer. Der Aufstieg ist nur für sehr versierte
Kletterer möglich.
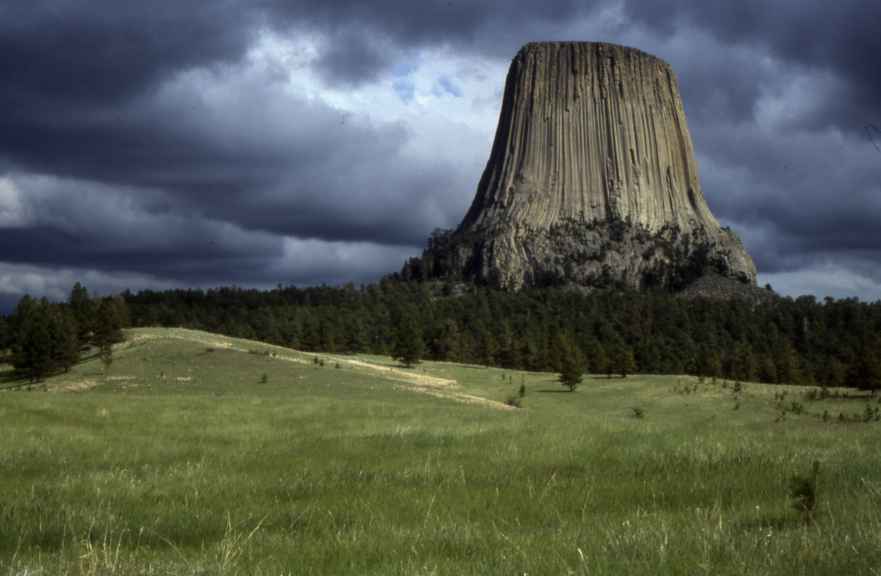
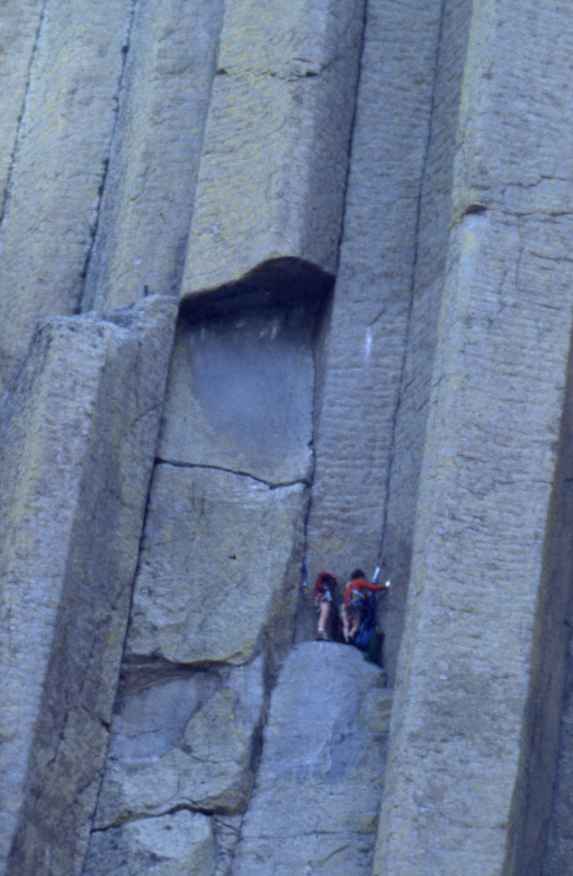
Aus einer großen Ebene ragt der aus einem säulenförmigen Phonolith
bestehende Devils Tower etwa 265 m über die Umgebung auf. Der
Durchmesser des markanten
Berges beträgt 150 m. Die einzelnen Säulen sind so groß, dass mind.
3 Menschen darauf Platz finden (siehe die Kletterer im Bild rechts;
diese versuchen, entlang des
Risses, der durch die Trennfläche der Säulen entstand, auf den
Felsen zu klettern).
Die Fotos stammen vom Besuch des Gebietes am 31.05.1981.
Teneriffa, Kanarische Inseln
(Spanien):
Auch auf der bekannten Ferieninsel findet sich Phonolith in der
Form von Laven und Dykes (Gänge) in der Form von blasenreichen
oder dichten vulkanischen Gesteinen; dies ist aber im Handstück
kaum zu erkennen. Ein schönes Beispiel ist der 3.718 m hohe und
noch aktive Vulkan Pico del Teide, der in seiner Calcera
großflächige Lavafelder aus phonolithischer Lava besitzt.


Phonolithische Gesteine der Roques de Garcia, links als
porphyrische Lava und recht als frei erodierter, etwa 200 m
hoher Lagergang des Felsens La Catedral (man beachte die 3
Kletterer als schwarze "Punkte" in der Bildmitte),
aufgenommen am 09.04.2011
Katzenbuckel, südlicher
Odenwald:
Selbst in der näheren Umgebung kommen phonolithische Gesteine vor
(siehe Liste oben). Das nächste Vorkommen ist der mit 626 m
höchste Berg bzw. ehemaliger Vulkan Katzenbuckel (626 m) im
südlichen Odenwald (bei Waldkatzenbach nahe am Neckar, in
Baden-Würtemberg) mit einem Sanidin-Nephelinit, der eine
phonolithische Zusammensetzung besitzt. Die großen
Nephelin-Kristalle treten insbesondere im angewitterten Zustand
hervor. Der am Berg liegende und bis 1974 aktive Steinbruch ist
durch das Vorkommen eines Na-Shonkinits und durch schöne
Mineralien berühmt; darunter auch Freudenbergit. Das Gestein wurde
auf ein Alter von 65 oder 70 Millionen Jahre datiert.

Phonolit mit einem porphyrischen Gefüge aus dem Steinbruch am
Katzenbuckel
bei Waldkatzenbach im südlichen Odenwald. Die großen,
angewitterten Nephelin-
Kristalle sind im Bild nur schlecht erkennbar, Slg. Martin
SCHUSTER,
Bildbreite 10 cm
Burgberg bei Heldburg,
Thüringen:
Im fränkisch-thüringischen Grenzraum sind etwa 200 vulkanische
Gesteinsvorkommen bekannt, die etwa rheinisch streichen. Nach dem
Vorkommen bei Heldburg werden diese als Heldburger Gangschar
zusammen gefasst. Es handelt sich meist um Basalte, die gangförmig
eingeschaltet sind. Unter der eindrucksvollen Burg der Veste
Heldburg (405 m) befindet sich ein Phonolith-Vorkommen, welches
durch einen Steinbruch mit einer Geotop-Tafel erschlossen ist. Das
helle Gestein wurde auf ein Alter von etwa 11 Millionen Jahre
datiert. Der grünlich-graue Phonolith ist felsitisch aufgebildet,
auf den frischen Bruchflächen wachsglänzend und enthält als
Einsprenglinge kleine Pyroxene, Amphibole, Nephelin,
Glimmerblättchen und Sodalit. Die Klüfte sind weißlich
angewittert.


Links: Anstehender Phonolit mit der typischen weißlichen
Verwitterung in einem kleinen, aufgelassenen Steinbruch an der
Auffahrt zur Veste Heldburg.
Vor der Felswand steht einen Informationstafel, die das Gestein
beschreibt,
aufgenommen am 25.02.2017
Rechts:
Der von einer weißen Verwitterungsrinde umgebene, schlierige
Phonolith von der Heldburg angeschliffen, so dass man die dunklen
Bestandteile erkennen
kann.
Bildbreite 16 cm
Hammerunterwiesentahl, Erzgebirge:

Weiße Natrolith-Kristalle aus Auskleidung eines Hohlraumes
(ehemalige
Gasblase) im Phonolith des Steinrbuchs bei Hammerunterwiesentahl
im
Erzgebirge,
Bildbreite 13 cm
Milseburg, Rhön:

Nephelin-Nosean-Phonolith von der 835 m hohen Milseburg in der
Rhön.
Für die Erstarrung wird ein tertiäres Alter postuliert (ein
radiometrisches
Alter steht aus),
Bildbreite 13 cm
Brenk, Eifel:

Der porphyrische Alkali-Phonolith vom Schellkopf bei Brenk in der
Eifel. Bei den dunklen Einschlüssen handelt es sich um den
seltenen
Nosean (Na8[SO4/(AlSiO4)6]),
ein typisches Mineral in Alkaligesteinen.
Bildbreite 8 cm
Das Gestein wird von der AG für Steinindustrie abgebaut und findet
in
der Keramik-Industrie, wie auch beim Schweißen, in der
Stahlherstellung
und als Dünger Verwendung.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite