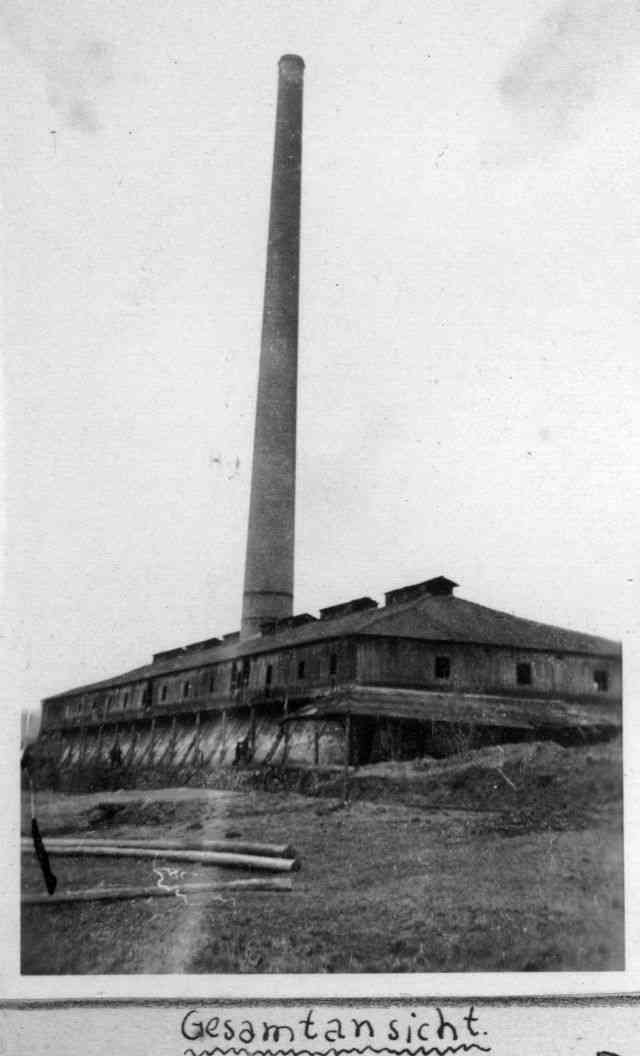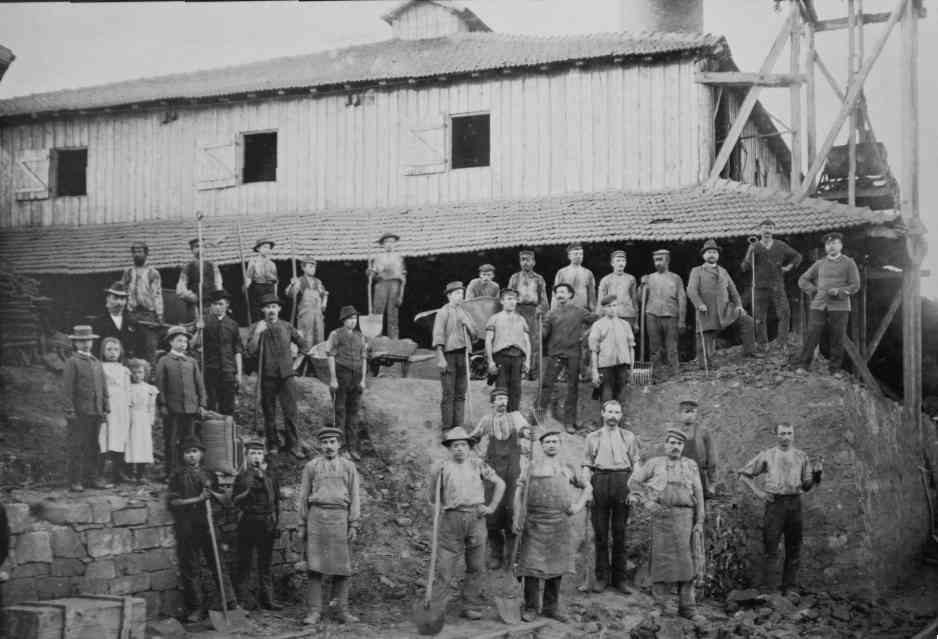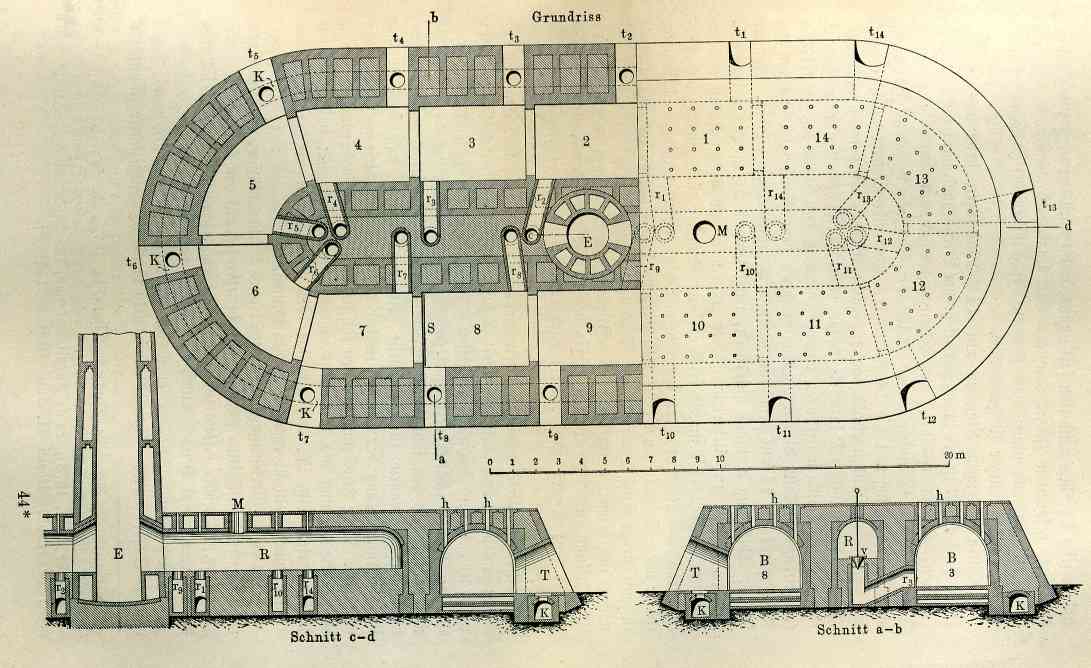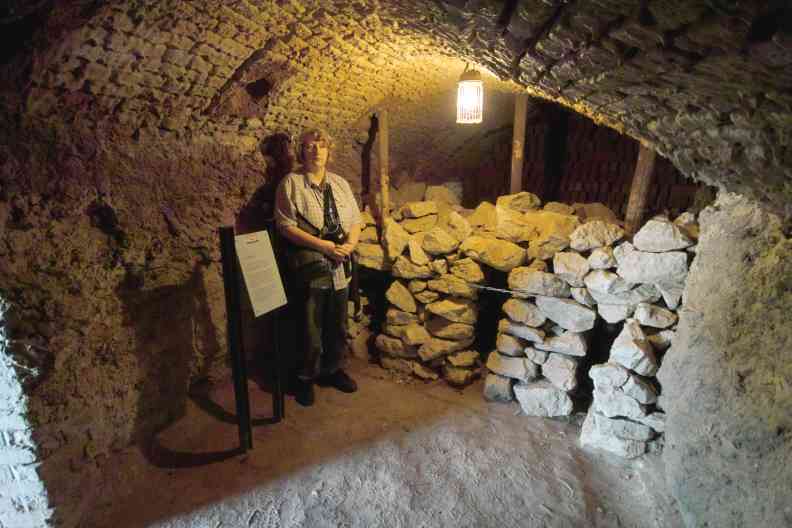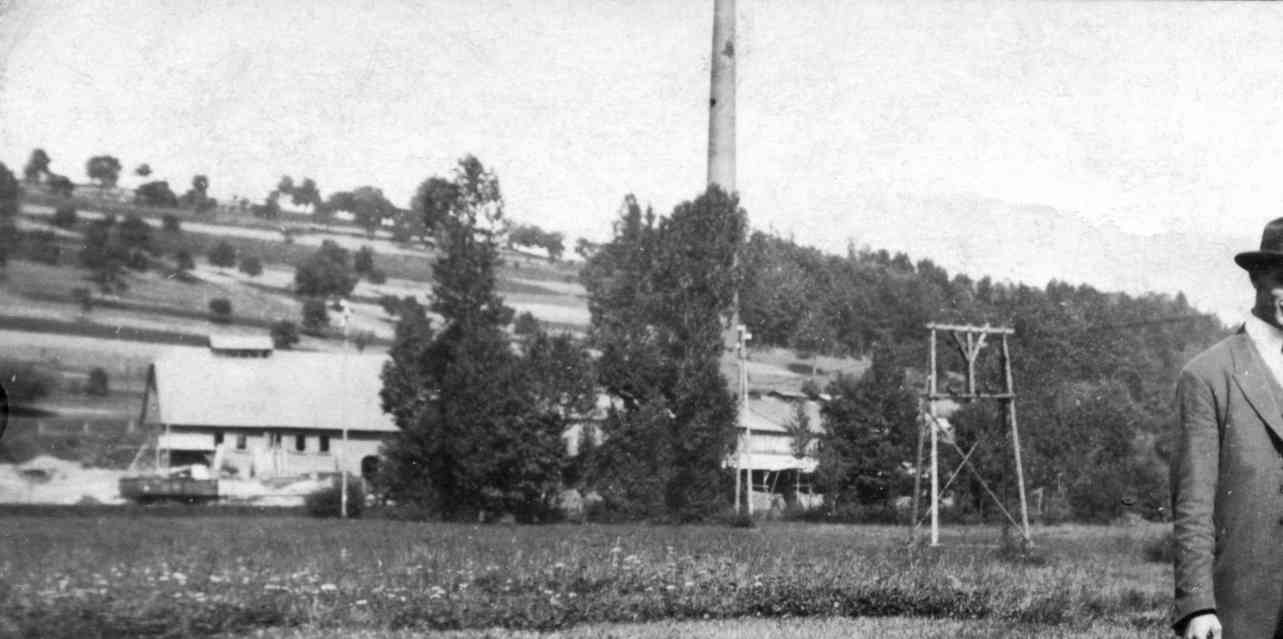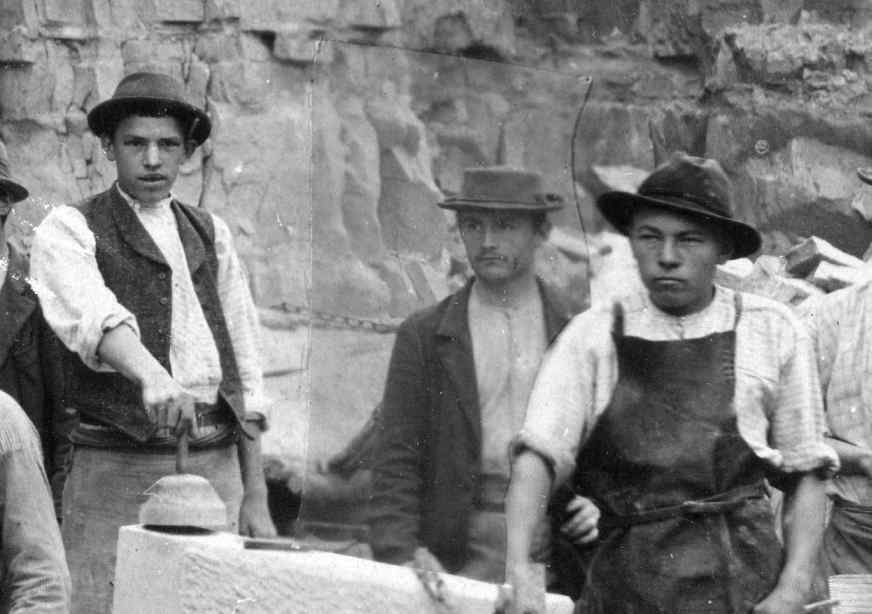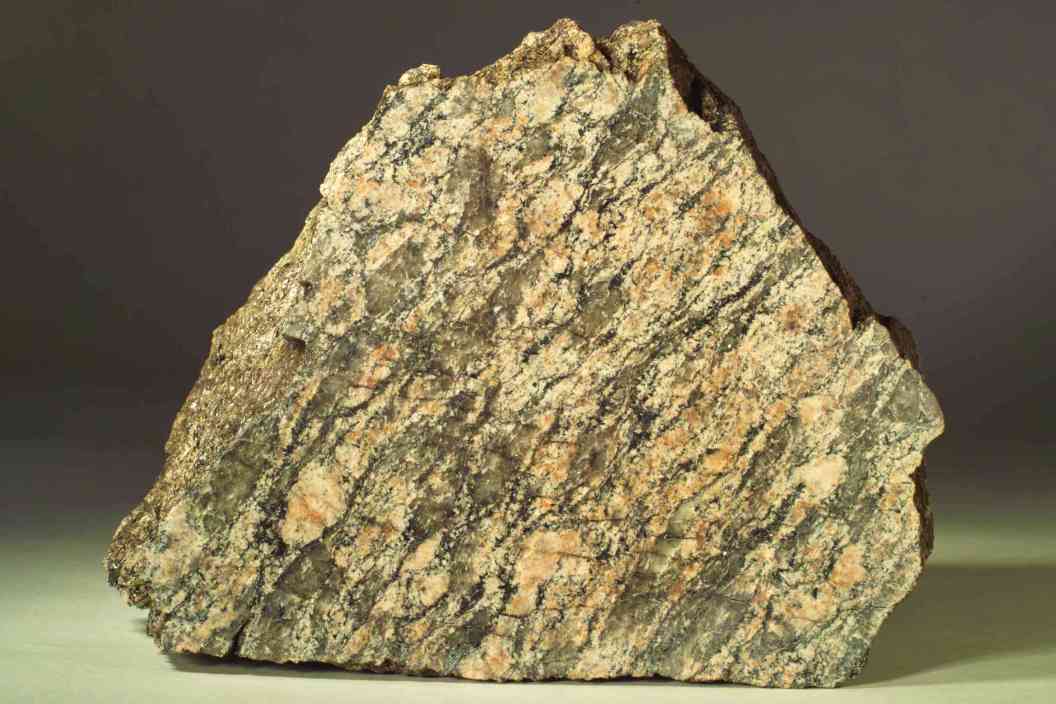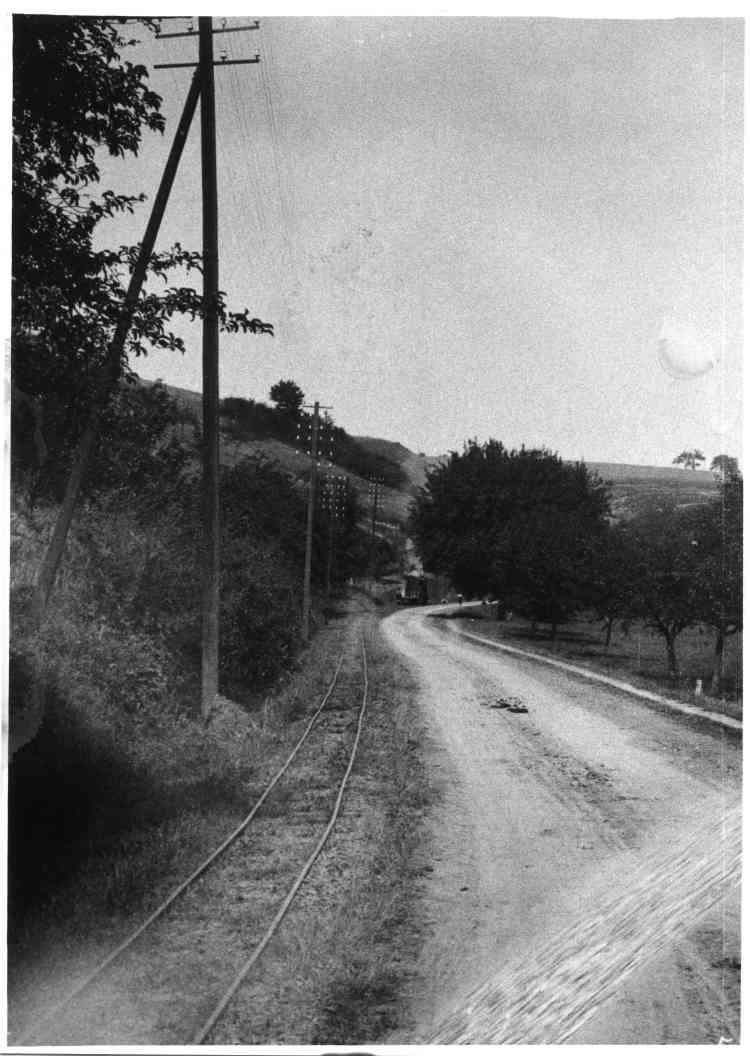Blankenbach
& Eichenberg
im Spessart -
bekannt durch den weißen Sandstein,
verbunden durch den Kalk und über eine Seilbahn.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Eröffnung des Kulturrundweges
Blankenbach-Eichenberg am 10.10.2009
mit den Bürgermeistern MÜLLER und DÜMIG, dem Landrat Dr.
Ulrich REUTER
und Dr. Gerrit HIMMELSBACH von Archäologischen Spessartprojekt
im Hof
des Hotel Brennbaus Behl, Blankenbach.
In Blankenbach gab es ein Kalkwerk. Der Kalk
(eigentlich ein Dolomit) wurde aus Eichenberg und später auch
Sommerkahl mit einer Seilbahn angeliefert. Am Dicksbusch gibt
es einen Steinbruch im Muskovit-Biotit-Gneis. In Eichenberg
gab es darüber hinaus noch eine Ziegelei und es gibt dort noch
den weißen Steinbruch. Weiter wurden Manganerze und Schwerspat
abgebaut.
All diese Besonderheiten sind durch den 72. Kulturweg
"Apfelwein und Weißer Stein" erschlossen, der am 10.10.2009
eröffnet wurde.
- Das Kalkwerk in Blankenbach.
Mit der Erschließung des Kahlgrundes durch die
Kahlgrundbahn wurden Transportkosten erheblich reduziert. Dies
führte zum Bau eines Kalkwerkes in Blankenbach 1899,
unmittelbar angrenzend an den heutigen Parkplatz des Hotel
Brennhaus Behl.
In dem riesigen Kalkofen wurde der "Kalk" (in Wirklichkeit ein
Dolomit, also ein Magnesium-haltiger Kalk) aus Eichenberg und
später auch aus Sommerkahl gebrannt. Der über eine
Materialseilbahn angelieferte Dolomit zunächst gebrochen und
dann in den Ringofen zu Branntkalk gebrannt.
Der Hoffmann´sche Doppel-Ringofen besteht aus einer
ringförmigen Brennzone aus 28 aneinander grenzenden
Brennkammern mit Zugängen von Außen (bogenförmigen Öffnungen);
darüber befand sich ein hölzerner Überbau und Dach zum Schutz
des Heizers und dem Einfüllen der Kohle. In diesen Ofen wurde
der Kalk mit ca. 20 % Steinkohle aufgeschichtet. Das Feuer
brannte derweil in der Brennzone, während im abgebrannten und
abgekühlten Teil der gebrannte Kalk ausgeräumt wurde, nachdem
man die Zugänge aufgebrochen hatte. Dahinter wurde wieder neu
zugestellt, die Öffnung wieder zugemauert und so lief der
Prozess immer fortlaufend durch die Kammern bzw. den
ringförmigen Brennraum. Die Brennleistung eines solchen Ofens
war ca. 10 mal größer als der eines einfachen Schachtofens.
Die Arbeitsbedingungen in dem Ofen waren sicher nicht
gesundheitsfördernd, denn Abgase, Staub und die Restwärme
machten das Arbeiten in und um den Ofen schwer. 1907 wurde
neben dem Wohnhaus in Blankenbach ein Brausebad für die
Arbeiter erbaut. Nachdem man den gebrannten Dolomit ausgeräumt
hatte, wurde der in einer Kugelmühlenanlage gemahlen, verpackt
und als Branntkalk verkauft. Infolge der relativ hohen Eisen-
und Mangangehalte war der "Kalk" nicht weiß, sondern
dunkelgrau. Er wurde vorwiegend zur Herstellung von Mörtel zum
Mauern verwandt; geringe Anteile gingen in die Landwirtschaft,
Gerbereien, in die Stahl- und Zuckerfabrikation. Das Kalkwerk
besaß eine Anlage, in der der gemahlene Kalk in Säcke
abgefüllt wurde. Die Jahres-Produktion lag bei ca. 1.400
gedeckten Waggons der Bahn. 50 kg Kalk kosteten um 1900 ca.
1,25 Reichsmark. 1904 wurd mit den (Schwarz-)Kalkwerken
Aschaffenburg AG ein Verkaufsvertrag geschlossen, der den
Absatz sichern sollte.
Gestiegene Kohlenpreise und die Konkurrenz wurden die Preise
gedrückt. Das Kalkwerk wurde auch durch einen langen Streik
bekannt. Infolge einer Absatzkrise arbeiteten 1920 nur noch
wenige Menschen im Kalkwerk. 1934 wurde Konkurs angemeldet und
die letzten Anlagen 1942 abgebrochen und der Kamin gesprengt.
Der einzige Betrieb im Spessart, der bis Ende 2022 noch einen
Kalkofen betrieb, um Dolomit (Kalk) zu brennen, war die Fa.
Hufgard in Rottenberg.
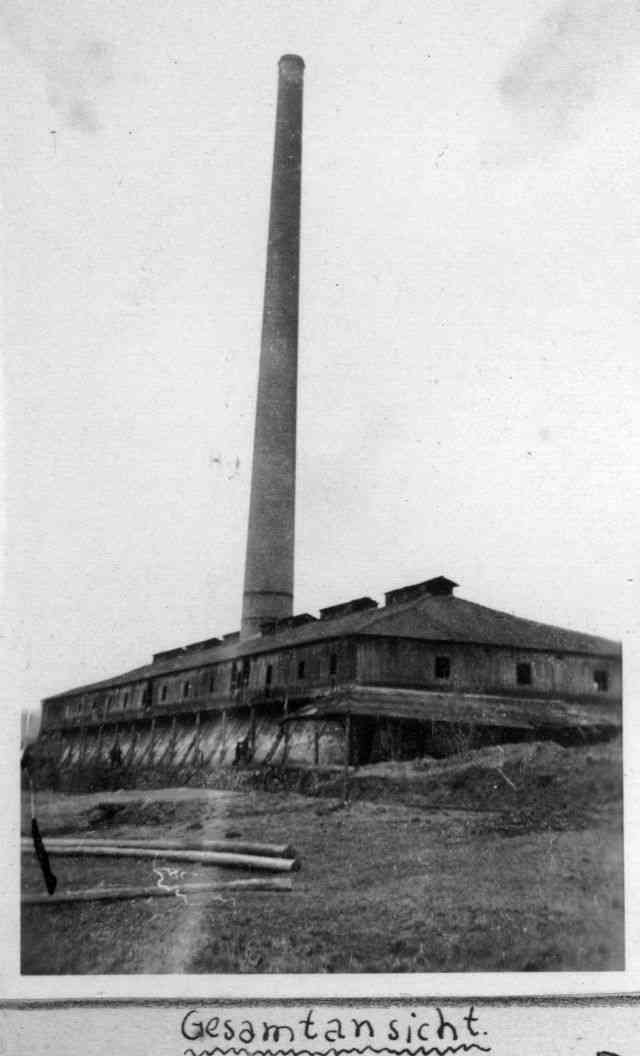
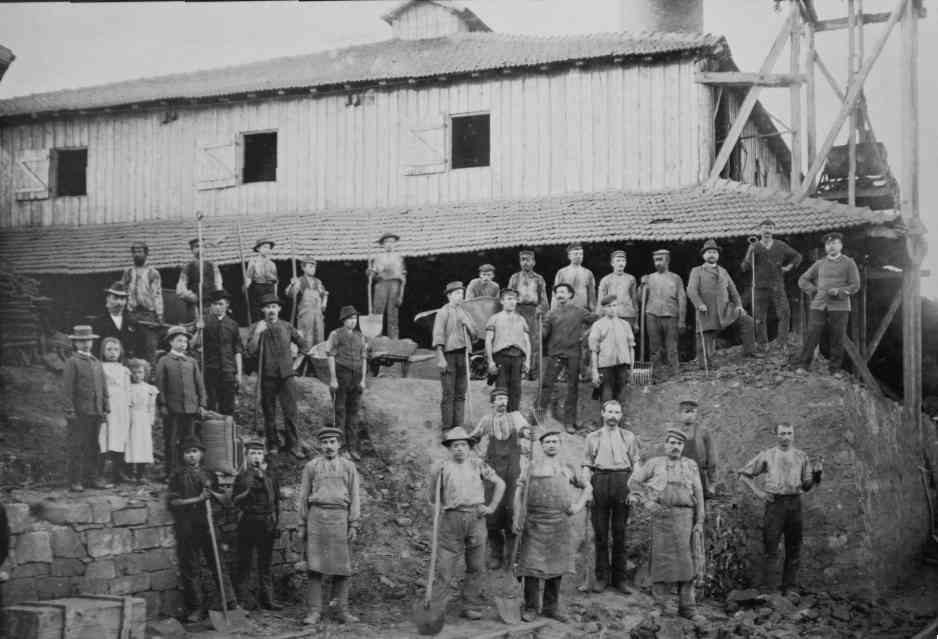
Links, das bereits leer stehende Kalkwerk,
bestehend aus dem Kalkofen mit einem hölzernen Überbau als
Wetterschutz und dem ca. 60 m hohen Abgaskamin vor
dem Abriss vor 1942 (Foto freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Familie HEEG). Rechts, das noch im Betrieb
befindliche Kalkwerk (Südwestecke) mit
Direktor und dem Kalkofen im Hintergrund, rechts erkennt man
den Aufzug der Kohleförderung, die vom Anschlussgleis zu einer
Hängebahn führt, die über dem
Ofen installiert ist. Nicht datiertes Bild aus einer nicht
bekannten Quelle.
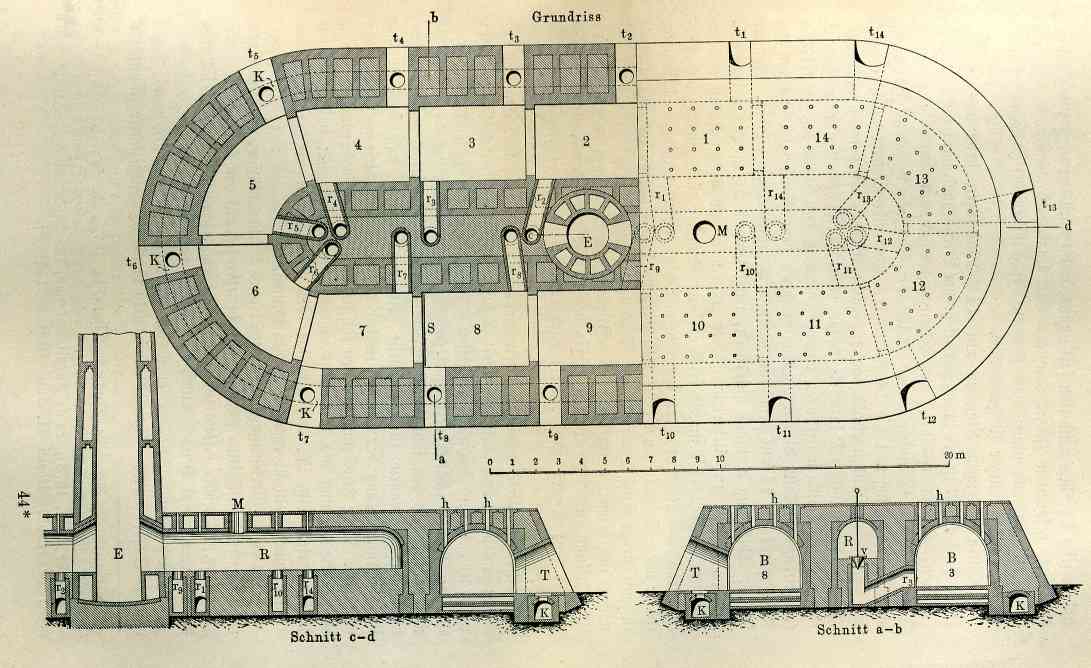
Ein Ringofen mit den 14 Brennkammern, den
Öffnungen und dem zentralen Kamin, wie er in Blankenbach
bestand, als
zeitgenössische, technische Zeichnung im (Halb-)Schnitt (links
in der Brennzone in der Draufsicht, rechts der Blick von oben,
links unten im Querschnitt mit dem Kamin und rechts unten quer
dazu die Brennkammern mit dem Buchstaben B
gekennzeichnet).

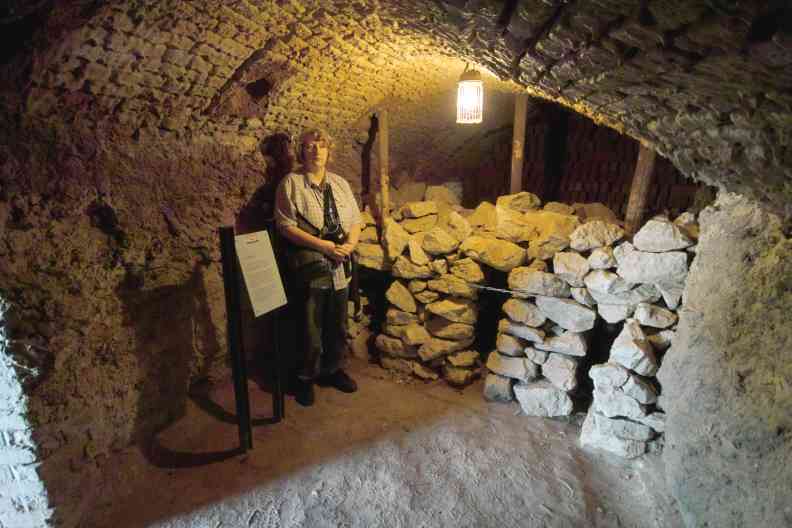
Links: Der Hoffmann´sche Ringofen von ca. 1860
im Kalk- und Ziegelmuseum der Gemeinde Winzer bei Deggendorf,
der bis ca. 1960 im Betrieb war. Er ist aus den
Kristallingesteinen des Bayerischen Waldes erbaut und ist als
zentraler Teil des Museums erhalten geblieben. Die Ofenbühne
ist offen, so dass der Heizer dem Wind ausgesetzt
war. Im Winter wurde kein Ofen betrieben.
Rechts: Ein Bild des Inneren mit den aufgeschichteten
Kalkbrocken und Helga Lorenz als Maßstab. Gegen die Decke
erkennt man die angeschmolzenen Ziegelsteine der
Ausmauerung des Ofens. Die Lücken wurden später mit Kohle
gefüllt;
aufgenommen am 19.09.2009.
- Die Seilbahn.
Zur Herbeischaffung des Dolomites verwandte man eine
Materialseilbahn.
Diese bestand auf 1,65 km Länge bei 114 m Gefälle bis zu der
Stelle, die ca. 300 m weiter reicht, als der heute als
"Winkelstation" bekannte Abzweig (System Otto mit
Selbstkuppelapparten und einer Leistung von 180 t pro Tag. Die
Anlage wurde von der Fa. Pohlig aus Köln geliefert. Es
handelte sich um eine Seilbahn, aus einem stählernen Trag- und
einem separaten Zugseil; das Stahlseil zur Talseite hatte 36
mm Ø und das für die Leerfahrt hatte 25 mm Ø. Die
Spanngewichte waren mit 8.400 und 4.000 kg auf 5fache
Sicherheit ausgelegt. Das Zugseil war 13 mm dick und wurde
über eine 2 m messende, einrillige Seilscheibe in einem
gleitenden Lager angetrieben. Der Antrieb (stationäre Maschine
mit 10 Pferdekräften der Fa. R. Wolff aus Magdeburg-Bucknau)
befand sich am Kalkwerk. Das Tragwerk der 24 Stützen bestand
Holz, die (heute noch vorhandenen) Fundamenten aus Beton. Die
Geschwindigkeit der immer laufenden Seilbahn war mit ca. 0,5 -
1 m/sec klein. Es befanden sich immer 14 Wagen im Seil, von
denen die Hälfte mit Last fahren konnten. Zur Beladung wurde
der Wagen vom Seil genommen und per Hand mit der Schaufel
durchgeführt. Zum Entladen wurden die Wagen vom Seil genommen
und auf Schienen verfahren und durch Kippen im Ofen entleert.
Zur Koordination der Be- und Entladung war ein elektrisches
Läutewerk und Mikrotelephone installiert, so dass sich die
Arbeiter abstimmen konnten.
Von dem Endpunkt bestand bis zum Steinbruch in Eichenberg
ein Gleis für Loren, die von Pferden gezogen wurden. Da dies
auf Dauer nicht rentabel war, verwandte man eine
Dampflokomotive.
Als der Steinbruch 1926 nach Sommerkahl verlegt wurde, baute
man die Seilbahn im 4. Quartal 1925 aus und ca. 100 vor der
Beladestation wurde eine "Winkelstation" erbaut. Das
Gleis auf der Straße wurde abmontiert. Die letzten Reste der
Seilbahn wurden 1936 abgerissen.
Es ist durch Zeitungsberichte überliefert, dass 1909 es zum
Zusammenbruch eines Tragwerkständers kam und später kam es zu
einem Seilriss. so dass 6 Wagen abstürzten.
Mit dem Bau der Winkelstation wurde einerseits die Richtung
geändert, aber auch das Gefälle, so dass im Steinbruch von
Sommerkahl die Beladestation mit einem 800 kg schweren
Spanngewicht für das Zugseil ausgestattet war. Das Tragseil
war im Fels verankert. Über der Straße von Sommerkahl nach
Eichenberg befand sich ein Schutzgerüst gegen herabfallende
Steine. Die Seilbahn wurde um 1.260 m verlängert. Details zur
Winkelstation sind nicht bekannt, da entsprechende Akten nicht
mehr vorhanden sind.
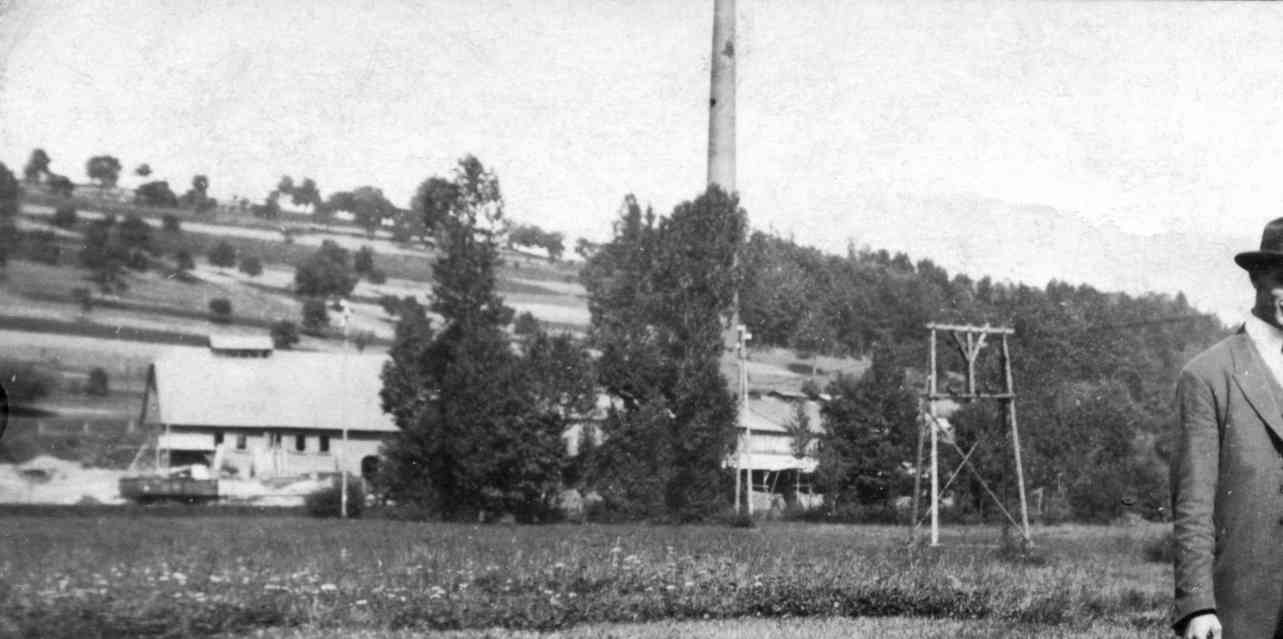
Das noch im Betrieb befindliche Kalkwerk
mit mit der ersten hölzernen Stütze der Seilbahn um 1922,
links ein Eisenbahnwaggon der Kahlgrundbahn,
hinter den Bäumen (dashalb nicht sichtbar) die Halle mit den
Einrichtungen zum Betrieb der Seilbahn (Foto freundlicherweise
zur Verfügung gestellt von
Familie HEEG).
- Der Kalksteinbruch.
Für den Betrieb des Kalkwerkes wurde der Dolomit benötigt.
Der Name Dolomit bezieht sich auf den französischen
Mineralogen und Forschungsreisenden Déodat de DOLOMIEU (*1750
†1801); die bizarr felsigen
Dolomiten in den südlichen Alpen wurden ebenfalls davon
abgeleitet. Dolomite sind im Spessart weit verbreitet und
treten als nahezu horizontale Sedimente zwischen den
Sedimenten des Rotliegenden und dem Buntsandstein in einem 5
bis 40 m mächtigen Gesteinsverband flächig auf. Dieser
entstand vor ca. 255 Millionen Jahren am Grunde des
Zechstein-Meeres. Gegenüber dem normalen Kalkstein ist im
Dolomit die Hälfte des Calciums durch Magnesium ersetzt.
Die ausschließlich händische Gewinnung erfolgte in einem noch
vorhandenen, aber zugewachsenen Steinbruch an der Kuppe. In
dem Kalkwerk und in dem Steinbruch arbeiteten ca. 50 Menschen.
In zeitgenössischen Berrichten werden die Zustände sehr
unterschiedlich beschrieben. Zum Transport des Dolomites in
den Kipploren wurden zunächst Pferde verwandt, 1905 dann einen
Dampflokomotive; diese fuhr auf dem Gleis auf der Straße nach
Blankenbach bis zur Beladestation. Von hier wurden die
Dolomit-Brocken auf die Wagen der Seilbahn verladen, die sie
zum Kalkwerk brachte.
Der 1905 erbaute Lokschuppen ist das noch erhaltene Gebäude
aus Sandstein neben dem einzeln stehenden Wohnhaus mit
Pferde-, Schweine- und Ziegenstall von 1903 neben dem
Steinbruch an der Straße von Blankenbach nach
Eichenberg.
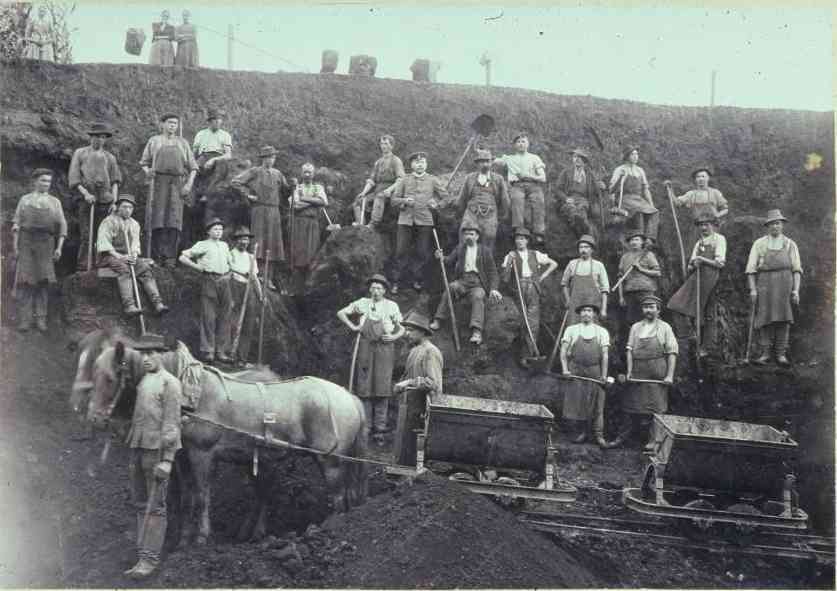

Bild aus den Anfängen des Kalksteinbruches
zwischen Blankenbach und Eichenberg. Dabei wurde der Dolomit
mit den Brechstangen gelockert, in eine handliche Größe
zerkleinert und auf Loren
verladen, die mit Pferden bewegt wurden (um 1900) (Bild
freundlicherwiese zur Verfügung gestellt von Frau Maria
WENZEL, Eichenberg).
Rechts: der gleiche Steinbruch, aber ca. 100 Jahre später,
völlig verwachsen;
aufgenommen am 17.12.2006.
- Der weiße Sandstein.
Die Berge um Eichenberg bestehen aus Sandstein, der hier in
der Trias in einem flachen und weit ausufernden Flusssystem
abgelagert worden ist. Die Schichten des hier anstehenden,
unteren Buntsandsteins sind ca. 251 Millionen Jahre alt.
Normalerweise ist der Sandstein durch einen hauchdünnen
Überzug aus Eisenoxiden und Tonmineralien auf den Sandkörnern
braun, rotbraun oder rot gefärbt. Der größte Teil der
Sandkörner im Sandstein besteht aus Quarz, aber je nach
Herkunft des Sandes können auch Teile aus Glimmermineralien
und Feldspat bestehen. Dies war hier in Eichenberg der Fall.
Hinzu kam, dass es während des Tertiärs deutlich wärmer und
feuchter war als heute. Dies führte zu einer tiefgründigen und
zersetzenden Verwitterung der Feldspäte im Sandstein bei
gleichzeitiger Abfuhr der Eisenoxide. So wurden neue
Tonmineralien (Kaolinit und mit geringen Anteilen Illit)
gebildet, die in der eisenarmen Umgebung den Sandstein weiß
färben. Dies führte einerseits zu einer Änderung der Farbe als
auch zu einer deutlichen Reduzierung der Festigkeit. Dies ist
der Grund für die gute Bearbeitbarkeit beim Abbau und beim
Behauen zu den fertigen Werkstücken. Anderseits verwittern
diese Sandsteine sehr schnell, so dass sich an exponierten
Stellen der daraus errichteten Gebäude umfangreiche
Schadbilder einstellen.
Ein anderer Aspekt ist die gesundheitliche Gefährdung beim
Abbau und Verarbeitung des Sandsteines, bekannt als
"Steinhauerkrankheit", heute Silikose genannt. Dabei schädigt
das jahrelange Einatmen des Quarzfeinstaubes über 0,15 mg/m³
das Lungengewebe. Dies führt zu Atemschwierigkeiten und
schließlich zum Tod; die Silikose ist auch heute noch
unheilbar, tritt aber kaum noch auf, weil solche Stäube heute
abgesaugt und gefiltert werden.

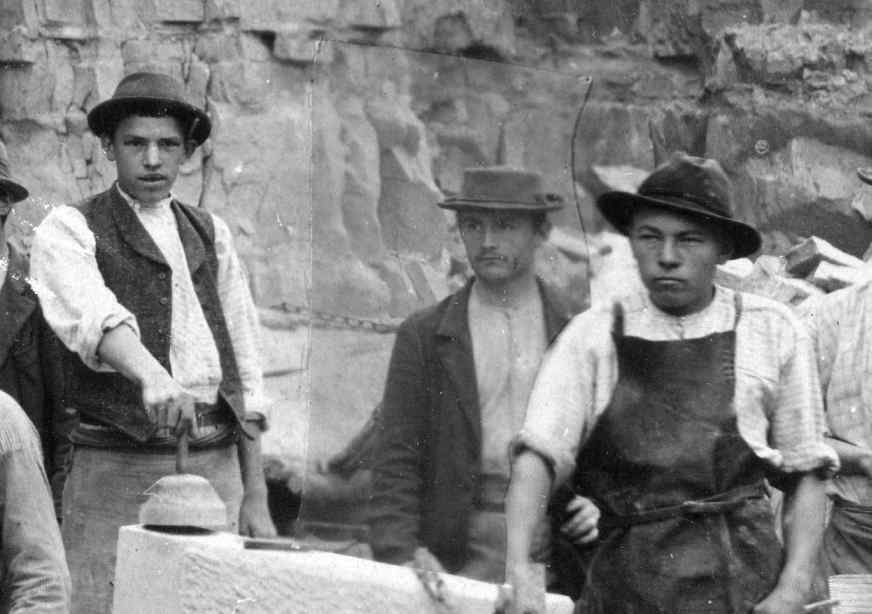
Links:
Bild vom weißen Steinbruch um das Jahr 1900. Darin die von der
Arbeit gezeichneten Gesichter der jungen Männer. Bemerkenswert
ist das nachträgliche Einmontieren eines Mannes, der
wohl am Tage der Aufnahme fehlte. Dafür wurde wohl einer
ausgeschnitten, denn man sieht noch eine Hand, für die es
keinen Mann gibt. Der rechte Fuß ist auch sichbar und gehört
zu dem
ausgeschnittenen (Bild freundlicherwiese zur Verfügung
gestellt von Frau Maria WENZEL, Eichenberg).
Rechts:
Im Ausschnitt erkennt man den mit einem Film einmontierten
Mann in der Mitte und eine linke Hand unter dem Arm des Mannes
rechts, die zu keiner Person gehört. Der wurde wohl
ausgeschnitten.
Unten: Der gleiche Sandsteinbruch mit dem weißen Sandstein
oberhalb von Eichenberg, aber ca. 100 Jahre später.


Im Rahmen des Kulturrundweges wurde der
Steinbruch im Sommer 2009 wieder frei geschnitten und
vom Bewuchs befreit, so dass man die leuchtend weißen Felsen
wieder in der Sonne sehen kann;
aufgenommen am 17.12.2009.
- Der Gneis vom Dickbusch.
Der kleine Steinbruch wurde von der Straßenbaufirma Becker
aus Wasserlos in den 1950er Jahren angelegt (siehe Okrusch et
al. 2011 S. 171, Aufschluss Nr. 50). Bei dem sehr harten, aber
durch die Glimmerschüppchen gut spaltbaren Gestein, handelt es
sich um einen ehemaligen Granit mit einem Erstarrungsalter von
ca. 410 Millionen Jahren (damals lag der Spessart unterhalb
des Äquators), der vor ca. 330 Millionen Jahren durch Hitze
und Druck in den Gneis umgewandelt wurde (Metamorphose). Bei
den Glimmern auf den Spaltflächen handelt es sich um Biotit
(dunkel) und Muskovit (silbrig). Im Querbruch erkennt man den
grauen Quarz und die spaltbaren Feldspäte, die den größten
Anteil am Aufbau haben. Das Gestein ist im östlichen
Vorspessart weit verbreitet. Als Besonderheit sind sulfidische
Kupfererze und grüner Malachit gefunden worden.
Weiter findet sich in den Felsen Schlieren vom Paragneis, hier
als sehr weiche Staurolith-Gneise und Glimmerschiefer, in dem
Orthogneis!
Im Rahmen der Einrichtung des Kulturrundweges wurde von der
Gemeinde Blankenbach der Steinbruch frei geschnitten, so dass
man jetzt ohne Schwierigkeiten die Felsen sehen kann.

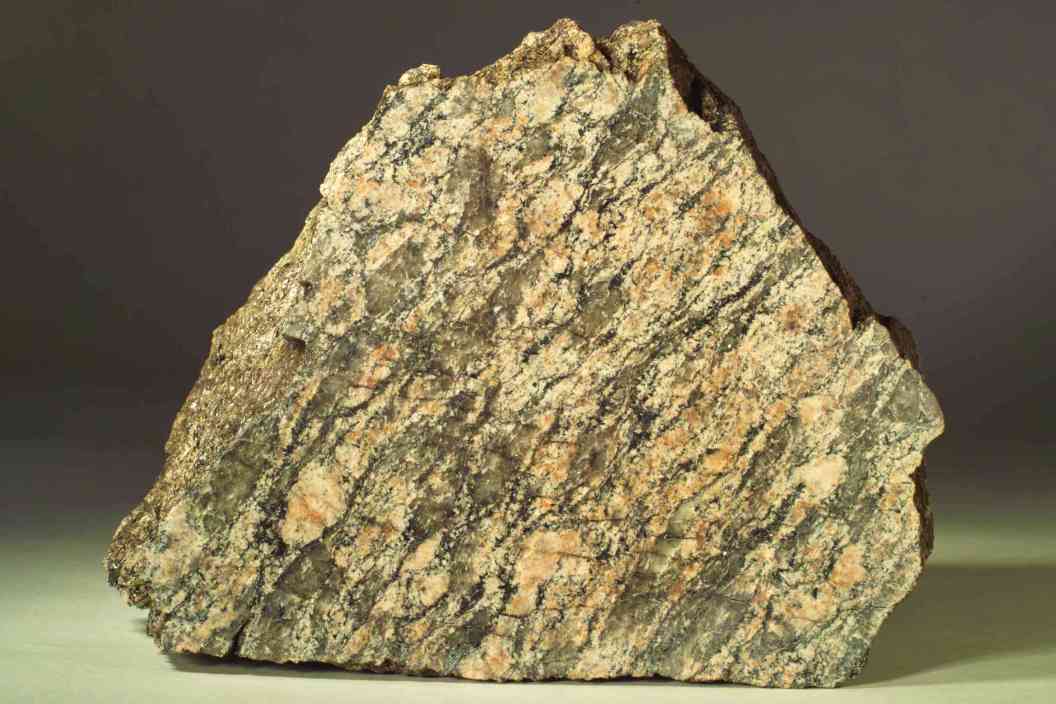
Links: Felsen im Steinbruch im Dicksbusch bei
Blankenbach - vor dem Freischneiden mit den Felsen aus einer
Einschaltung von Staurolith-Gneis,
aufgenommen am 07.03.2009.
Rechts: Angeschliffener Orthogneis mit den großen
Feldspat-Einschlüssen ("Augengneis"); dieser steht im hinteren
Teil des Steinbruchs an. Also 2 ganz unterschiedliche Gesteine
in einem kleinen
Steinbruch;
Bildbreite 17 cm.

Auch dieser Steinbruch wurde für den
Kulturrundweg wieder vom Baumbewuchs befreit (07.12.2009),
so dass man die noch bemoosten Felsen wieder studieren
kann.
- Manganerz und Schwerspat.
An vielen Stellen des Spessarts treten Eisen- und
Manganerze in und unter der Buntsandstein zu Tage. Diese
wurden sicher seit dem Mittelalter in geringem Umfang abgebaut
und zur Eisengewinnung verhüttet.
Mit dem Beginn der Industriealisierung wurde der Bedarf
größer, so dass mehr Eisenerze gesucht, abgebaut und in den
Hochöfen der Eisenhüttenwerke wie in Laufach verschmolzen
wurden. Die erste Verleihung der Erze wurde um 1870
dokumentiert. Im 1. Weltkrieg war das Deutsche Reich von den
Rohstoffen des Auslandes abgeschnitten, so dass alle
verfügbare Erzreserven beprobt und auf Höffigkeit geprüft
wurden. Die Gutehoffnungshütte Aktienverein in Oberhausen
begann hier in der Grube Heinrich Manganerze zu gewinnen.
Wegen des kriegsbedingten Mangels an Männern und dem Vorrang
der Landwirtschaft waren die Fuhrleute aus Sailauf
unzuverlässig. Deswegen wurde einen Schienenbahn (Feldbahn)
projektiert die auf wegen des Mangels keinen eigenen Damm
bekommen sollte, sondern auf der bestehende Straße erreichtet
wurde. Bereits im März 1917 war die Bahnstrecke zum
Abtransport der Erze auf der damaligen Straße nach Sailauf und
durch den Ort Sailauf gänzlich fertig - bei 7 km Länge. Ein
Zug bestand aus 10 - 20 Muldenkippern mit einem Inhalt von
0,75 m³, mit Ladung ein Gewicht von 1 - 1,5 t. Sie werden am
Kopf des Zuges von einer Dampflokomotive gezogen/gebremst mit
einer Leistung von 25 - 35 PS. Das Bergwerk wurde wohl anfangs
im Tagebau und später untertägig mit 5 Schächten betrieben.
Wegen des Mangels an Facharbeitern suchte die
Gutehoffnungshütte Aktienverein in Oberhausen das Bergamt in
Bayreuth um die Genehmigung nach, 50 belgische Arbeiter
einstellen zu dürfen. Auch wurden Jugendliche >14 Jahre
eingestellt. In den Akten befinden sich auch Dokumente zu
Unfällen durch das Herabbrechen von Felsen, z. B. am
23.02.1917 wo Herr SCHLOTH erschlagen wurde. Die Förderung
betrug 1917 ca. 32.000 t/a bei einem Mangangehalt von ca. 9
Gew.-%. Das das Erz aber ca. 0,5 % Arsen enthielt, war die
Verhüttung problematisch.
Seit 1918 ist das Bergwerk aufgelassen, die Halden wurden
größtenteils abgetragen oder sind zugewachsen.
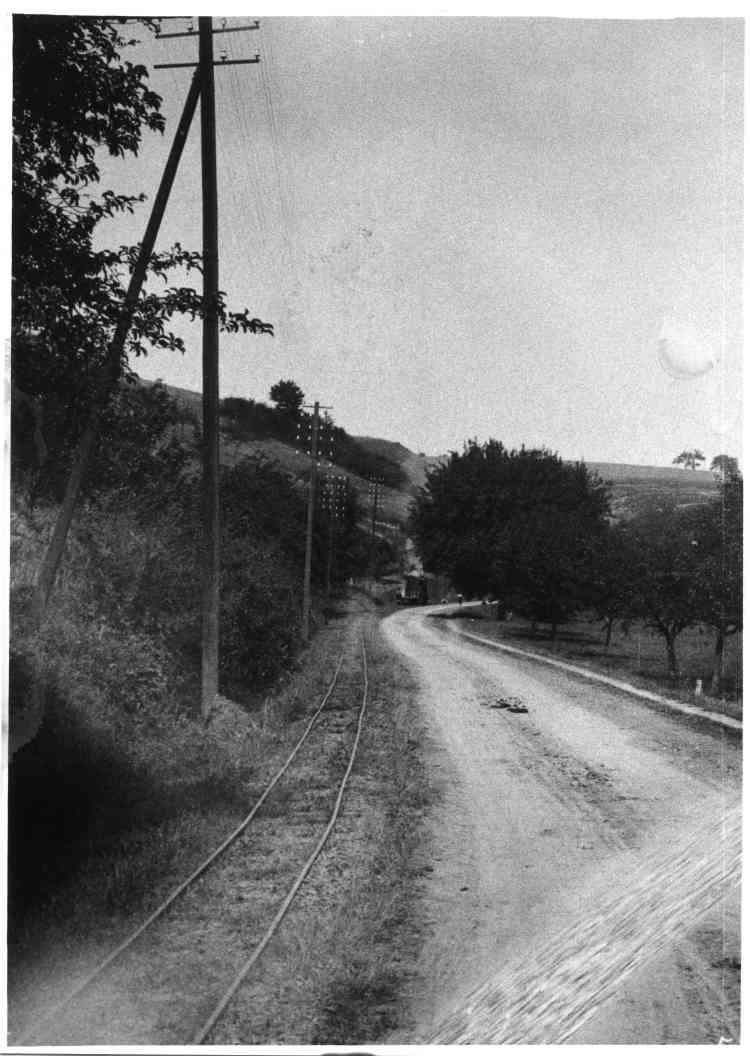

Links: Bild der Feldbahn auf der Straße in
Schwellen verlegt. Der fast flächendeckende Bewuchs zwischen
den Schienen deutet auf das Jahr 1917 hin, denn
1918 wurde sie ja wieder abgebaut. Die Bäume und das
Gras weist auf Spätsommer oder Herbst. Die Lock ist von
hinten zu sehen, auf der Straße läuft eine
Person auf gleicher Höhe. Im Vordergrund liegt Pferdekot auf
der Straße (Bild
freundlicherwiese zur Verfügung gestellt von Herrn GLAAB,
Hösbach).
Rechts: Typisches Manganerz (schwarzer Romanèchit) mit
Eisenerz (brauner Goethit) mit weißem Baryt wie es aus der
Grube Heinrich gefördert wurde,
Bildbreite ca. 8 cm.

Ein Hoch auf den Straßenbau und seine
Böschungen: Über einem Gneissaprolit liegen die eisen- und
manganreichen (schwarze) Tone und Eisenerze der ehemaligen
Grube Heinrich zwischen Sailauf und
Eichenberg,
aufgenommen am 04.10.2014

Massiver, brauner, teils gebänderter Goethit mit etwas
brekziiertem, weißen Baryt eingeschlossen, vorne
angeschliffen;
Bildbreite 13 cm
|

Handstück aus radialstrahliger Baryt aus einem sehr
großen Hohlraum im Goethit;
Bildbreite 15 cm
|

Stück radialstrahliger, brauner Baryt mit
unterschiedlich gefärbten Zonen einst auf einem weißen
Baryt-Kristall, aufgewachsen, angeschliffen und
poliert;
Bildbreite 15 cm.
Im englischen Sprachraum werden solche gebänderten
Baryte als "Oakstone" bezeichnet. Der Name entstand wohl
in England den 19. Jahrhunderts in Arbor Low in der
Grafschaft Derbyshire als "pseudostalactitic baryte".
|

Radialstrahliger, brauner Baryt mit unterschiedlich
gefärbten Zonen auf alteriertem Dolomit, angeschliffen
und poliert;
Bildbreite 7 cm
|

Stück radialstrahliger, brauner Baryt mit
unterschiedlich gefärbten Zonen, angeschliffen und
poliert;
Bildbreite 10 cm.
Der Baryt ist sicher jünger wie die Baryte in den
Gangvorkommen, denn er überwächst den weißen Baryt. Da
das Vorkommen innerhalb der Goethite liegt, ist ein
tertiäres Alter abzuleiten. Der Grund für die
merkwürdige Farbe und die Zonierungen konnte bisher
nicht ergründet werden. Vermutlich sind es
Spurenelemente, die ungleich verteilt die Farbe und auch
die Fluoreszenz anregen.
Für den Baryt, der nach der Reduktion zu BaS im Jahre
1603 zur Entdeckung der Fluoreszenz führte, ist als
Anreger das Cu-Ion nachgewiesen worden (LASTUSAARI et
al. 2014). Dies verwundert, da sonst Cu als Löscher
einer Fluoreszenz gilt. Es ist für dieses Vorkommen
nachgewieseb, dass Manganionen das Leuchten auslösen.
|


Stück radialstrahliger, brauner Baryt mit
unterschiedlich gefärbten Zonen, abgeschieden einst auf
Dolomit. Die Druse ist umittelbar nach der Bildung
zerbrochen, aber es wurde weiter Baryt auf den
Bruchflächen abgeschieden, so dass das Stück allseitig
von Baryt-Kristallen überkrustet ist, angeschliffen
und poliert;
Bildbreite 12 cm.
Darunter das gleiche Stück unter UV-Licht mit einer
ausgesprochen starken gelben Fluoreszenz des
unscheinbaren Baryts!
|
Funde aus der Baustelle im Oktober 2014.
Das Schwerspatvorkommen der Grube Marga wurde während des
Abbaues des Manganerzes entdeckt, aber erst 1933 begann man
diesen bergmännisch zu gewinnen. Nur ein einzelnes Haus am
Straßenrand der Straße von Sailauf nach Eichenberg – die
ehemalige Verwaltung – erinnert an das mit Unterbrechung von
1933 bis 1952 hier betriebene Schwerspatbergwerk. Das Mundloch
ist verstürzt und ohne Kundigen kaum mehr erkennbar. Nach
einer Förderperiode von 1934 bis 1945 ersoff die Grube, da
kein elektrischer Strom zur Verfügung stand. Erst 1946 wurde
die Grube gesümpft und wieder eröffnet. Die hier angestellten
Bergleute mussten nicht in den Krieg.
Im September 1938 ereignete sich ein Unglück, bei dem der
damals ca. 38jährige Bergmann Eduard MÜLLER tödlich
verunglückte. Die Ursache soll im Schalten der Fördertechnik
gelegen haben und war als „Scherz“ gedacht.

Das Stollenmundloch der Grube Marga bei
Eichenberg mit Prof. Dr. Martin OKRUSCH,
aufgenommen am 19.08.2006.


Links:
Stück weßer Schwerspat mit winzigen Einschlüssen aus
Chalkopyrit,
Bildbreite 10 cm,
Rechts:
Verquarzter Baryt aus der Grube Marga,
Bildbreite 12 cm.
Der in Teilen hohe Gehalt an Quarz im Baryt war der Grund, dass
einige Bergleute die Lungenkrankheit Silikose bekamen. Dabei
kann man im Handstück kaum sehen, dass Quarz im Baryt enthalten
ist.
- Rhyolith (Quarzporphyr).
Im Bereich einer, von Norwest nach Südost verlaufenden
Störung, etwa 1 km südlich von Eichenberg sind oberpermische
Magmen zu Rhyolithen erstarrt (OKRUSCH & WEINELT
1965:130ff). Die sehr kleinen Vorkommen sind nur durch
Lesesteine belegt und unterscheiden sich bei näherem Hinsehen
in der (Fludial-)Textur deutlich von den Rhyolithen bei
Sailauf.

Rhyolith von Eichenberg, angeschliffen und
poliert,
Bildbreite 7 cm

Der Rhyolith aus dem Foto oben im
Dünnschliff, linear polarsiertes Licht,
Bildbreite 5 mm
Das gelbliche, bräunliche bis graue Gestein ist stark
alteriert, zeigt aber noch die typischen Fließstrukturen.
Stellenweise sind dünne Risse mit Quarz verheilt. Im
Dünnschliff kann man mind. 2 Alterationsstufen unterscheiden.
Bemerkenswert sind die zahlreichen Hellglimmer, die noch
relativ frisch in der Grundmasse erkannt werden können. Die
Quarze zeigen die typischen Korrossionsbuchten und die
Feldspäte sind meist bis zur Unkenntlichkeit und löchrig
zersetzt, aber besonders die Plagioklase sind auch gitterartig
rekristallisiert. Girlandenförmig ist Eisenhydroxid in der
Grundmasse eingestreut. Opake Erzmineralien fehlen. Wenige
Xenolithe des umgebenden Kristallins sind als
Glimmeransammlungen und undulös auslöschende Quarzkörner
sichtbar. Die sicher einst glasige Grundmasse ist zu einer
feinkristallinen Masse rekristallisiert.
Leider ist im Umfeld des Ausstreichens auch für den Wegebau
Quarzpoprhyr von der Hartloppe bei Sailauf angefahren worden,
der inzwischen durch die Erosion, Feldbearbeitung und
Änderungen am Wegenetz flächig zerstreut wurde, so dass eine
eindeutige Unterscheidung der Lesesteine nicht immer ganz
einfach ist. Kennzeichen können sein: frisches Gestein,
rötliche Farben, frische Bruchkanten und Korngröße.
Literatur:
LASTUSAARI, M., LAAMANEN, T., MALKAMÄKI, M., ESKOLA, K. O.,
KOTLOV, A., CARLSON, S., WELTER, E., BRITO, H., BETTINELLI, M.,
JUNGNER, H. & HÖLSA, J. (2012): The Bologna Stone: histor´s
first persistent luminescent material.- European Journal of
Mineralogy, Vol. 24, No. 5 – September, October, p. 885 -
890, 5 Fig., [Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 730, 754ff,
774ff.
LORENZ, J. (2018): Mangan – Spurenelement, Mineralbestandteil und
Stahlveredler. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 01/2018, S.
38 - 40, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.
LORENZ, J., SCHMITT, R. T. & VÖLKER, A. (2018): Die
untertägige Mangan- und Eisenerzgrube „Heinrich“ zwischen
Eichenberg und Sailauf im Spessart - später die Grube „Marga“ auf
Schwerspat.- S. 483 - 508, 15 Abb., 5 Tab., Jahresberichte und
Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins Neue Folge 100
für das Jahr 2018, 1 - 584 S., 336 Abb., 27 Tab., [E.
Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer, Band 44, 220 S., 14 Abb., 3 gefaltete
Beilagen, 1 großformatige mehrfarb. geolog. Karte, [Gebrüder
Borntraeger] Berlin.
OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1965): Erläuterungen zur
Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5921
Schöllkrippen.- 327 S., 53 Abb., 10 Tab., 3 Beil. [Bayerisches
Geologisches Landesamt] München.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

Joachim LORENZ beim Erklären der Gesteine im frisch
freigeschnittenen Steinbruch Dicksbusch
bei Blankenbach.
Aufgenommen am 10.10.2009
Zurück zur
Homepage oder zum Anfang der Seite