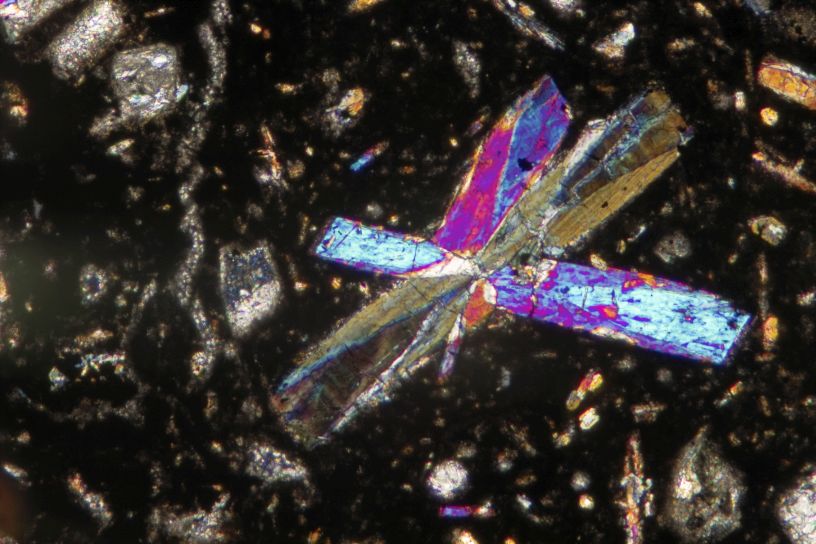Der Basalt von
Winzenhohl
im Spessart
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Der schräg einfallende, ellipsoidisch
absonderende Basalt-Gang, in dem ihn umgebenden Gneis hinter
den Baustahlmatten für die Stützmauer, siehe Bild unten;
aufgenommen am 30.03.1978
(zufällig auf dem Weg vom Steinbruch Sailauf zum Steinbruch
bei Dörrmorsbach).
Zusammenfassung:
Der bereits von Hugo BÜCKING als anstehend beschriebene - bei der
geologischen Landesaufnahme der Geologischen Karte Blatt Nr. 6021
Haibach jedoch bei der Kartierung in den 1960er Jahren nicht
wieder aufgefundene - Feldspathbasalt von Winzenhohl - ist von J.
LORENZ im Jahre 1978 im Zuge einer Straßenverbreiterung als 0,90 -
1 m mächtiger, in die Schieferung der umgebenden
Muskovit-Biotit-Schiefer annähernd konkordant eingedrungener
kugelig-ellipsoidisch absondernder Basaltgang erneut entdeckt
worden. Der Fund ist deshalb bedeutsam, weil es das bisher einzig
bekannte Basaltvorkommen im Gebiet des Gradabteilungsblattes
Haibach war.
Nach der Untersuchung von Frau Dr. D. SCHMEER handelt es sich um
einen sehr feinkörnigen, zum Teil blasig entwickelten, Hornblende
führenden Augit-Plagioklas-Basalt. Eine absolute Altersdatierung
erbrachte 65 - 67 Ma (LORENZ & WEINELT 1981).
Geschichte:
BÜCKING (1892, S. 213) berichtet:
"...; wohl aber fand ich Basalt auf ganz kurze
Erstreckung a n s t e h e n d ö s t l
i c h v o n W i n z e n h o h l an der auf
der Karte (allerdings zu groß) angegebenen Stelle. Der Basalt
ist hier stark zersetzt und zwar in eine erdige, graue Masse;
nur einzelne umherliegende Kugeln sind noch verhältnismäßig
frisch. In diesem erscheint der Basalt dunkelgrau und äußerst
dicht, sodass abgesehen von wenigen wesentlich aus Calcit und
Brauneisen bestehenden kleinen Mandeln, man mit blossem Auge
kein Gemengtheil erkennen kann. Unter dem Mikroskop löste sich
das dichte Gestein auf in ein Haufwerk von zahlreichen
Augitmikrolithen, kleinen und grösseren Plagioklasen, vielen
Magneteisenkrystallen und kleinen rundlichen Pseudomorphosen,
welche aus Serpentin bestehen und wohl auf Olivin
zurückzuführen sind. Einzelne größere Augite, zum Theil
knäuelartig verwachsen, treten einsprenglingsartig aus dem
Gewebe hervor; ihre Dimensionen sind aber immerhin so geringe,
dass mit blossem Auge nicht wahrgenommen werden kann. Der
Basalt von Winzenhohl wäre darnach ein F e l d s p a t b
a s a l t."
Im Zuge der seit Herbst 1977 bis Frühjahr 1978 bei Winzenhohl
durchgeführten Straßenbauarbeiten wurde die Ortsverbindungsstraße
Winzenhohl - Hösbach Bahnhof verbreitert bzw. Platz für die Anlage
eines Gehweges geschaffen. Bei meinen Begehungen im März 1978
entdeckte ich bei Absuchen der durch die Verbreiterungen der
Straße entstandenen Böschungen den Basalt wieder, jedoch ohne die
Bedeutung zu erkennen. Den Zusammenhang zw. dem Vorkommen und
BÜCKING wurde von Wi. WEINELT erkannt.
Das Vorkommen liegt ca. 220 m südlich des Höhenpunktes 192 NN,
bei R 351664 H 553799 der TK 25 Nr 6021
Haibach am Westhang der "Höhe gegen Keilberg". Der Aufschluss ist
seit dem durch eine dicke Betonstützmauer verdeckt:

Hinter der langen Stützmauer in der rechten Bildmitte verbirgt
sich
der Basalt von Winzenhohl,
aufgenommen am 09.07.1995
Der 0,90 - 1 m mächtige Basaltgang setzte in den in diesem
Bereich mit 45° gegen SE einfallenden algonkischen
Muskovit-Biotit-Schiefer (ag1,gl der GK 25, Nr. 6021 Haibach, Wi.
WEINELT 1962) annähernd konkordant in der Schieferung auf. Gegen
das Ausgehende war er bis zur Unkenntlichkeit zersetzt und
verwittert und wurde von perglazialem Wanderschutt überlagert. In
seinem unteren, etwas über 3 m aufgeschlossenem Gangteil sonderte
er kugelig-ellipsoidisch ab. Das Nebengestein ließ kleinerlei
Kontakterscheinungen erkennen. Dies ist auch nicht zu erwarten, da
das metamorphe Gestein bereits auf 650 °C erwärmt war und bei dem
kleinen Gang die Erwirkzeit nur sehr kurz war.
Gesteinkundlicher Befund:
An der Fundstelle wurde vom Autor am 30.03.1978 eine
ellipsoidische Gesteinsprobe (Durchmesser 20 und 13 cm) entnommen
und dem Bayerischen Geologischen Landesamt für die Anfertigung von
Dünnschliffen übersandt).
Das schalig absondernde Basaltellipsoid besitzt eine hell- bis
mittelbraune Verwitterungsrinde mit Überzügen von schwarzen
Mangandendriten, kleinen Tupfen (1 - 3 mm Durchmesser) und mehrere
Zentimeter große Flecken von Manganoxid sowie von
hellrosafarbenen, orangegelben Tapeten von Eisenoxidhydrat als
sekundäre Absätze, des im Gestein zusitzenden Bergwassers.
Vereinzelnd enthält die Verwitterungsrinde bis 2 mm große runde
oder länglich ovale, mit Brauneisenmulm (Limonit) gefüllte Poren
oder Löcher ehemaliger Gasblasen. Der mit der Diamantsäge
zerschnittene ellipsoidische Gesteinskörper läßt auch in seinem
Inneren einen schaligen Aufbau erkennen. Es wechseln hierbei 1 bis
3 cm breite dunkelgrau bis graubraun gefärbte, dichte Schalen mit
schmalen, dunkelbraunen Zonen ab (0,5 - 4 mm). Da letztere gegen
den Rand des Gesteins bis auf 1 cm Stärke zunehmen und sich hier
einerseits in ellipsoidischen Kleinformen aufzulösen beginnen,
andererseits aber als Farbbahnen auch feinsten längs-, quer- und
diagonal verlaufenden Haarrissen im Gestein folgen, wird ihre
sekundäre Entstehung durch die Wanderung und Ausfällung von
Eisenoxihydratlösungen entlang der Wegsamkeitsgrenzen des
Schalenbaues und der Rissstrukturen gedeutet. der Anschnitt läßt
zudem bis maximal 5 mm Durchmesser große runde, ovale und auch
dreieckige Mandeln als Hohlräume nach Gasblasen erkennen, die zum
Teil mit Zeolithen randlich besetzt, zum Teil mit Limonit gefüllt
sind. Gegen den Rand, besonders aber gegen das Hangende der
orientiert entnommenen Gesteinsprobe treten sie mit bis zu 7
Stück/cm2 etwas vermehrt auf.

Stück Basalt (angeschliffen und poliert) mit einer randlicher
Verwitterungszone
(hellgrau), im Innern frisch und mit kleinen Einschlüssen aus
Calcit und einem
Zeolith durchsetzt; die Hohlräume am Rand sind leer;
Bildbreite ca. 15 cm
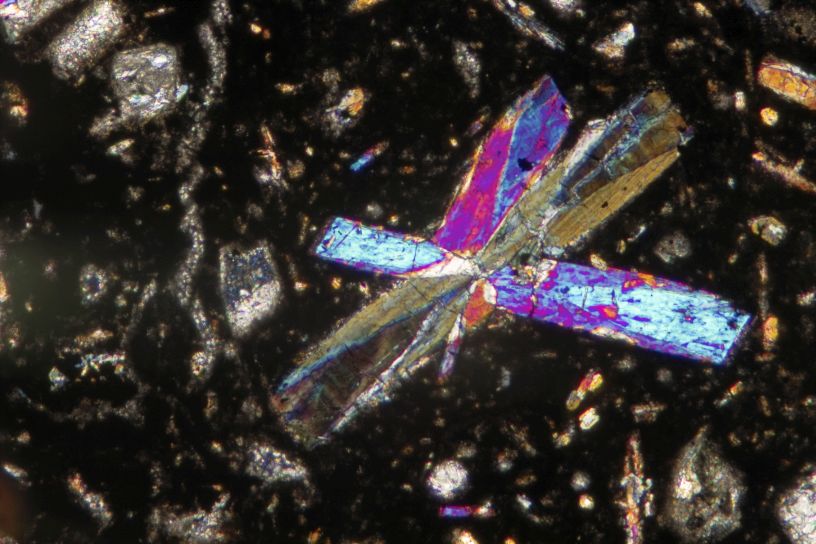
Sternförmig verwachsene (Titan-)Augit-Kristalle ("Sanduhrstruktur")
in der Grundmasse des Basalts, gekreuzte Polarisatoren;
Bildbreite 2 mm.
Der Mineralbestand und das Gefüge der vorliegenden Basaltprobe
sind von (Fräulein) Dr. D. SCHMEER (früher Bayerisches
Geologisches Landesamt) unter anderem an dem Dünnschliff Nr. X
1944 bestimmt und untersucht worden. Nach dem von ihr am
08.05.1979 mitgeteilten Befund handelt es sich bei dem
vorliegenden Gestein um einen sehr feinkörnigen, Hornblende
führenden Augit-Plagioklas-Basalt mit schwach intersertalem Gefüge
und Blasenhohlräumen. Die Randsäume der Blasenhohlräume sind mit
Zeolithkristallen besetzt, die Blasenhohlräume selbst mit braunem
Limonit gefüllt.
Radiometrisches Alter:
Herr Prof. Dr. H. J. LIPPOLT (*1933 †2011), ehemaliger Leiter des
Laboratoriums für Geochronologie der Universität Heidelberg, hat
an dem Hornblende führenden Augit-Plagioklas-Basalt eine
Altersdatierung vorgenommen. Es wurde 65 - 67 Millionen Jahre
ermittelt. Es wäre demnach der spät-kretazisch-altertiären
Vulkanitgruppe zuzuordnen, die im Kraichgau, im Sprendlinger Horst
und im Spessart auftritt.
Literatur:
BÜCKING, H. (1892): Der Nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der
Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge Heft
12, 274 S., Berlin.
LORENZ, J. & WEINELT, Wi. (1981): Der Basalt von Winzenhohl im
südlichen Kristallinen Vorspessart.- Aufschluss 32, S. 25
- 27, Heidelberg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 598.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:25000 Blatt Nr.6021 Haibach.- 246 S., München.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite