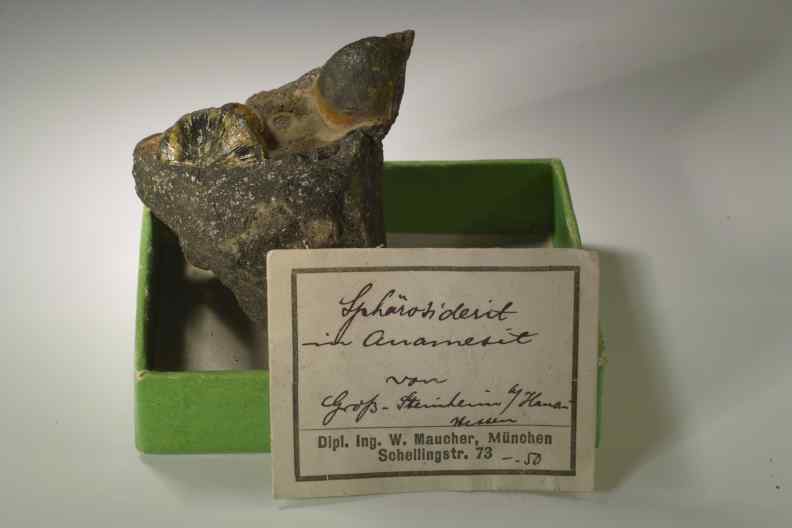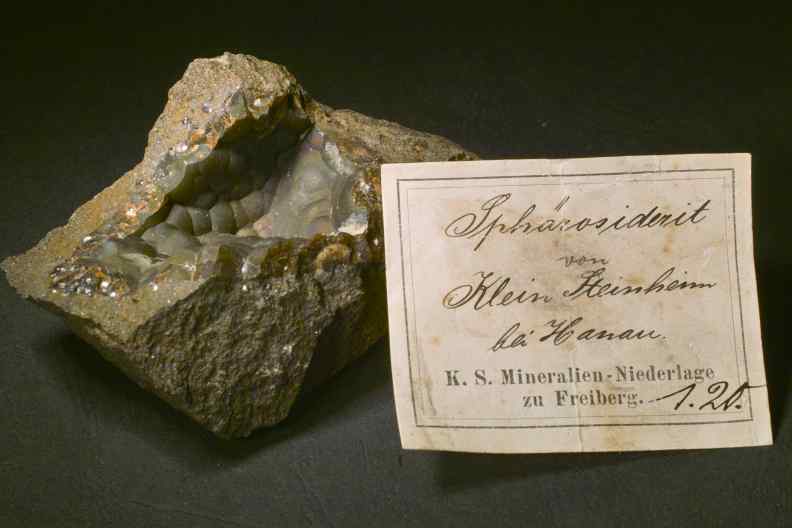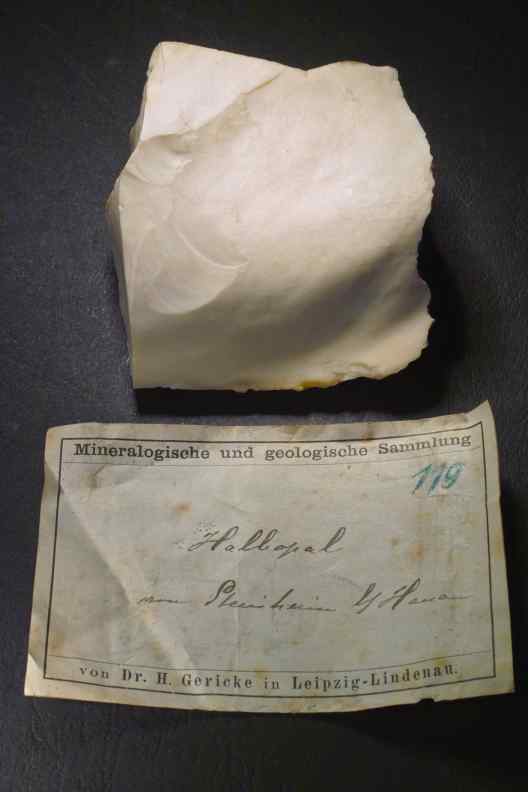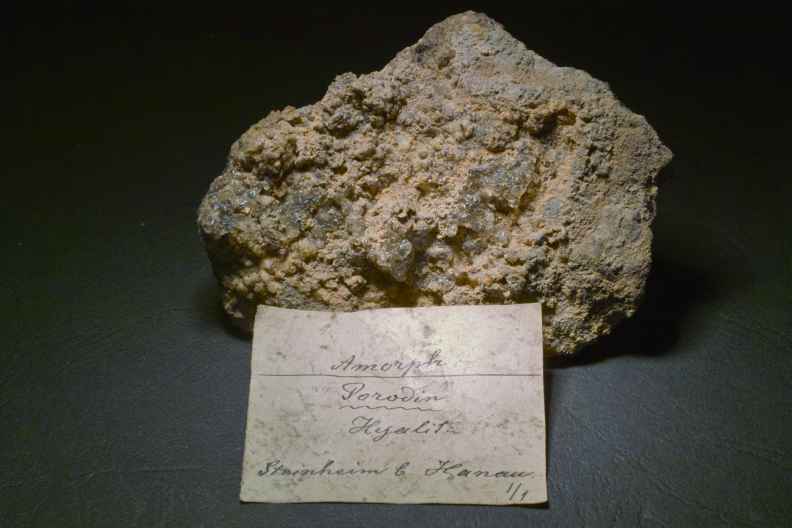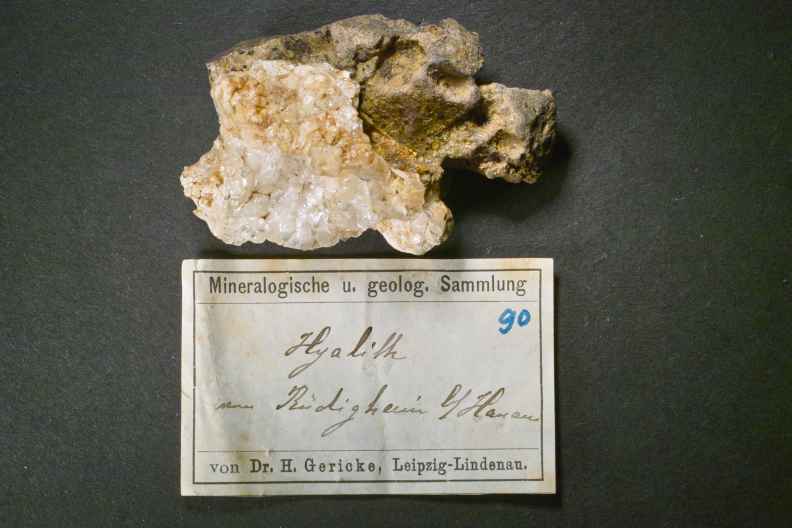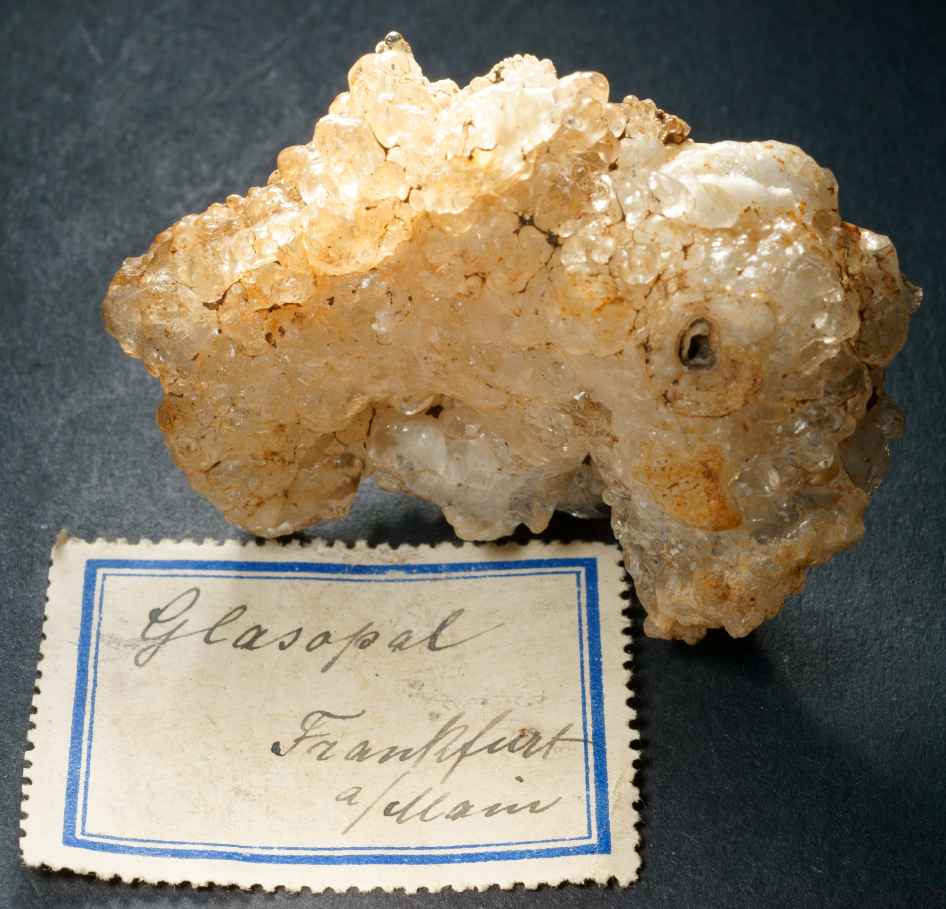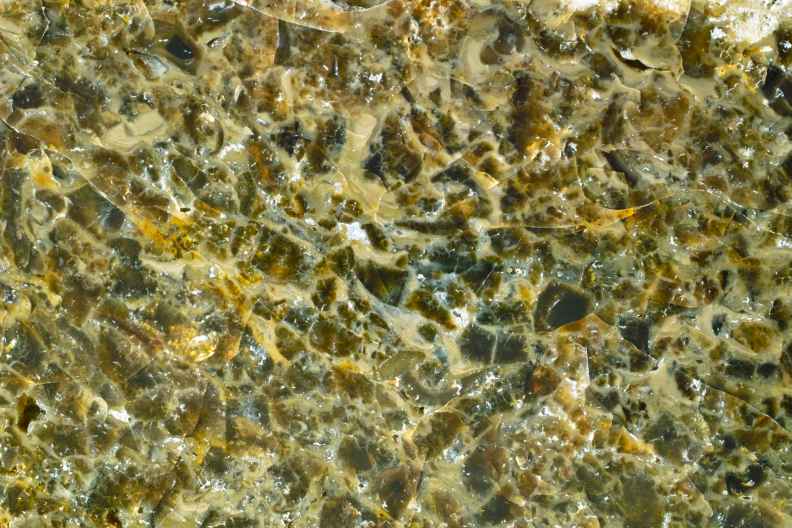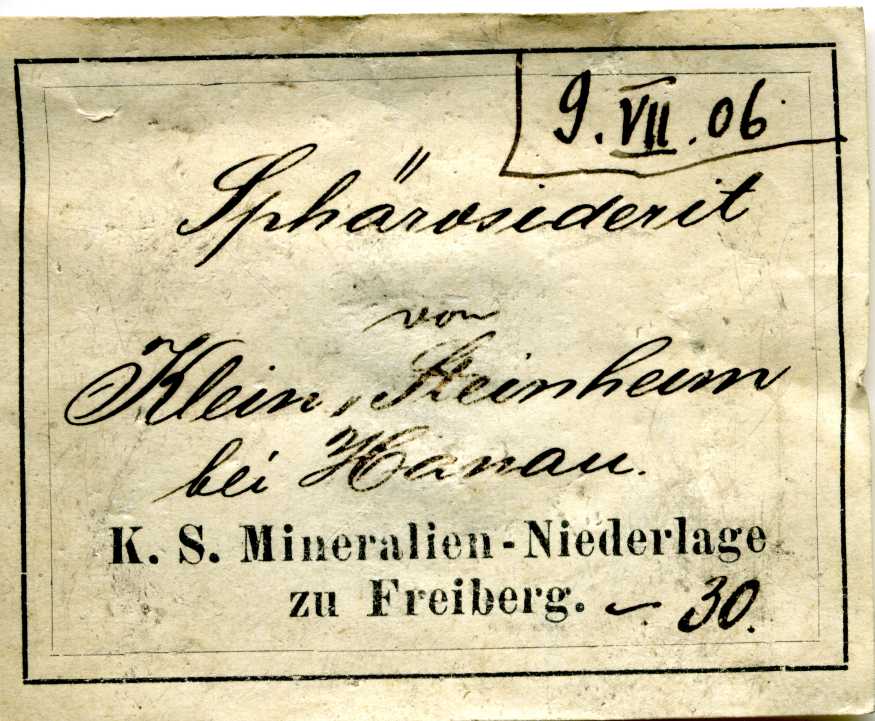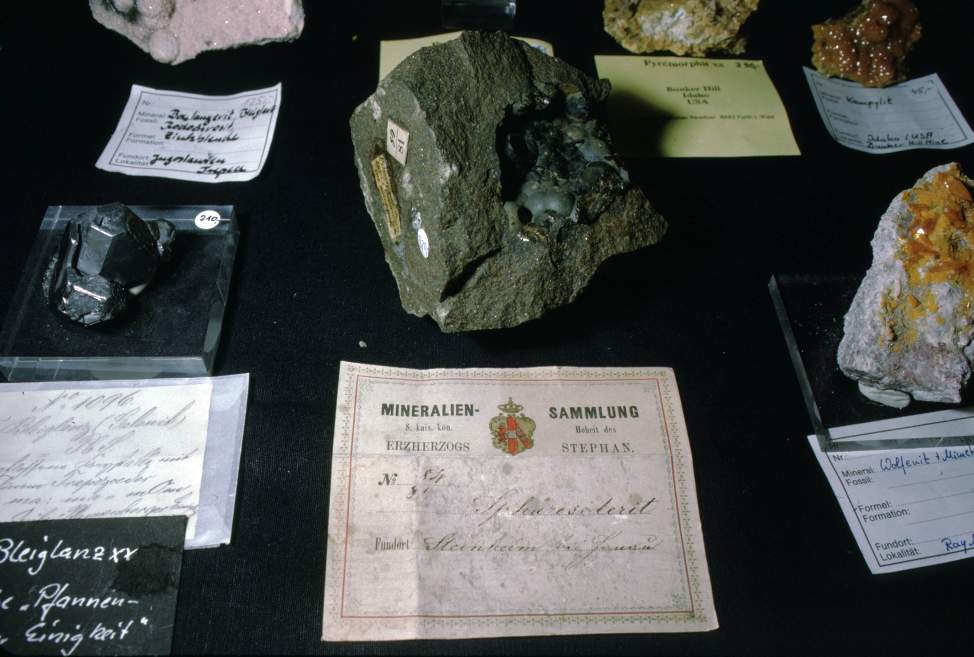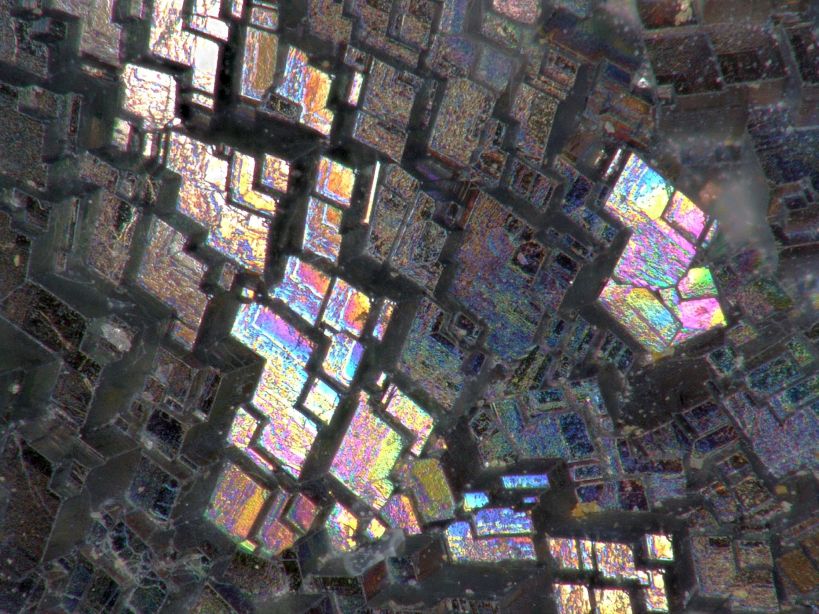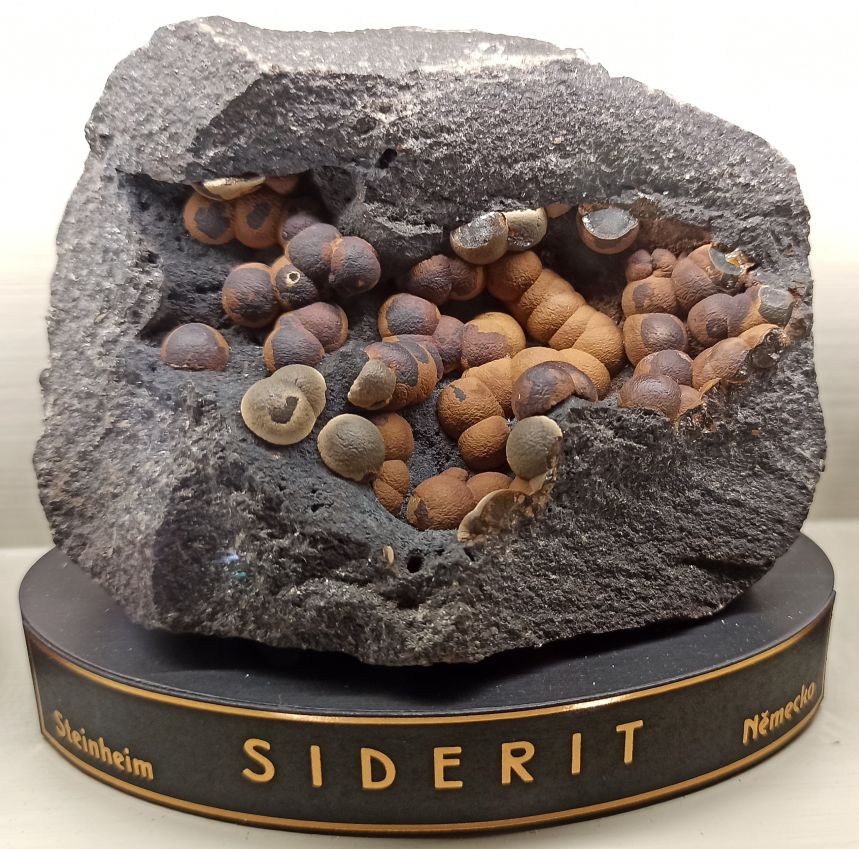Opal & Sphaerosiderit
aus Steinheim a. Main -
Produkte der Lavaströme aus dem Vogelsberg?
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


In den Steinbrüchen von Dietesheim konnten die basaltischen
Andesite bis 1983 studiert werden,
aufgenommen links 12.01.1980 (säulige Absonderung) ,
rechts 18.03.1975 (beim Laden auf einen älteren LKW
(Haubenschnautzer) mit einem O&K-Bagger RH 30 mit Hochlöffel
und Klappschaufel).

Typischer Opal aus Steinheim (angeschliffen und poliert) - aber
kein
Holzopal, d. h. ein Opal mit Resten einer biologischen Struktur,
Gewicht 2.120 g, was einem Edelsteingewicht von 10.600 Karat
entspricht!
Bildbreite 12 cm
Der "Basalt" (basaltischer Andesit)
von Steinheim (Hanau) und Dietesheim (Stadtteil von Mühlheim bei
Offenbach)
Das gleiche Gestein wie zwischen Alzenau
und Kahl findet sich westlich von Alzenau über Großauheim,
Hanau, Wilhelmsbad, Steinheim, Dietesheim bis nach Frankfurt und
nach Schlüchtern.
In und um Steinheim und zwischen Mühlheim-Dietesheim und
Hanau-Steinheim wurden zahlreiche Steinbrüche betrieben. Die
Steinbrüche bei Dietesheim mit dem dicksäulig absondernden
Basalt bestanden sicher schon um 1915. Die beiden
zuletzt in Förderung stehenden Steinbrüche wurden von mir noch
zwischen 1974 und 1983 besucht. Der kleinere Steinbruch liegt
südwestlich vom Mühlheimer Stadtteil Dietesheim in der Gemarkung
"An den Steinbrüchen" am südwestlichen Oberwald. Er war seit
1983 aufgelassen und lief aufgrund des Abschaltens der Pumpen
teilweise voll Wasser (siehe unten).

Die aufgelassenen Teile im Steinbruch nach dem Auflassen
aufgenommen am 11.05.1980
Der größere Steinbruch, betrieben von der Vogelsberg
Basaltwerke GmbH, Werk Mühlheim, liegt südöstlich von
Mühlheim-Dietesheim in der Gemarkung "An den Steinbrüchen". In
diesem Steinbruch steht unter einer Flugsandbedeckung und einer
Verwitterungszone sehr grobsäuliger Basalt, ca. 15 m mächtig,
an. Der letzte große Steinbruch wurde um 1983 aufgelassen. Die
ausgedehnten Bruchanlagen füllten sich mit Grundwasser, welches
vorher abgepumpt wurde. Daraus wurde der Oberwaldsee des
Erholungsgebietes "Steinbrüche Mühlheim-Dietesheim". Das Gelände
wurde mit Wanderwegen, Brücken, Hütten und Stegen erschlossen.


Die früheren Steinbrüche stehen heute unter Wasser und werden als
Badeseen genützt. Den säulig absondernden Basalt kann man nur
noch knapp über der Wasseroberfläche erkennen,
aufgenommen am 01.08.2007.

Der Steinbruch mit der Brücke am 01.08.2007.
Den umfangreichen Basaltabbau (z. B. auch der Basaltbruch
„Kaiser“ bei Wilhelmsbad, beispielsweise zur Gewinnung von
Straßenbaumaterial, gibt es im Raum zwischen Frankfurt und Hanau
bereits seit dem 18. Jahrhundert. Dies wird in einem anschaulichen
Reisebericht vom 21. Juni 1778 von J. A. de LUC beschrieben.
Bei dem Gestein (alt als Anamesit, auch Basalt und
Untermain-Trapp beschrieben) handelt es sich um einen
basaltischen Andesit, wie zahlreiche chemische Analysen zeigen
(RENFTEL 1998). Der Ursprung des vulkanischen Gesteins liegt im
Vogelsbergmassiv, ohne dass man dafür die genaue Quelle
kennt.
Mineralien, insbesondere der "Sphaerosiderit" und der Opal, aus
den um Hanau verbreiteten Basalten werden wohl schon seit über 150
Jahren aufgesammelt und haben eine weite Verbreitung erfahren.
Praktisch in allen Sammlungen mit altem Bestand - vor ca. 1900 -
sind schöne Stück aus Hanau oder Steinheim vertreten. Solche
Stücke wären aus Alzenau auch zu erwarten, sind aber von hier
nicht bekannt. BAUER (1909:483) beschreibt, dass große Mengen Opal
von Steinheim nach Idar-Oberstein zum Schleifen verbracht worden
sind.
Ich konnte die Steinbrüche von 1975 bis 1983 besuchen, da ich in
Offenbach arbeitete und der Weg zur Arbeit an den Steinbrüchen
vorbei führte, wenn ich mit dem Motorrad bzw. selten mit den
väterlichen Auto fahren konnte. Die guten Funde von Mineralien
stammten aber aus den lange geschlossen Steinbrüchen um Steinheim,
als man die Gesteinsgewinnung noch von Hand vornahm; es wurden
neben Pflastersteinen auch Kleinschlag produziert. In geringem
Umfang gab es auch eine eingeschränkte Werksteingewinnung (es gab
keine rissfreien, großen Blöcke), wie die vielen Bauwerke in der
Region zeigen.
Ein eigentlich "unmögliches" Fossil!
 
Fossiler Zapfen einer Konifere im blasenreichen
basaltischen Andesit als Abdruck der Lava, die über einen
Boden mit Zapfen gelaufen ist (die zwei mir
bekannten Stücke in den Sammlungen sind derzeit verschollen.
Die Stücke stammen aus der ehemaligen Sammlung Karl GOTTLIEB
(*1902 †1986),
Bad Orb und sind etwa so groß wie ein Pflasterstein. Die
Aufnahme stammt aus dem Jahr 1997.
Leider sind beide Stücke verschollen (vermutlich
gestohlen) - ich würde mich über einen Hinweis des
Verbleibs sehr freuen, da es
sich um lokal sehr bedeutsame Funde handelt.
Der Offenbacher Verein für Naturkunde (1858 - 2022)
besaß in seiner Sammlung ein sehr ähnliches Exemplar (1935
von Adolf ZILCH (*1911 †2006) im Krebs´schen Steinbruch bei
Dietesheim gefunden), welches aufgrund des Gesteins
eindeutig dem Vorkommen in Steinheim/Dietesheim zugeordnet
werden kann. Das Stück wurde zu verschiedenen Anlassen
gezeigt und befindet sich seit 2023 im Museum in Karlstein.
Rezent sind solche Formen z. B. aus Hawaii bekannt. Sie
entstehen an der Unterseite von Lavaströmen, wenn sehr
dünnflüssige Lavaströme Holz überwallen und dann schnell
erkalten. Das Holz verbrennt dabei, aber die Form bleibt als
Abdruck erhalten.

Rezentes Beispiel:
Der Vulkan Mauna Ulu (gehört zum Kilauea mit seinem Lavasee)
auf Hawaii eruptierte 1969 - 1974 enorme Mengen an sehr
dünnflüssiger Lava. Einzelne Lavafontainen erreichten
unglaubliche 500 m Höhe! Die kaum abgekühlten Lavamassen
liefen in die umliegenden Wälder und brannten alles nieder.
Um die dickeren Baumstämme bildete sich eine dünne Schicht
aus erstarrtem Gestein (gekühlt durch das Wasser des
Holzes), die die Baumstämme und den Maximalstand der Lava
nachzeichnen. Nachdem der Nachschub ausblieb, lief die noch
flüssige Lava ab und zurück blieben die "Baumstämme", die
über die einst hoch liegende Decke ragen. Die in Hawaii als
"Tree Mold" bezeichneten Formen sind im Innern, denn das
Holz verbrannte oder verkohlte nach dem Abfließen der Lava.
Im Innern ist beim genauen Hinsehen die Struktur der Rinde
der Bäume und Farne noch zu erkennen (aufgenommen am
25.03.1986).
Bei GRIES (1990:16) wird - basierend auf ZILCH -
beschrieben, dass man in den Basalt-Steinbrüchen nahe des
Liegenden die Abdrücke von noch stehenden Bäumen in dem
basaltischen Andesit gefunden hat, ähnlich denen, die rezent
in der sehr dünnflüssigen Lava auf Hawaii, verbrennen und
dann zylindrische Löcher in der erkalteten Lava
hinterlassen. Es sind weder Fotos noch Belegstücke bekannt.
HÄUSER (1954:52) berichtet ebenfalls über Pflanzenfossilien
aus dem Tonschichten zwischen den Vulkanit-Decken. Für diese
"Holzopale" als in Opal erhaltenes Holz gibt es bisher keine
Belegstücke, auch nicht in öffentlichen Sammlungen.
|
Steinheim: Die Steinbruchwand am Hotel


Neben dem Best Western Premier Hotel Villa Stokkum wurde im April
2014 die ehemalige Steinbruchwand mit Anker und Maschendraht
gesichert, so dass der Aufschluss (hätte das Zeug zu einen
Geotop) dauerhaft offen sein kann. Man sieht hier auf einer
Länge von ca. 50 m den großsäulig absondernden basaltischen
Andesit als Erstarrungsprodukt eines riesigen Lavastroms. Die frei
gelegte Wand ist etwa 8 - 10 m hoch. Es handelt sich hier um eine
Lavadecke ohne einen Bodenhorizont dazwischen (ist beispielsweise
aus Dietesheim bekannt). Am Wandfuß ist das Gestein noch relativ
frisch und im bergfrischen Zustand von tiefschwarzer Farbe. Nach
oben hin werden die im Querschnitt bis zu 1,5 m messenden und
senkrecht stehenden Säulen rissig. Die Zerteilung führt zu einem
kleinstückigen und rundlichen Absondern des vulkanischen Gesteins
bei einer Aufhellung, so dass man in den Bauwerken anhand der
Farbe abschätzen kann, aus welchem Teil des Lavastromes die
Bausteine entnommen wurden. Die Trennflächen der Säulen sind mit
erdigen Eisenoxiden und Ton gefüllt. Der Fels ist sehr dicht und
nahezu ohne Hohlräume; das kann man so deuten, dass der mächtige
Lavastrom kaum Gase führte und/oder gleichzeitig die hohe Auflast
keine Blasenbildung zuließ. Leider sind auch so gut wie keine
blasigen Zonen aufgeschlossen, so dass die bekannten Siderite
fehlen. Da das Gestein nur weing verwittert ist, fehlt hier auch
der Opal.
Ich hatte schon 1991 Gelegenheit, die damalige Hotelbaustelle zu
sehen. Damals war sogar das Liegende unter dem Andesit in der Form
eines braunen bis grauen, sandigen Tons aufgeschlossen. Die Stelle
ist heute überbaut.
Aus den Steinbrüchen zwischen
(Mühlheim-)Dietesheim und (Hanau-)Steinheim wurden folgende
Mineralien bekannt, von denen die meisten hier abgebildet
werden:
Siderit, Opal, Calcit, Baryt, Anorthit,
Goethit, Pyrit und Gips:

Kugeliger Siderit in einem Hohlraum im basaltischen
Andesit von Steinheim bei Hanau, (Fund aus dem 19.
Jahrhundert)
Bildbreite ca. 10 cm
|
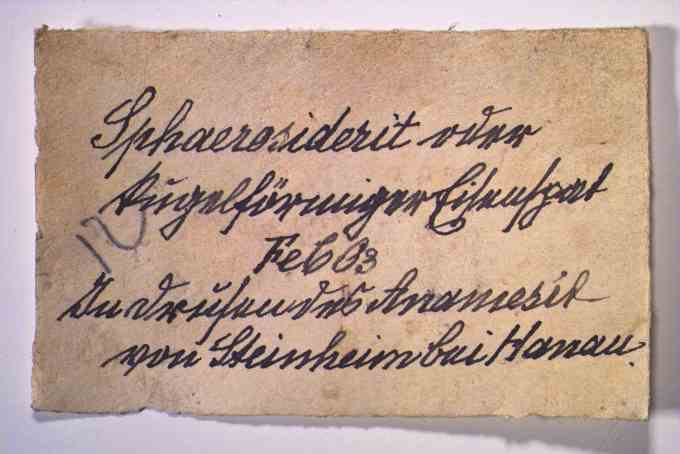
Alter Sammlungszettel mit dem handschriftlich-zittriger
Sütterlin-Schrift als Eintrag: "Sphaerosiderit oder
kugelförmiger Eisenspat FeCO3 In Drusen...
Anamesit von Steinheim bei Hanau" zu einem der hier
abgebildeten Stücke |

Rundliche Siderit-Aggregate mit samtförmiger Oberfläche
als Teil einer größeren Druse im basaltischen Andesit von
Steinheim, sicher Fund aus dem 19. Jahrhundert,
Bildbreite ca. 8 cm
|
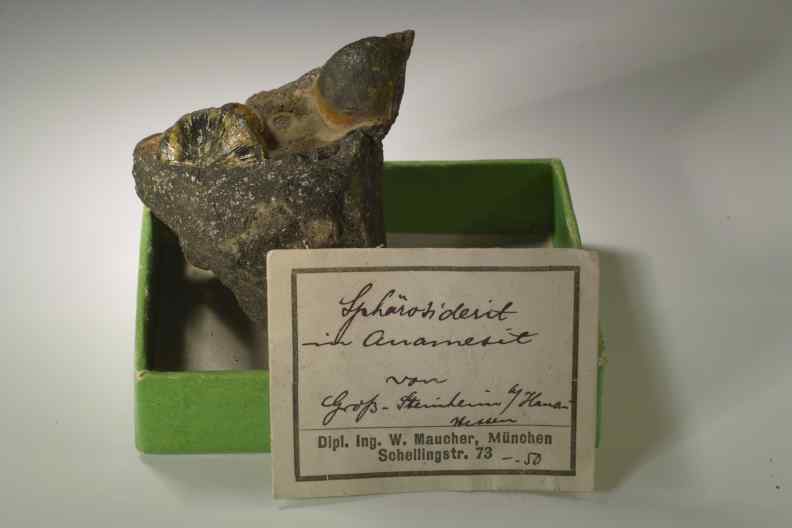
Kugeliger Siderit in dem basaltischen Andesit aus der
bekannten Mineralienhandlung von Wilhelm MAUCHER in
München,
Bildbreite 10 cm
|

Ausschnitt aus dem Bild links, halbkugeliger,
radialstrahliger Siderit in dem basaltischen Andesit aus
der Mineralienhandlung von Wilhelm MAUCHER in München,
Bildbreite 2 cm.
|

"Sphärosiderit", also rundliche Siderit-Aggragte im
basaltischen Andesit von Dietesheim,
Bildbreite ca. 6 cm
|

Farbloser, glaskopfartiger Opal (Hyalit) auf basaltischen
Andesit von Dietesheim,
Bildbreite ca. 2 cm;
Solche Stücke sammelte bereits Johann Wolfgang von GOETHE
in Frankfurt am Main (dort wo heute der Palmengarten
betrieben wird waren zu Goethes Zeiten Steinbrüche) im
gleichen Gestein, wie man in alten Sammlungen sehen kann.
|

Opalstücke aus Dietesheim, gefunden am 11.05.1980. Die
Scherben sind wohl eine Folge der oberflächennahen
Lagerung und des Permafrostes der letzten Kaltzeit, also
keine menschliche Bearbeitung, da an einer Stelle - eine
mit Lehm gefüllte Kluft, die rissigen Stücke noch im
Verband vorgefunden wurden.
Bildbreite ca. 20 cm.
|

Großes Stück brauner, stark rissiger Opal mit einer
weißlichen Verwitterungsrinde aus Dietesheim,
Bildbreite ca. 19 cm
Das Stück hat eine bemerkenswerte Geschichte: Gefunden
wurde es in der Kiesgrube in Hörstein und er kam mit
Bauaushub aus Mühlheim am Main dorthin. Auf der Baustelle
war beim Bau eines Haueses um 1960 Erde aus dem Steinbruch
bei Dietesheim verwandt worden, mit dem die Opale
unbemerkt in die Baustelle transportiert wurden.
|
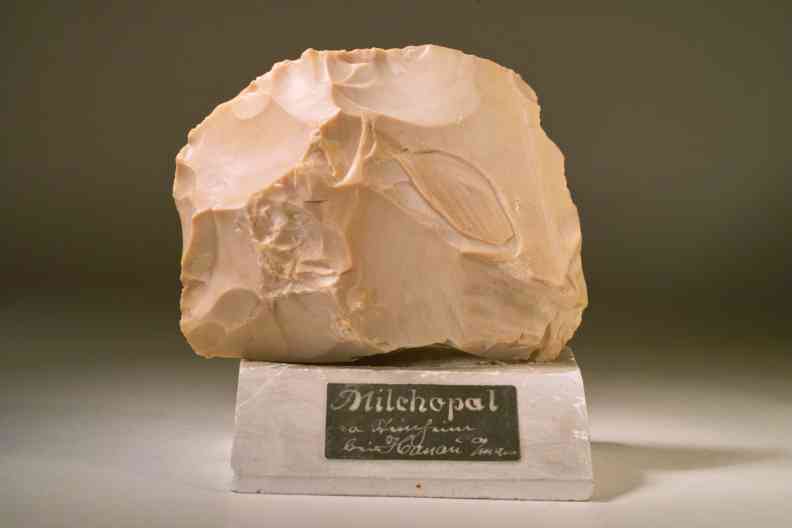
Weißer Opal (Milchopal, Kascholong) aus Steinheim bei
Hanau in einem Sockel aus Gips und alter Beschriftung,
vermutlich aus dem späten 19. Jahrhundert;
Bildbreite ca. 13 cm
|

Angeschliffen und poliertes Stück Opal aus Dietesheim,
Bildbreite ca. 6 cm |

Farbloser Opal (Hyalith) auf dem basaltischen Andesit von
Rüdigheim. Von gelangten viele Stücke mit Hyalith in den
Mineralienhandel des 19. Jahrhunderts,
Bildbreite ca. 8 cm
|

Keulenförmiger, brauner und durchscheinender Siderit in
einer Druse im basaltischen Andesit von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm
|

Schalenförmiger, brauner Siderit in einer Druse im
basaltischen von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |
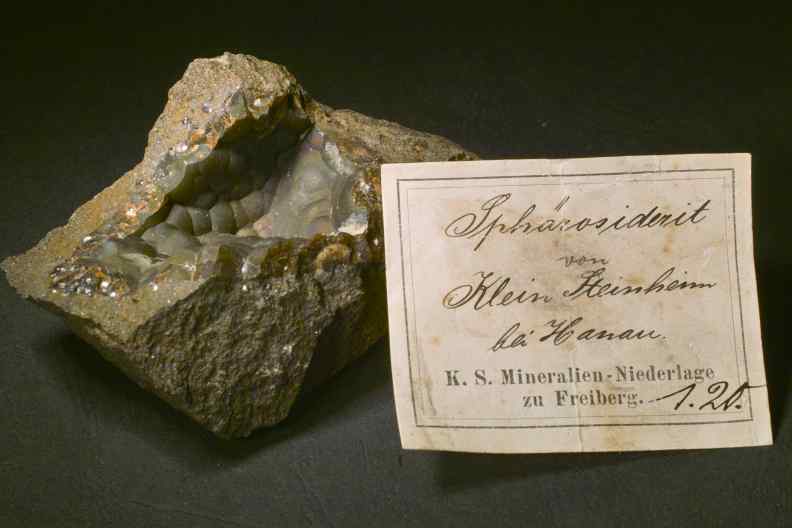
Basaltischer Andesit mit den rundlichen Siderit-Aggregaten
aus einem Steinbruch in Klein-Steinheim, gefunden im 19.
Jahrhundert,
Bildbreite 13 cm
|

Farblose Gipskristalle als Produkt aus der Zersetzung
des Pyrits im alterierten basaltischen Andesits von
Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Strahliger, brauner Siderit mit weißem Calcit in
einer Druse im basaltischen Andesit von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Stark in dunkelbraunen Goethit alterierter, ehemaliger
Siderit in einer Druse im basaltischen Andesit von
Dietesheim,
Bildbreite 2 cm
|

Dunkelbrauner, hellbrauner bis farbloser Opal, randlich
hellbraun bis weißlich alteriert aus dem Basalt von
Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Keulenförmiger, brauner Siderit in einer Druse im
basaltischen Andesit von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Im Jahr 1980 als gelb glänzender Pyrit gefunden, heute zu
einem Gips und weitere Sulfaten zersetzt, Sammlung Nr.
1693,
Bildbreite 2 cm
|

Radialstrahliger, brauner Siderit in einer Druse im
basaltischen Andesit von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Nadelige Anorthit-Kristalle in einer ehemaligen Gasblase
im basaltischen Andesit von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Koniferenzapfen im blasenreichen, basaltischen Andesit;
ehemals Sammlung des Offenbacher Vereins für Naturkunde
(gegr. 1858), ausgestellt anlässlich eines Vortrags zum
Basalt von Steinheim ebendort am 01.04.2014,
Bildbreite 20 cm
|

Weiße, leicht skalenoedrische Calcit-Kristalle auf braunem
Siderit in einer Druse im basaltischen Andesit von
Dietesheim,
Bildbreite 2 cm
|

Undeutliche, tafelige Baryt-Kristalle mit weißem Calcit
auf braunem Siderit in einer Druse im basaltischen Andesit
von Dietesheim,
Bildbreite 2 cm |

Eigenfunde von Horst BECKER, ausgestellt zum Hainburger
Markt 2013 im Heimatmusem,
aufgenommen am 25.05.2013
|

Kugeliger Siderit als Teil einer Druse. Solch große
kugeligen Aggregate sind seh selten und diese Funde
stammen in der Regel aus dem 19. Jahrhundert;
Bildbreite ca. 9 cm |

Rundlicher Siderit in dem Basalt aus der bekannten
Mineralienhandlung von Wilhelm MAUCHER in München,
Bildbreite 10 cm.
|

Gabionen mit dem basaltischen Andesit und dazwischen die
Lesesteine aus Opal aus Steinheim, aufgenommen am 2004
erbauten Kindergarten.
Das sind sicher die einzigen Gabionen in Deutschland, in
denen Opale liegen!
aufgenommen am 24.05.2013
|

Derber, gebänderter und wachsartig glänzender Opal aus
einer Baustelle an der Mellenseestraße in Steinheim mit
einer beiderseitigen weißen Kruste und einem gebänderten
Inneren,
Bildbreite 13 cm
|
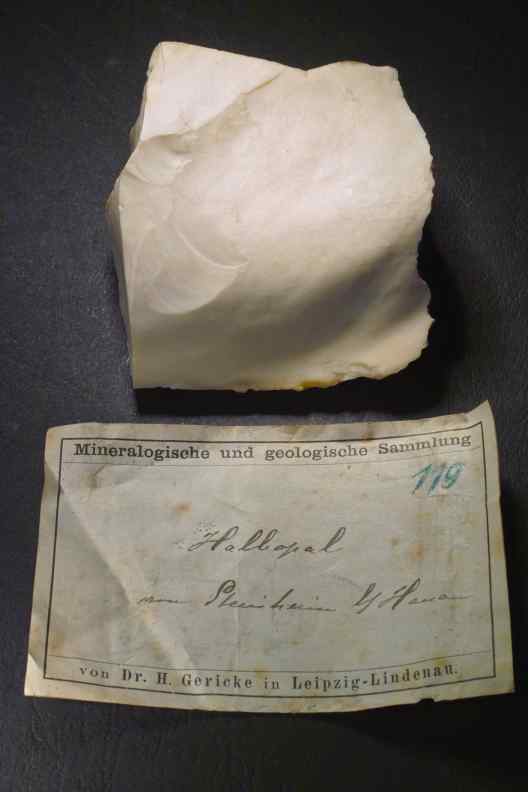
Weißer, strukturloser Opal aus Steinheim ("Halbopal", im
Unterschied zu den opaleszierenden Edelopalen, auch als
Milchopal oder Kascholong bezeichnet), wohl gefunden und
verkauft im 19. Jahrhundert,
Bildbreite 9 cm
|

Rundliche Siderit-Aggregate mit einer "Hammer-
schlag"-Oberfläche, verursacht durch die leicht
überstehenden,prismatischen Enden der Siderit-
Kristalle. Alter Fund aus Klein-Steinheim,
Bildbreite 4 cm

Prismatische Siderit-Kristalle, gefunden in einem
Steinburch in Klein-Steinheim
Bildbreite 4 cm
|

Siderit (Sphaerosiderit) mit einem Überzug aus "Dolomit",
- nach dem alten Sammlungszettel - , leider ließ
sich das nach einer Analyse nicht bestätigen, gefunden in
Klein-Steinheim,
Bildbreite 11 cm
|

Kugeliger Siderit mit einer dünnen Kruste aus Calcit als
Folge einer oberflächennahen Lage des Hohlraumes, gefunden
in Steinheim
Bildbreite 2 cm
|

Rundliche Siderit-Aggregate in einem Hohlraum im
basaltischen Andesit von Steinheim, Fund aus den 1960er
Jahren,
Bildbreite 4 cm
|
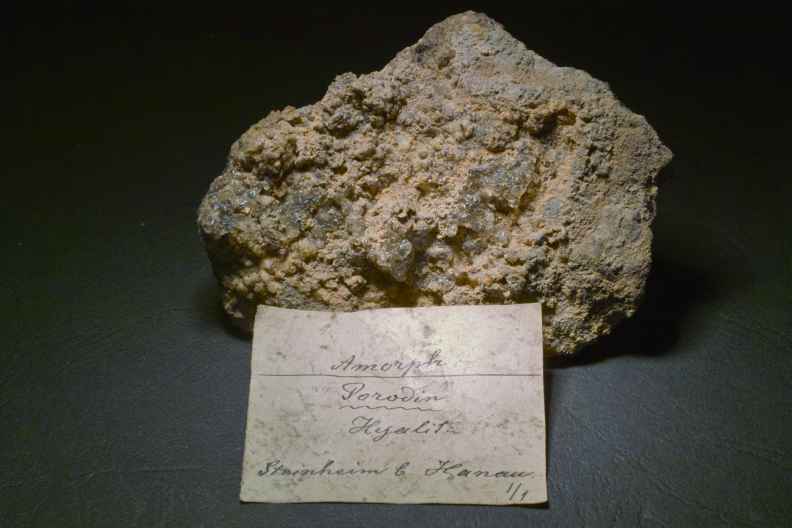
Farbloser Opal (Hyalit) auf einem stark alte rierten
basaltischen Andesit mit dem zugehörigen Sammlungszettel
aus dem 19. Jahrhundert,
Bildbreite 14 cm
|

Ausschnitt aus dem Foto links: der glasige und völlig
farblose Hyalit ist nur schwer erkennbar,
Bildbreite 2 cm
|

Schlieriger Opal aus dem anstehenden basaltischen Andesit
von Mühlheim. Man beachte die feinen Risse, die ein
zielgerichtetes Zuschlagen sehr erschweren,
Bildbreite 14 cm
|

Brauner, rissiger, sehr leichter Opal aus dem basaltischen
Andesit von Mühlheim. Vermutlich ist Eisenhydroxid das
braun färbende Mineral,
Bildbreite 13 cm
|

Heller, aber stark rssiger und sehr spröder Opal mit
Einschlüssen von Eisenhydroxiden aus dem basaltischen
Andesit von Mühlheim, angeschliffen und poliert,
Bildbreite 10 cm
|
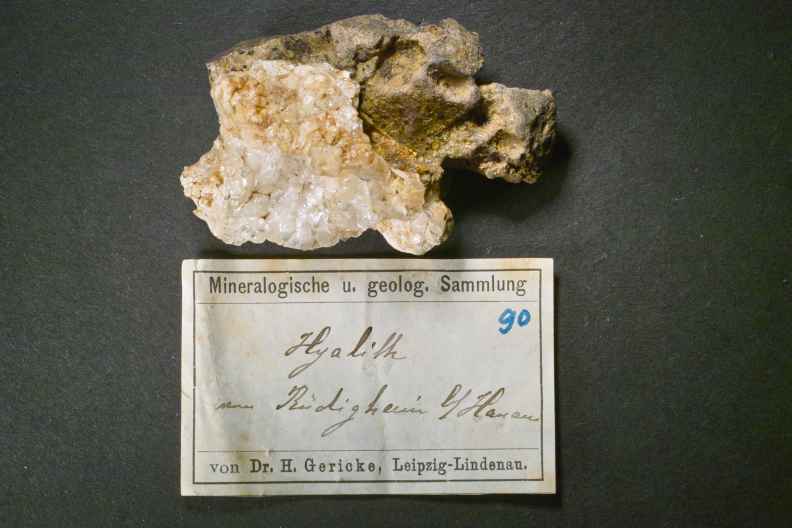
Farbloser Opal (Hyalith) auf einem blasigen, basaltischen
Andesit von Rüdigheim (Neuberg) nördlich von Hanau. Das
Grundgestein ist stark verwittert,
Bildbreite 10 cm
|

Außergewöhnlich großes Stück eines flachen Hohlraumes mit
den rundlichen Siderit-Aggregaten, gefunden um Steinheim
im 19. Jahrhundert
Bildbreite 14 cm
|

Zellig-strahliges Innere eines großen Siderit-Aggregates,
Bildbreite 6 cm
|
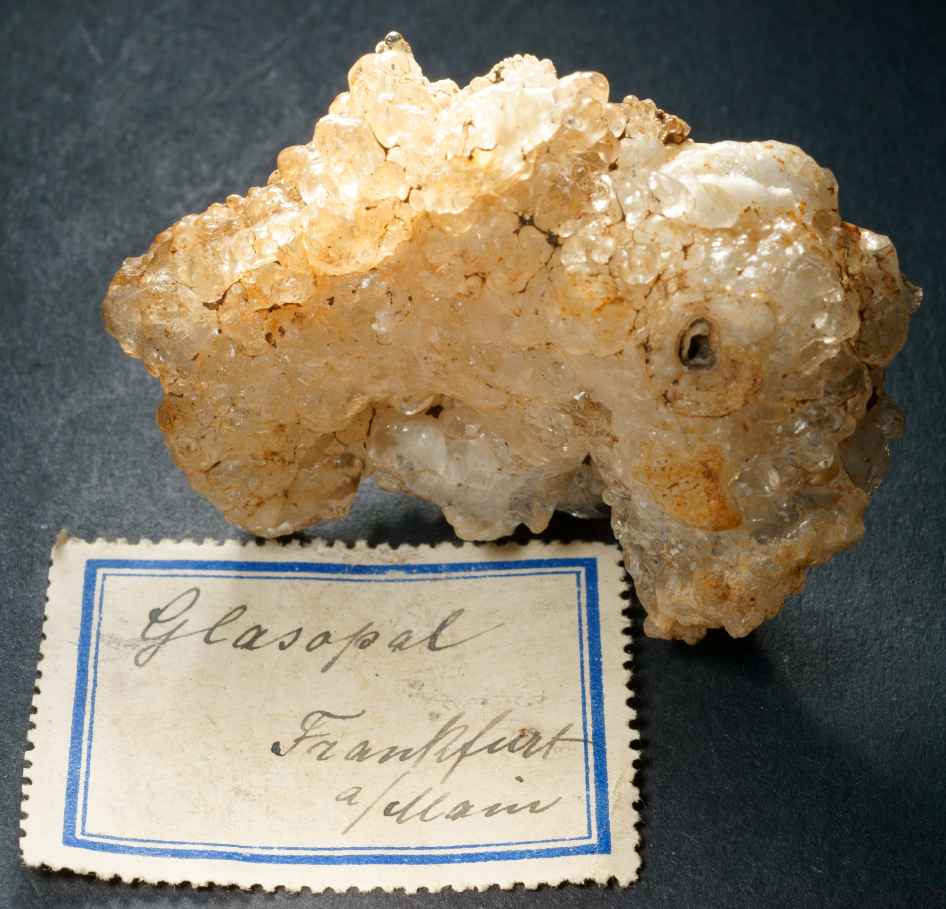
Farbloser Opal ("Hyalit") aus dem vulkanischen Gestein im
heutigen Stadtgebiet vorn Frankfurt (vermutlich im Bereich
des Grüneburgparks bzw. Palmengarten), gefunden im 19.
Jahrhundert,
Bildbreite 6 cm
|

Einzelne Siderit-Kristallaggregate auf einer dünnen Lage
eines Schichtsilkates, gefunden um 1970,
Bildbreite 3 cm
|

Nach dem Zettel sollte es "Halbopal" sein. Es handelt sich
aber eindeutig um einen Quarz in der Form eines Hornsteins
(Chalcedon) mit einer eindrucksvollen Schlagzwirbel.
Bereits die Schwere und die Härte sprechen gegen einen
Opal,
Bildbreite 12 cm
|

Flachlinsiger Hohlraum im Fels, überkrustet von einem
Schichtsilikat, darauf die braunen
Siderit-Kristallaggregate und stellenweise ein weißer
Nadelfilz aus Calcit
Bildbreite 13 cm
|
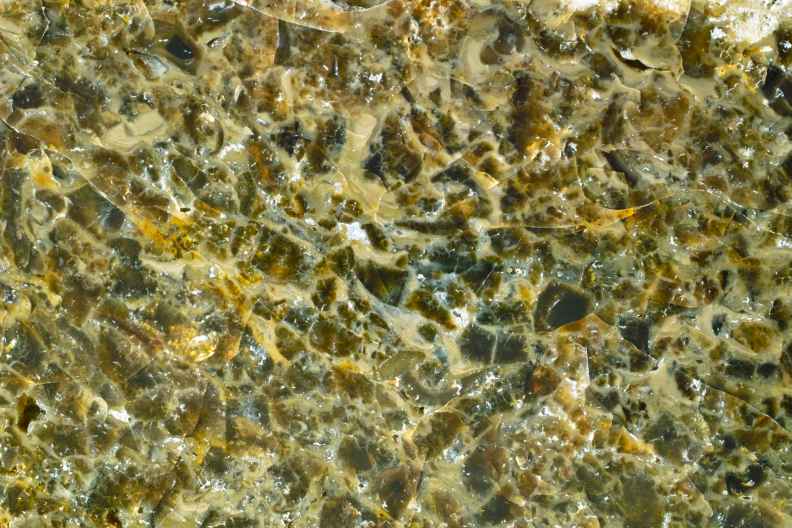
Merkwürdige Masse einer Brekzie aus braunem Opal,
verkittet durch helleren Opal. Gefunden im Steinbruch in
Dietesheim um 1983,
Bildbreite 5 cm
|

Ehemalige Gasblase mit den rundlichen Siderit-Aggregaten
und dazu noch ein weißes Mineral, welches noch nicht
bestimt wurde. Das Stück stammt aus einem oberflächennahen
Bereich des Steinbruchs von Klein-Steinheim,
Bildbreite 9 cm
|
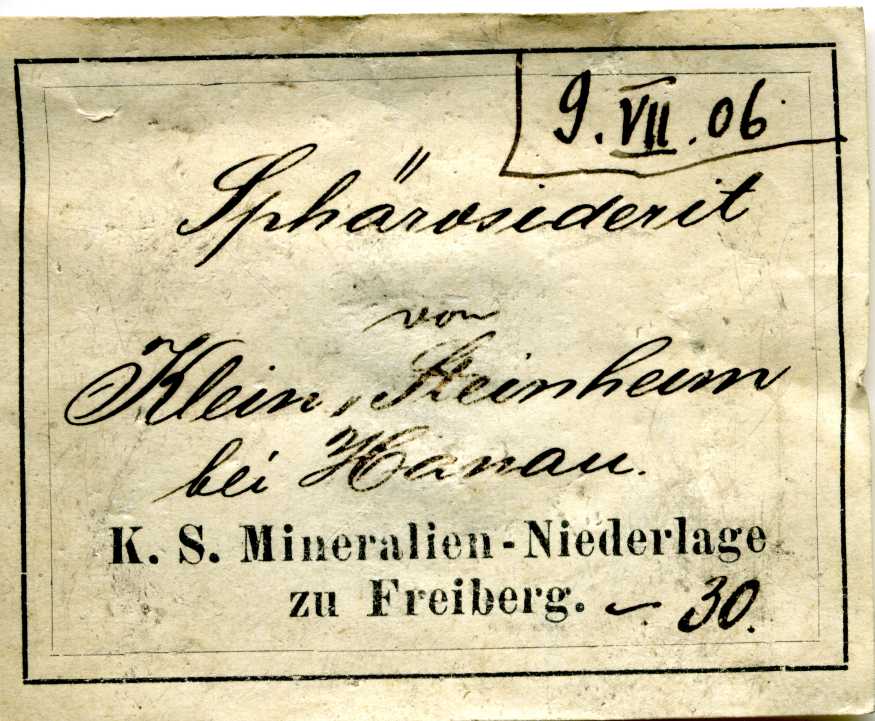
Sammlungszettel zum Stück links aus der Königlich
Sächsischen Mineralien-Niederlage zu Freiberg, aus der
Zeit zwischen etwa 1880 und 1920. Möglicherweise ist der
Vermerk oben rechts das Datum 09.7.1906
|

Opalbruchstücke aus sehr unterschiedlichen Varianten aus
einem aufgelassenen und alten Steinbruch zwischen
Steinheim (Hanau) und Dietesheim (Mühlheim a. Main). Über
die Genese der Opalscherben gibt es sehr unterschiedliche
Meinungen.
Bildbreite 22 cm
Eine natürliche Erklärung dieser Zerscherbung ist möglich.
Aber die Verteilung der Stücke im Verwitterungsschutt im
Boden lässt erhebliche Zweifel hegen, so dass man annehmen
kann, dass es sich um Abfall von neolithischen
Bearbeitungsversuchen handelt.
|

Gebänderter Opal als scharfkantiger Abschlag von einem
größeren Stück, aus alten Steinbruch zwischen Steinheim
(Hanau) und Dietesheim (Mühlheim a. Main)
Bildbreite 5 cm
|

Sehr unscheinbarer Opal mit Eisenhydroxid durchstäubt. Das
Stück stellt eine Kluftfüllung dar, bei dem die eckigen
Vulkanit-Klasten weggelöst wurde, so dass nur noch der
relativ schlecht lösliche Opal übrig geblieben ist. Aus
einem alten Steinbruch zwischen Steinheim (Hanau) und
Dietesheim (Mühlheim a. Main),
Bildbreite 19 cm
|

Möglicher Montmorillonit als unscheinbare Krusten auf dem
Siderit. Aus der Mineralienhandlung von Arthur KRUSCHE G.
m. b. H. in München
Bilbreite 8 cm
|
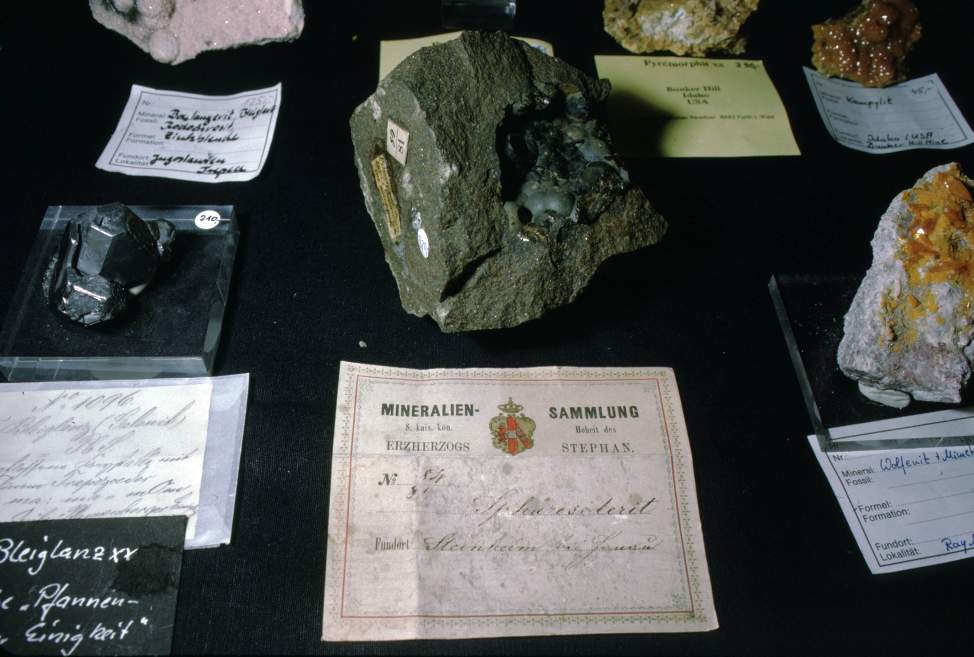
Mineralien-Börse in Aschaffenburg am 08.05.1993: Auf dem
Tisch eines Händlers lag eine Stück des basaltischen
Andesits mit einem Hohlraum, ausgekleidet mit Siderit in
der kugeligen Form, dazu der gedruckte Zettel aus der
Sammlung vom Erzherzog STEPHAN.
|
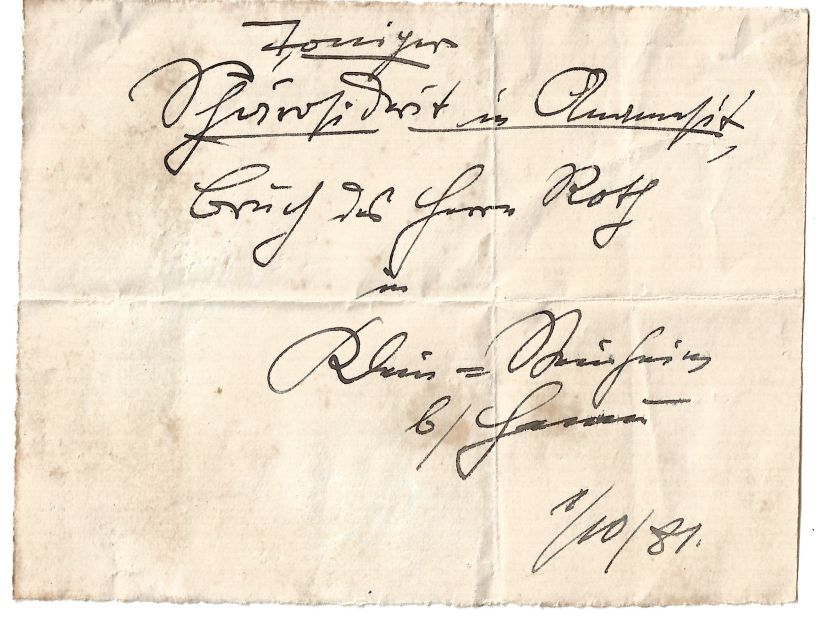
Gefalteter Sammlungs-Zettel mit schwer lesbarer
Sütterlin-Handschrift: „Toniger Shpärosiderit in Anamesit
Bruch des Herrn Rolf in Klein=Steinheim b[ei] Hanau
1/10/[18]81.“.
Die Lage des Steinbruches ist mir nicht bekannt. Das
zugehörige Stück ist sehr unscheinbar.
|

Radialstrahliger Siderit in einem Hohlraum im stark
verwitterteten "Basalt" (Tholeiit). Gefunden um 1977 von
Reinhold FRANZ(†), Obernau,
Bildbreite 4 cm
|
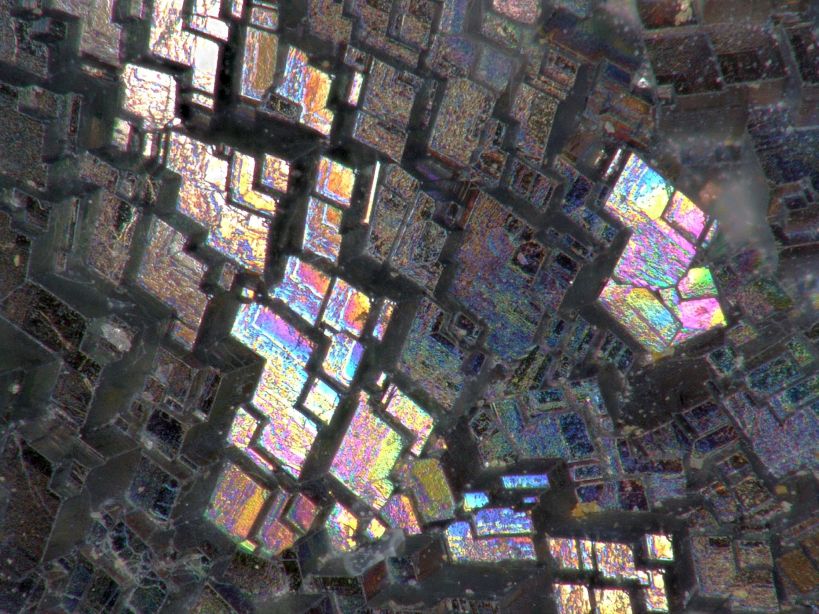
Rhomboedrische Siderit-Kristalle mit einem dünnen Überzug
aus Opal, was die bunten Interferenz-Farben an der
Oberfläche verursacht,
Bildbreite 1,5 mm
|

Nicht selten, aber kaum gesammelt: Das braune
Schichtsilikat Montmorillonit überzieht das Innere einer
ehemaligen Gasblase;
Bildbreite 3 mm
|

Selbst dort wo der gemeine Opal in großen Stücken und
verbreitet vorkommt, ist der schwer zu sehen. Hier liegt
der Bauaushub in Steinheim und nach einem Regen lugt ein
1,33 kg schwerer Opal aus der felsigen Erde. So etwas ist
auch deshalb schwer erkennbar, weil ähnlich farbige
Ziegelsteine oder Fliesen und andere Baustoffe irritieren
können;
aufgenommen am 22.04.2023.
|

Das gereinigte Opalstück aus dem Foto links. Der rissige
Opal ist an der Oberfläche weiß alteriert. Das Stück wiegt
1,33 kg. Es stammt aus dem Verwitterungsschutt über dem
basaltischen Andesit. Der Opal ist natürlich zerscherbt
und wird meist von einem zähen Ton begleitet - was die
Reinigung schwierig macht;
Bildbreite 17 cm.
|

Die oft dunklen, muschelig brechende Opale besitzt auf der
Außenseite eine etwa 3 mm dicke, weiße Rinde. Diese ist
stumpf und deshalb fällt der Kontrast zum glatten Bruch
des Opals stark auf;
Bildbreite 15 cm.
Hinweis:
Der farblose Opal (Hyalith) kommt in diesem Umfeld nicht
vor.
|
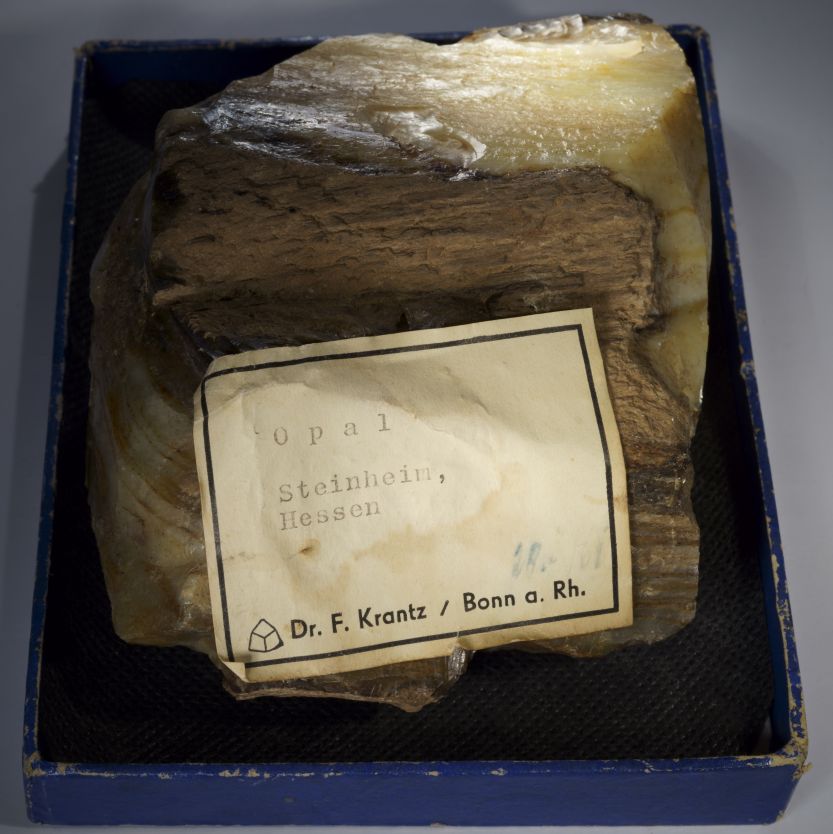
Großes Stück Opal mit einer dunklen "Rinde" und frischen
Bruchflächen aus Steinheim mit einem aufgeklebten
Sammlungszettel von der Fa. Dr. F. Krantz aus Bonn a.
Rhein;
Bildbreite 11 cm.
|

Weißrindiges, großes Stück eines Opal von 4,25 kg Masse
mit geologisch alten muschelförmigen Abplatzungen, der den
Blick auf das dunkle Innere frei gibt.
Solche Stücke sind selten, weil die frostempfindlichen
Opale in der Regel im Boden zerschwerbt sind. Das Stück
stammt aus einer Baugrube an der Ludwigstr. in
Steinheim.
|

Kein Opal. Klüftiger, inhomogener, brauner Chalcedon aus
einer Sandgrube am Geilenberg zwischen Steinheim und
Mühlheim a. Main aus einer älteren Mineralien-Sammlung.
Der ausgeaperte Stein ist extrem gut und glatt durch
Windschliff poliert, so dass es "speckig" glänzt;
Bildbreite 13 cm.
Die Genese dieser Chalcedone ist nicht geklärt. Es könnte
sich um eine Art Tertiärquarzit handeln. Dies kann erst
nach weiteren Untersuchungen angesprochen werden.
|

Drusenfüllung (ehemalige Gasblase) aus radialstrahligem
bis kugeligem Siderit aus dem basaltischen Andesit von der
Baustelle der Mainverlegung ("Steinheimer Mainknie")
zwischen Großauheim und Steinheim am Main. Die Baustelle
bestand 1972/73 und wurde damals nur von wenigen
Mineraliensammlern besucht. Deshalb sind nicht viele
Belegstücke erhalten. Das Sammlungsstück stammt aus der
Mineraliensammlung von Fridolin BERNHARD, Glattbach;
Bildbreite 8 cm.
|

Pseudomorphose von braunem Goethit nach Siderit aus der
Mainknie-Baustelle zwischen Großostheim und Steinheim. Das
Stück wurde von Fridolin BERNHARD, Glattbach, gefunden;
Bildbreite 5 cm.
|
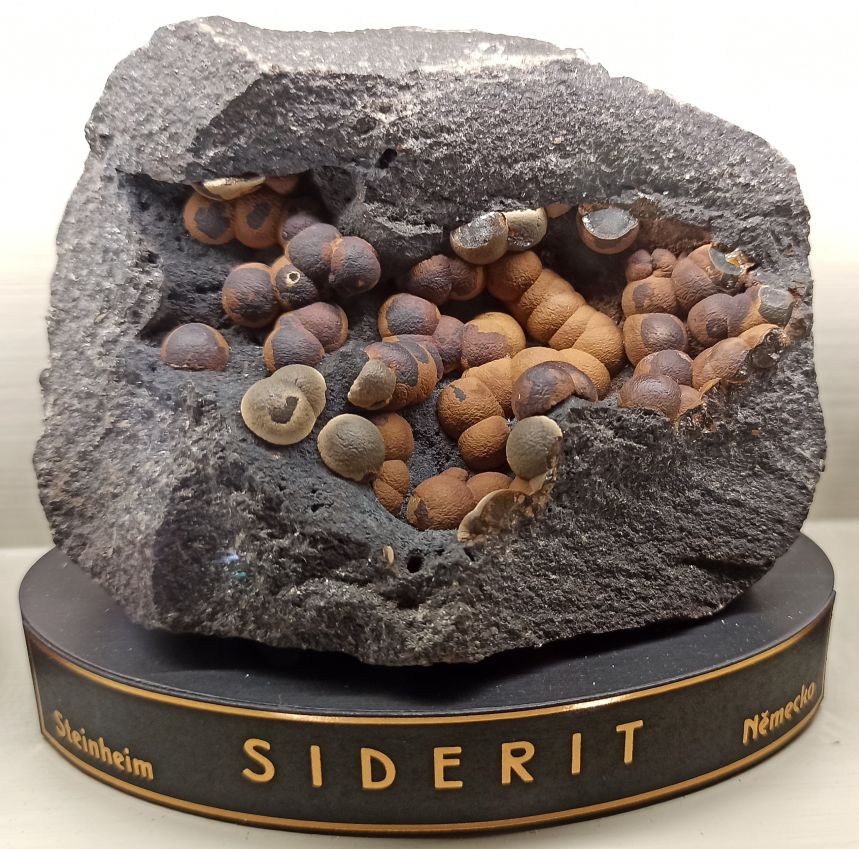
Auch im alten und berühmten Nationalmuseum von Prag wird
hellbrauner Siderit aus Steinheim auf einem schwarzen
Sockel mit goldener Schrift präsentiert;
Bildbreite etwa 15 cm (Foto Max RETTINGER 2024).
|
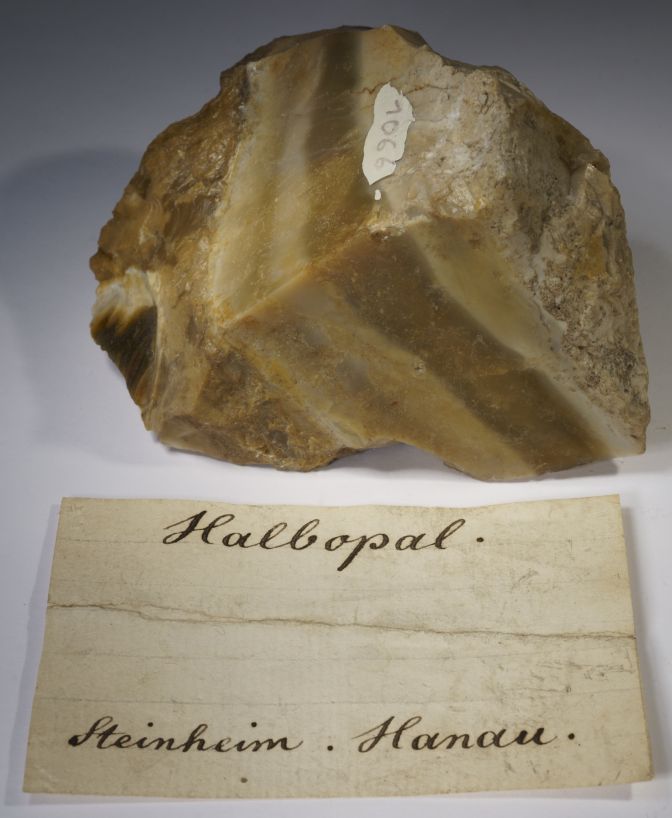
Gebänderter Opal ("Halbopal") aus Steinheim bei Hanau mit
einem alten Sammlungszettel;
Bildbreite 9 cm.
|

Weißlicher Opal mit aufgestreuten Opal-Körnchen;
Bildbreite 3,5 cm.

Der Drusenraum ist nach der Bildung des braunen Siderits
ist von weißem Opal ausgefüllt;
Bildbreite 3 mm.
|
|
Solche Stücke sind heute kaum mehr auffindbar, weil es keine
Steinbrüche mehr gibt, in denen der basaltische Andesit gefördert
oder auch nur frei gelegt wird. Halden oder Reste der Abaue sind
überwachsen und damit nicht mehr zugänglich. Nur im Bereich von
den wenigen und in der Regel nur punktuellen Baustellen sind
praktisch solche Funde noch möglich - siehe oben. Da der Aushub
wegen der beengten Verhältnisse schnell abgefahren und deponiert
wird, hat man wenige Gelegenheiten.
Auf dem Mineralienmarkt werden ab und zu Stücke angeboten. So
wurde in München 2005 ein apfelsinengroßes Stück Basalt mit einer
Druse mit rundlichem Siderit von Steinheim mit einem schönen
Sammlungszettel von Erzherzog Stephan für 650 € verkauft!
Verwendung in der Steinzeit?
Bei GRIES (1990) wird von Funden aus dem Raum zwischen Mühlheim
und Steinheim beschrieben, dass man im Neolithitkum den lokal
vorkommenden "Chalcedon" zur Herstellung von Werkzeugen
verwendet hat. Dazu ist anzumerken, dass die Artefakte der
fotographischen Abbildungen (auch auch das Titelbild auf dem
Einband) in etlichen Fällen sicher kein Chalcedon, sondern Opal
sind. Echte Chalcedonfunde aus den basaltischen Andesiten sind
bisher nicht bekannt und auch nicht belegt. Die Windkanterfunde
aus Chalcedon am Gailenberg zwischen Steinheim und Lämmerspiel
liegen nicht in einer primären Lagerstätte, soden sind
verlagert; die Quelle ist nicht bekannt - siehe Bild oben.
Der gewöhnliche und in großen Mengen vorkommende Opal ist sehr
spröde und deutlich weicher (und leichter) als ein Chalcedon, so
dass eine Verwendung vom Menschen wohl nur in Notfällen
erfolgte. Hätte sich das Material gut geeignet, hätten die
Nutzer sicher einen Abbau bzw. Bergbau begonnen, wie dies von
anderen Vorkommen bekannt ist. Opalscherben wie sie bei GRIES
(1990) abgebildet sind (Abb. 11, 26, 44, 45, 46) sind in den
Steinbrüchen gefunden worden, da der Opal bereits im Anstehenden
erheblich zerbrochen ist. Dies kann man einerseits durch die
Überlagerung und den damit verbundenen Druck als auch mit dem
Frost im Periglazial bzw. nahe an der Oberfläche durch den
rezenten, winterlichen Frost erklären. Der Opal ist
wasserhaltig, so dass bereits geringe Temperatirdifferenzen
genügen, um ein Platzen zu erreichen. Umgekehrt ist auch der
Wasserverlust durch Austrocknen ein Grund für einen Rissbildung.
Einzig die Einlagerung von Fremdmineralien wie Eisenhydroxiden
usw. machen den Opal etwas resistenter, so dass die großen
Stücke braun aussehen und von stumpfem Glanz sind.
Trotzdem wäre es denkbar, dass man den Opal z. B. als sehr
scharfes "Messer" zum Schneiden verwandt hat. So könnte man
zwanglos die vielen scharfkantig zerschrebten Abschläge
erklären, die oft früher an einem Platz zu finden war. Eine
Prüfung ist schwer, weil viele solcher Stellen dem
Steinbruchbetrieb zum Opfer gefallen sind.
Opale aus Steinheim und Umgebung sind sicher nicht selten. Sie
wurden in den vielen Steinbrüchen im 19. und 20. Jahrhundert ganz
nebenbei gewonnen und gingen zu einem erheblichen Teil in den
Mineralienhandel. Praktisch alle älteren Mineraliensammlungen der
Museen und Universitäten weltweit besitzen aus Steinheim
Opal-Proben, meist als faustgroße, schön zurecht geschlagene
Stücke. Die aktuellen Publikationen zum Opal behandeln in der
Regel nur die Edelopale, opalisierte Fossilien oder bedeutende
historische Funde in Verbindung mit einer Verarbeitung. Dazu hat
sich ein umfangreiches Vokabular für die unterschiedlichen
Varietäten gebildet: Boulder Opal, Chloropal, Dendritenopal,
Edelopal, Feueropal, Gemeiner Opal, Geysirit, Holzopal, Hyalit,
Hydrophan, Kascholong, Kieselgur, Leoparden-Opal, Matrixopal, Pipe
Opal, Potch, Prasopal, Seam Opal, Weltauge, ... und wenn man
die englischen Begriffe hinzufügen würde, hätte man eine noch
längere Liste (ECKERT 1997:161ff). Edelopale werden wie die
Edelsteinen üblich in ct (Karat), also 0,2-g-Einheiten gemessen.
Bei den Opalen aus Steinheim reicht indes eine Küchenwaage, denn
man kann die Gewichte in Gramm angeben. Das größte Stück, welches
oben abgebildet ist, wiegt 2,096 kg und ist damit für einen
leichten Opal schon ein großer Stein; da es sich um ein Bruchstück
handelt, muss es ursprünglich sehr viel größer gewesen sein; da
die Bruchflächen allseits frisch sind, kann man auf mind. 10 kg
extrapolieren.
In einer Liste bei ECKERT (1997:156) wird der größte Opal derWelt
mit 130 lb (entspricht 59 kg) angegeben, ein Stein aus dem Virgin
Valley, Nevada, USA. Der Opal ist hier die Versteinerungssubstanz
für ein fossiles Holz von ca. 90 cm Länge. BAUER (1909:471)
berichtet, dass im Januar 1889 in den Opalgruben von Cervenica
(Slowakei) eine kompakte Opalmasse von etwa 200 kg gefunden wurde.
Darin waren jedoch nur teilweise Edelopal ausgebildet.
Dieses Gewicht wird in Steinheim locker überboten, denn bei Bau
einer Fabrikhalle wurde ein Felsblock aus Opal mit einem
geschätzten Gewicht von mehr als 600 kg geborgen. Es ist damit
sicher der größte Opal aus Deutschland, wenn nicht von ganz
Europa. Da der Felsblock aus der Baugrube mit dem Bagger geborgen
wurde und bereits einige Jahre im Freien der Witterung ausgesetzt
war, sind reichlich frische Bruchflächen zu sehen. So kann man
davon ausgehen, dass der Fels ursprünglich noch erheblich größer
war.

Größter Opal Deutschlands mit einem Geologenhammer als Maßstab,
aufgenommen am 07.07.2014
Steine in Steinheim -
Exkursion mit dem Geschichtsverein Steinheim am
13. Juni 2014
Nach einem einführenden Vortrag der Entstehung von
Vulkanismus und Basalten unter dem Titel "Vulkanausbrüche,
Flutbasalte und die Steinheimer Basaltdecke" durch das
Referentenduo Prof. Dr. Martin Okrusch aus Würzburg und
Joachim Lorenz aus Karlstein im Marstall des Steinheimer
Schlosses am 1.4.2014 gab es die Praxis am 13.6.2014.
Beginnend im alten Steinbruch des Premier Hotels Best
Western Villa Stokkum gab es einen ca. 1,5 stündigen
kurzweiligen Rundgang mit Joachim Lorenz durch die
steinreiche Altstadt von Steinheim (Hanau).
 
Im Steinbruch-Garten des Hotels Villa
Stokkum gab es eine Begrüßung durch das Hotel (Frau
Gabriele Christ), welche eine extra geschaffene
spritzig-feurige "Lavalimo"
(Wassermelone, Chili und Sprite) und einen essbaren, sehr
leckeren "Steinheimer Basalt" (Granatsplitter mit weißem
Schokoladenmousse, Sonnenblumenkerne und Bisquit)
den Teilnehmern der Exkursion servierte.
Nach der kulinarischen Einstimmung gab es einen Rückblick
auf den Vortrag und dann konnte das gehörte an der Felswand
angewandt werden. Hier wurde auf den Gehalt an Blasen, die
Klüftung und den Verwitterungsgrand hingewiesen. Alternativ
gab es einen kleinen Tisch mit unterschiedlichen
vulkanischen Gesteinen (angeschliffen und poliert) zum
Anfassen und Begreifen. Mit dem Wissen ging es durch die
Gassen der Altstadt, wo weitere vulkanische Gesteine
(Basalte, Rhyolithe) erläutert wurden. Dabei wurden auch
Hinweise auf Erhaltungsprobleme, z. B. mit dem Sandstein,
und Steinmetzfertigkeiten vermittelt. Zum Abschluss gab es
einen kleinen Imbiss im Umfeld das Schlosses. Besonders
wurden die Unterschiede zwischen dem Steinheimer Gestein und
den modern verwandten Basalten heraus gearbeitet, die als
Pflastersteine, säulige Felsen und Mauersteine in den
Bestand eingebaut werden, da es keinen aktiven Steinbruch in
dem basaltischen Andesit gibt.

Der basaltische Andesit von dem Felsen der
Villa Stokkum unter dem Mikroskop mit den
Interferenzfarben (Dünnschliff, gekreuzte Polarisatoren,
Bildhöhe 5 mm). Man
erkennt gleichkörnige Leisten von Plagioklas (oft
verzwillingt), Klinopyroxen (Verwachsung von Augit und
Pigeonit), etwas Olivin, Ilmenit und Apatit; die ehemals
glasige
Grundmasse ist in ein Schichtsilkat zersetzt. In den
Zwickeln ist auch reichlich Goethit in nadeligen
Kristallen zu erkennen; dies sollteaus ehemaligem Siderit
hervorgegangen
sein.Die tiefschwarzen Gesteinsfarbe beruht auf dem hohen
Gehalt an Goethit und Ilmenit. Ein auffallendes Merkmal
ist das völlige Fehlen von größeren Kristallen.

Die blasige Variante des basaltischen
Andesits wurde von den Steinbrucharbeitern des
19. und frühen 20. Jahrhunderts als "Lungstein"
bezeichnet, vermutlich weil das poröse
Gefüge an das blasige Lungengewebe von großen Säugetieren
erinnert. Diese Form
entsteht, wenn die Lava reichlich Gase führt und der Druck
im Gestein kleiner ist als
der Gasdruck, so dass sich Blasen bilden können die bei
der Erstarrung des Gesteins
erhalten bleiben. In geologischen Zeiträumen werden diese
meist mit neu gebildeten
Mineralien wie Quarz, Achat und Zeolithen gefüllt,
Bildbreite 7 cm
|
Bausteine in Steinheim (Hanau)
Der basaltische Andesit wurde in und um Steinheim gebrochen und
vielfältig verwandt:
- Bausteine seit der römischen Zeit
- als Mühlsteine für Getreidemühlen (siehe römische Funde
im
- Steinheim)
- Werksteine für Treppen, Konsolen, Podeste, ...
- Pflastersteine
- Kleinschlag (Schotter, Schrotten)
- in der Gartengestaltung
- Poller
Aber nicht alles was nach schwarzen Steinen ("Basalt") aussieht
ist dann auch der basaltische Andesit aus Steinheim. Da heute
keine Felsgewinnung mehr erfolgt, wurden Erweiterungen und
Ausbesserungen mit Basalten aus dem Vogelsberg und aus der Eifel
ausgeführt.


Die Spitze des Bergfrieds am Schloss in Steinheim besteht aus dem
Andesit (zumindest teilweise), ist aber schwarz
übermalt und die Fugen sind auch gemalt. Die Herstellung aus dem
Fels als Werkstein wäre wohl zu aufwändig
gewesen,
aufgenommen am 19.10.2014

Der Galgen von Steinheim, gemauert aus den Lesesteinen des Basalts
aus der Umgebung, erstmals erwähnt 1579. Die letzte Hinrichtung
wurde im 18. Jahrhundert vollzogen;
aufgenommen am 19.04.2025.
Bausteine in Großauheim (Hanau)
Der Basalt (gemeint ist immer der basaltische Andesit) wurde im
Raum Hanau an vielen Stellen wenig zugerichtet vermauert. Als
Werkstein fand das Gestein hingegen nur sehr eingeschränkt
Verwendung (STEINDLBERGER 2003:82f; hier als Tholeiit-Basalt
angesprochen). Dabei gab es bei genauerem Hinschauen eine
erstaunliche Vielfalt an unterschiedlichen Varianten, die alle aus
den bekannten Steinbrüchen um Steinheim bzw. Hanau stammen. Wenn
man sich die Charakteristika einmal eingeprägt hat, dann ist das
Material sehr gut zu erkennen:
- dunkler, dichter Basalt
- hellbraune (verwitterte) Basalt-Form
- dunkle, blasige (leichte) Variante mit cm-großen Hohlräumen
- helle, weil verwitterte blasige Variante
- dichter Basalt mit blasigen Entgasungskanälen
Diese Gesteine sind in Großauheim in vielen Häusern und der
Kirche verbaut.

ehemaliges Gasthaus "Neue Krone" in Großauheim, im 19. Jahrhundert
aus lokalem Basalt erbaut;
aufgenommen am 15.09.2012.


Aus Basalt (mit Entgasungskanälen) gehauene Säulen vor Sandstein
an der Kirche in Großauheim; daneben die
Außenmauer der Kirche in Großauheim aus dem vielfältigen Basalt
von Steinheim,
aufgenommen am 15.09.2012.
Bausteine in Wilhelmsbad (Hanau)



Das weithin sichtbare Bismarkdenkmal, daneben die Pyramide mit dem
herrschaftlichen Grab (aufgenommen am 30.03.2014) und eine
Nahaufnahme des basaltischen Andesits, der infolge der
Spaltflächen der Plagioklase im frischen Zustand glänzt. In den
kleinen
Blasenhohlräumen ist neben dem Feldspat noch etwas Siderit zu
sehen,
Bildbreite 10 cm.
Aus dem nahe gelegen, noch 1954 im Betrieb befindlichen Steinbruch
mit einer etwa 10 m hohen Wand beschreibt SCHAEFFER (1955:305) den
Fund eines im vulkanischen Gestein steckenden Erdklumpen aus dem
Jahr 1947, in dem sich die zu Braunkohle veränderten Reste von
Bäumen befanden. Belegstücke sind leider nicht bekannt.
Bausteine für Schloss Philippsruh (Hanau)


Am, im und um das Schloss Philippsruhe sind ebenfalls größere
Mengen des vulkanischen Gesteins verbaut worden (aufgenommen am
25.12.2017). Insbesondere an den Umfassungsmauern des Parks und
der Orangerie sind die Steine unverputzt in den Mauern zu sehen.
Im
rechten Foto ist als Anfahrschutz an der Zufahrt zur ehemaligen
Orangerie ein rundlicher Block mit einer Massen von geschätzt 2 t
mit den
ganz typischen Abschalungen abgelegt worden. Solche Formen
entstehen in Feuchtklimaten. Die hier verbauten Steine stammen
vermutlich
aus dem Steinbruchareal im heutigen Park von Wilhelmbad. Dabei
kann man wie z. B. Steinheim sehen, dass man Steine aller Größen
und
auch aller Qualitäten vermauert hat. Dieser Umstand führt heute zu
Problemen, da die bereits im Steinbruch angewitterten Steine im
Verband
schnell absanden und Löcher hinterlassen.
Bausteine in Klein-Auheim (Hanau)

Das größte Bauwerk aus dem Untermain-Trapp (basaltischer Andesit)
wurde 1746 unter Lothar Franz von Schönborn errichtet: Die 3,8 km
lange Umfassungsmauer der Alten Fasanerie. Sie umschließt eine
Fläche
von 107 Hektar und wird heute als Wildpark Alte Fasanerie genutzt.
Wenn man von einer durchschnittlichen Höhe von 2 m und einer Dicke
von 0,4 m ausgeht, dann brauchte man etwa 7.600 Steine und Mörtel,
was zu dieser Zeit einen erheblichen Aufwand bedeutete. Vermutlich
wurde das Gesteinsmaterial direkt aus der Fasanerie gewonnen, so
dass
das Gelände auch als alter Steinbruch gelten kann.
Im Ort Klein-Auheim selbst ist das umgangssprachlich als
"Basalt"
bezeichnete Gestein kaum dominierend als Baustein verwandt worden.
Kleinpflaster in Stockstadt am Main

In weiten Teilen von Stockstadt wurden wohl in den 1950er und
1960er
Jahren in den Rinnsteinen zwischen Straße und Gehweg ein
Kleinpflaster
aus dem Untermain-Trapp verwandt. Man erkennt die Steine an den
Entgasungkanälchen, die in sehr unterschiedlicher Richtung die
Steine
durchsetzen. Die Basaltsteine von anderen Vorkommen dazwischen
sind schwärzer, glatt und führen hin und wieder auch größere
Einschlüsse,
aufgenommen am 25.05.2014.
Mauern in Schlüchtern

Schlüchtern, Mauer des Klosters aus dem Flutbasalt, der auch in
Steinheim
ansteht.
aufgenommen am 27.08.2009
Römerkastell Saalburg (Rekonstruktion)


Für den Nachbau der Saalburg wurden unter anderen Werksteinen auch
basaltische Gesteine aus dem nahe Vogelsberg verwandt,
wie man sehr schön an dem Türschweller sehen kann.
aufgenommen am 20.06.2014
Bad Nauheim

Auch die Kirche in Bad Nauheim ist aus dem basaltischen Andesit
erbaut,
wie man an den blaenreichen Zonen erkennen kann. Wo er Steinbruch
liegt,
der die Werksteine geliefert hat, konnte ich nicht in Erfahrung
bringen,
aufgenommen am 26.09.2017

Der Schuckhardt-Brunnen ist ebenfalls aus dem Basalt mit den
charakteristischen
Blasenzonen erbaut,
aufgenommen am 26.09.2017
Hanau

Die Niederländisch-Wallonische Kirche wurde im 17. Jahrhundert aus
den Basalt-Brocken gemauert. Meist ist es ein balsiger Basalt, wie
er
hier oberflächennah anstand;
aufgenommen am 13.09.2025
Literatur zu Steinheim & Dietesheim:
Autorenkollektiv (1996): Opal Das edelste Feuer des
Mineralsreichs.- extraLapis No. 10, 96 S., zahlreiche,
auch farb. Abb., Skizzen, Karten, Tabellen, [C. Weise Verlag]
München.
BAUER, M. (1909): Edelsteinkunde Eine allgemein verständliche
Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung
der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben,
für Mineralogen, Edelsteinliebhaber, Steinschleifer, Juweliere.-
766 S., mit 21 Tafeln im Farbendruck, Lithographie und Autotypie
sowie 115 Abb. im Text, [Chr. Herm. Tauchnitz] Leipzig.
BETZ, V. (1972): Sphärosiderit von Frankfurt am Main.- Aufschluss
23, S. 144, 1 Abb., [VFMG] Heidelberg.
ECKERT, A. E. (1997): The World of Opals.- 448 p., 57 Fig., 22
Color Plates, [John Wiley & Sons, Inc.] New York.
FEIT, S. (1999): Basaltwerke. Monumentale Architektur in Hessen.-
Abschlußarbeit zur Erlangung des Titels Magistra Artium im
Fachbereich 09 (Klassische Philologie und Kunstwissenschaft) der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 124 S., mit
69 Seiten Abb. Auf Tafeln im Anhang, [Eigendruck] Bad Soden.
GREGOR, H.-J. (1995): Die pliozäne Flora von Mühlheim bei
Offenbach am Main.- Jber. wetterau. ges. Naturkunde 146 - 147,
S. 87 - 167, Hanau.
GRIES, H. & SEIDENSCHWANN, G. (1987): Die "Lämmerspieler
Artefakte". Neue Erkenntnisse über ein umstrittenes
altsteinzeitliches Inventar aus dem ehemaligen Museum des
"Offenbacher Vereins für Naturkunde".- 87. Bericht des
Offenbacher Vereins für Naturkunde, S. 3 – 38, 21 Abb., Hrsg. vom
Offenbacher Verein für Naturkunde [Heyne OHG] Offenbach.
GRIES, H. (1990): Frühe Spuren Die Steinzeit in der Landschaft
Mühlheim am Main.- Zur Geschichte der Stadt Mühlheim Band 9, 180
S., 167 teils farb. Abb., hrsg. Von der Geschichtsabteilung des
Verkehrs- und Verschönerungsvereins e. V. Mühlheim a. Main
[Druckerei Wilheim & Adam] Heusenstamm.
HÄUSER, F. (1954): Die Hanau-Seligenstädter Senke und ihre
Randgebiete. Topgraphie, Geologie und Tektonik.- Hanau Stadt und
Land Beiheft, 62 S., 3 Abb. im Text, 1 Tab., VIII Tafeln im
Anhang, 1 gefaltete Karte, Hrsg. vom Hanauer Geschichtsverein
[Verlag des Hanauer Geschichtsvereins] Hanau.
KEINER, M. (1998): Hundert Jahre Krebs´sche Steinbrüche. Eine
Dietesheimer Firmengeschichte.- S. 157 - 240, 3 Farb- und 41
SW-Abb., 1 Karte - in Krug, R. (1998): Mühlheim am Main aus
industrie-archäologischer Sicht - Strukturwandel - . Zur
Geschichte der Stadt Mühlheim Band 14, 300 S., einige farb., viele
SW-Abb., 1 ausklappbare Karte im doppelten Format, Tab., Hrsg. vom
Geschichtsverein Mühlheim am Main e. V. [Druckstudio Mühlheim]
Mühlheim.
KRUG, R. (1998): Mühlheim am Main aus industrie-archäologischer
Sicht - Strukturwandel - . Zur Geschichte der Stadt Mühlheim Band
14, 300 S., einige farb., viele SW-Abb., 1 ausklappbare Karte im
doppelten Format, Tab., Hrsg. vom Geschichtsverein Mühlheim am
Main e. V. [Druckstudio Mühlheim] Mühlheim.
LEONHARD, C. C. (1811): XXVI Bemerkungen über das bei Steinheim,
unweit Hanau vorkommenden, ehemals für strahligen Braunkalk
gehaltende Mineral.- Der Gesellschaft Naturforschende Freunde zu
Berlin Magazin für die neuesten Entdeckungen der gesammten
Naturkunde 5. Jahrgang, S. 334 - 335,
[Realschulbuchhandlung] Berlin.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 144, 598, 793f.
LORENZ, J. (2018): „Sphaerosiderit“ aus Steinheim - NOBLE Magazin
Aschaffenburg, Ausgabe 04/2018, S. 18 - 21, 12 Abb.,
[Media-Line@Service] Aschaffenburg.
NICKEL, W. (1961): Das Basaltvorkommen von Mühlheim/Dietesheim.-
Aufschluss 12, Heft Nr. 4/April 1961, S. 101 - 103,
Göttingen.
RENFTEL, L.-O. (1983): Die Basaltdecke des "Maintrapps" von
Steinheim am Main.- Aufschluß 34, S. 407-412, Heidelberg
RENFTEL, L.-O. (1993): Vorkommen und Genese von Opal CT bei
Hanau-Steinheim (Hanauer Becken, Hessen) - ein Beitrag zum
derzeitigen Kenntnisstand.- Jber. wetterau. ges. Naturkunde 144
- 145, S. 79 - 87, Hanau.
RENFTEL, L.-O. (1995): Verbreitung und Ausbildung pliozäner
Ablagerungen in der Umgebung von Hanau.- Jber. wetterau. ges.
Naturkunde 146 - 147, S. 55 - 70, Hanau.
RENFTEL, L.-O. (1998): Geologische Karte von Hessen 1:25000 Blatt
5819 Hanau mit Erläuterungen.- 2. neu bearb. Aufl., 278 S., 42
Abb., 18 Tab., 2 Beil., [Hess. Landesamt f. Bodenforschung]
Wiesbaden.
SCHAEFFER, A. (1955): 1. Steinbruch von Wilhelmsbad. „Wie kann man
im Buch der Natur lesen“.- S. 303 – 307, 1 Abb. - in Hanauer
Geschichtsverein (1955): Hanau Stadt und Land. Ein Heimatbuch für
Schule und Haus.- 512 S., einige SW-Abb., gefaltete Karte im
Nachsatz, [Waisenhaus-Buchdruckerei Paul Nack] Hanau.
SEIDENSCHWANN, G., GRIES, H. & THIEMEYER, H. (1995): Die
fluvatilen Sedimente in den Baugruben des Wohnparks Mühlheim
zwischen Ebertstraße und Offenbacher Straße in Mühlheim/Main.-
Jber. wetterau. ges. Naturkunde 146 - 147, S. 71 - 86,
Hanau.
STEINDLBERGER, E. (2003): Vulkanische Gesteine aus Hessen und ihre
Eigenschaften als Naturwerksteine.- Geologische Abhandlungen
Hessen Band 110, 167 S., 6 Tab., 53 Tafeln mit farb. Abb.
und Erläuterungen, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie,
Wiesbaden.
THEOBALD, G. (1850): Ueber das Vorkommen von Halbopal, Chalcedon
und Hornstein zu Steinheim bei Hanau.- Jahresbericht der
Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde über die
Gesellschaftsjahre 1847/50, S. 13 - 25, [Waisenhasubruchdruckerei]
Hanau.
WILKE, H.-J. (1981): Hessen.- Mineralfundstellen Band 7,
2. Aufl., 239 S., [C. Weise] München.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite