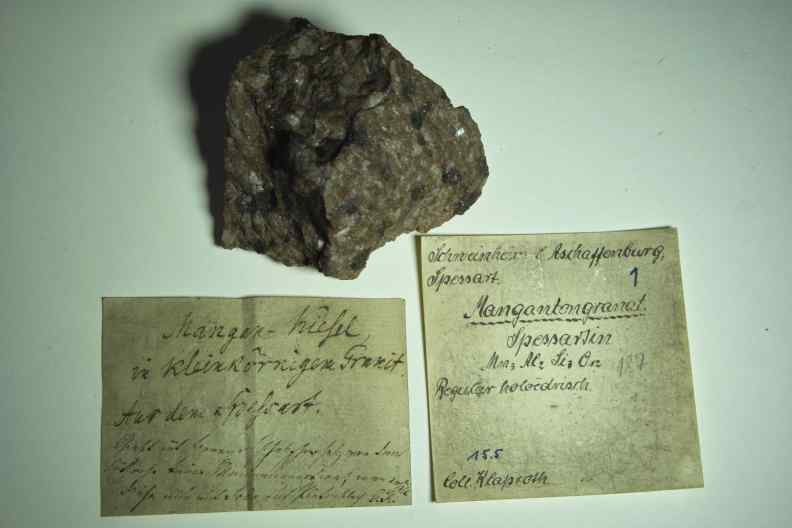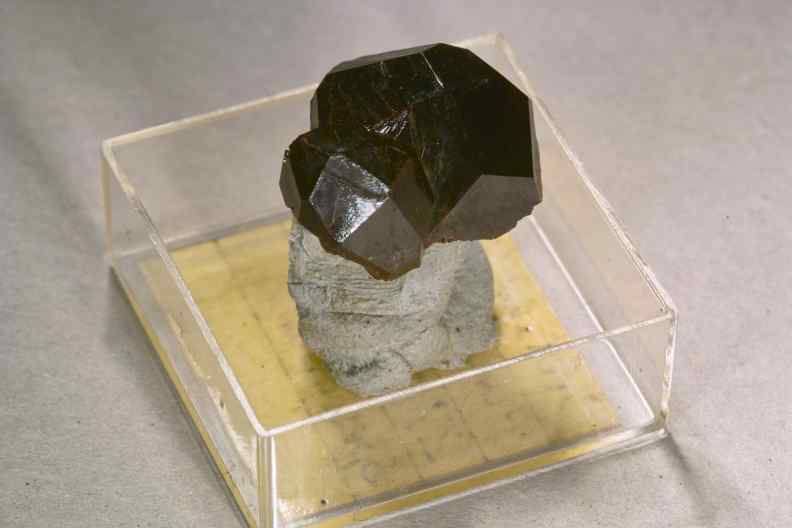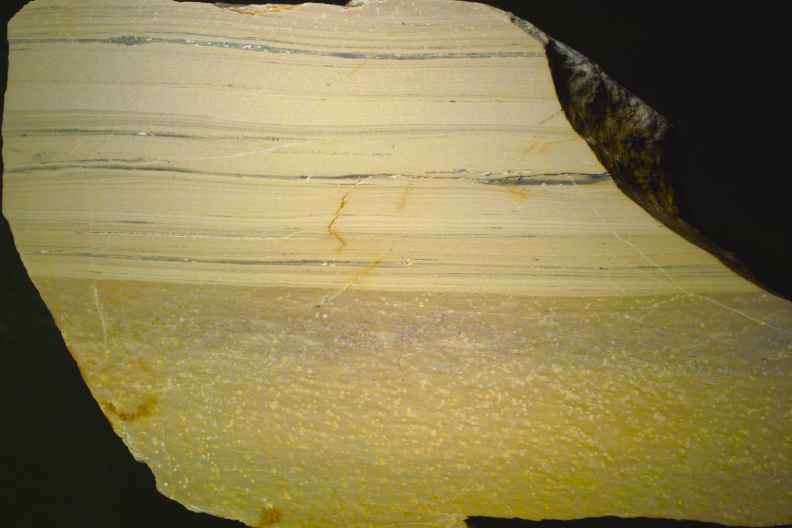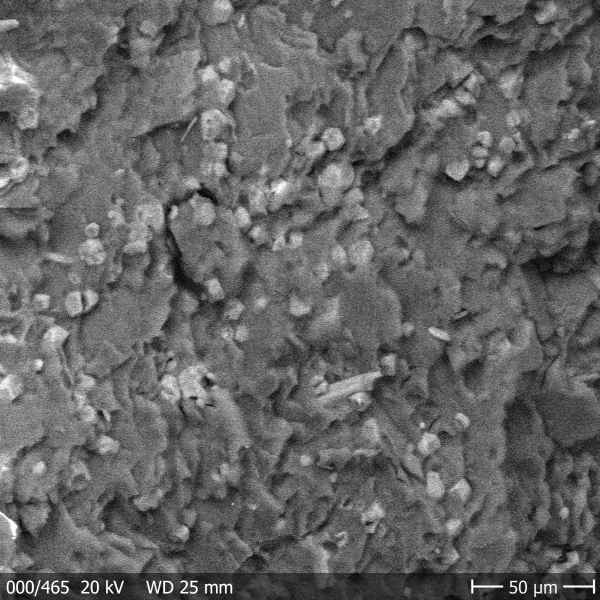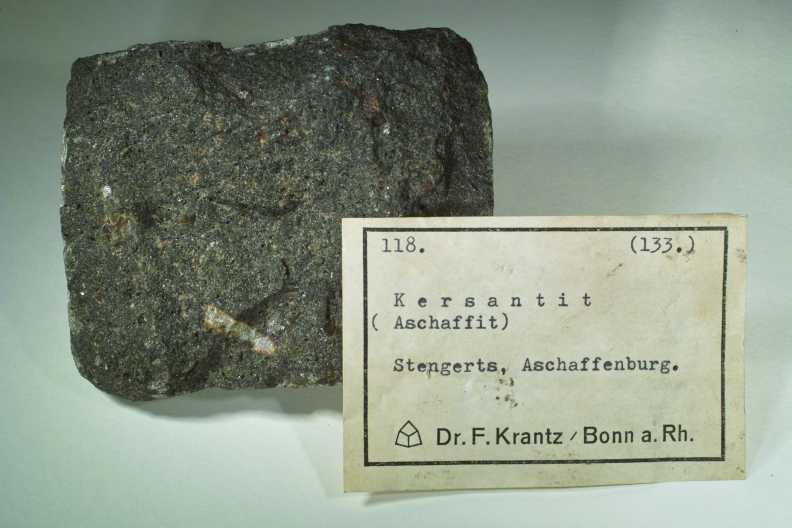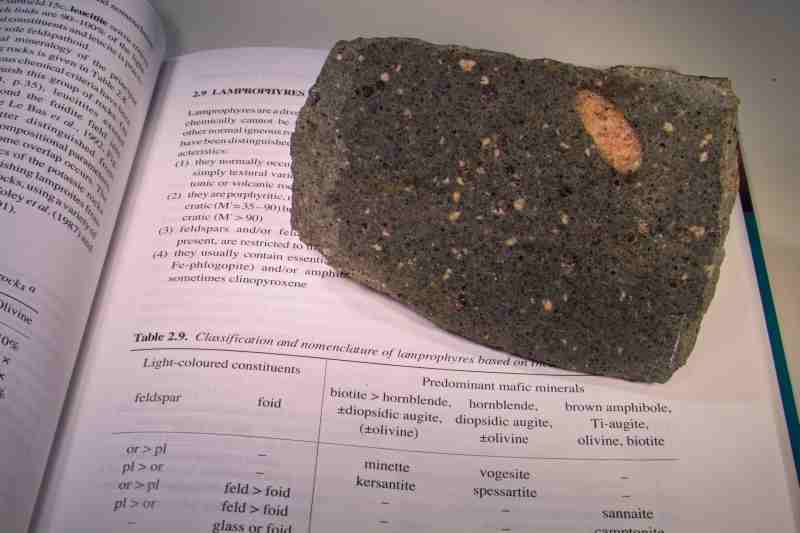Spessartin
oder Spessartit
flüchtig hingehört, zwei Wörter, die sich sehr
ähnlich anhören,
aber sehr gegensätzliche Naturprodukte benamen
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main
Spessart kommt von Specht (Vogel) und Hardt
(Wald), also "Spechtswald" und ist aus dem Jahr 839 als
"Spehteshart" belegt. Daraus wurde im Laufe der Zeit
Spessart.
Der Name "Spessart" wurde in den Geo-Wissenschaften (genauer
Mineralogie und Petrographie) mit zwei Namen eingeführt.
Infolge der Ähnlichkeit werden sie von Laien oft verwechselt.
Deshalb soll hier der Unterschied erläutert werden, was
insbesondere im Fall des Spessartits nicht gerade einfach ist:
Spessartin
Dabei handelt es sich um ein Mineral der Granat-Gruppe. Granate
sind meist kubisch kristallisierende Silikate mit einem sehr
komplizierten Aufbau, was die Anordung der Atome im Kristallgitter
betrifft. Sie entstehen vorwiegend während der Metamorphose
(Umwandlung von Gesteinen bei großer Hitze und Druck im festen
Zustand) von Gesteinen; aber auch aus hydrothermalen Lösungen und
selten auch aus einer Gasphase. Granate sind hauptsächlich rot
oder braun (bis heute wurde nie blaue Granate gefunden oder
synthetisch erzeugt), haben eine Härte nach MOHS von 6,5 - 7,5 und
keine Spaltbarkeit. Eine Unterscheidung der einzelnen Minerale der
20 Mitglieder der Granat-Gruppe (Almandin, Andradit, Calderit,
Goldmanit, Grossular, Henritmierit, Hibschit, Holstamit,
Hydro-Ugrandit, Katoit, Kimzeyit, Knorringit, Majorit, Morimotoit,
Pyrop, Schorlomit, Spessartin, Uvaroit, Wadalit, Yamatoit) ist mit
einfachen Methoden meist nicht möglich. Dazu muss zum Beispiel die
chem. Zusammensetzung und/oder der Brechungsindex ermittelt
werden. Die wirtschaftliche Bedeutung ist heute gering, sowohl was
die frühere Verwendung als Schleifmittel wie auch als Schmuckstein
angeht.
Spessartine aus den Pegmatiten vom Wendelberg bei
Haibach

Hellroter Spessartin-Kristall mit
einer deutlichen Treppung des Kristallflächen,
Bildbreite ca. 3,5 mm
|

Hunderte winziger Spessartine im
Pegmatit,
Bildbreite 4 cm
|

Roter Spessart-Kristall mit
Flächenstreifung im Muskovit-reichen Pegmatit,
Bildbreite 5 mm
|

Zwei Spessartine in der Form
verzerrter Rhombendodekaeder im Pegmatit,
Bildbreite 5 mm
|

Rissiger, modellhaft ausgebildeter
Spessartin-
Kristall, (Ikositetraeder)
Bildbreite 5 mm
|

Spessartin als Rhombendodekaeder mit
einem Ikositetraeder,
Bildbreite 5 mm
|
Der Spessartin ist das Mangan-Glied mit der idealisierten
chemischen Formel Mn3Al2[SiO4]3.
In der Natur werden oft ähnliche Atome in das Kristallgitter
eingebaut, so dass die tatsächliche Zusammensetzung oft
(erheblich) abweicht. Es gibt deshalb auch Mischkristalle, zum
Beispiel mit dem Almandin, dem Eisen-Glied der Granat-Reihe mit
der chem. Formel Fe3Al2[SiO4]3.
Das chem. Element Eisen kann das Mangan ersetzen, so dass
praktisch alle denkbaren Übergänge in der Natur existieren können.
Und im Pyrop wurde statt Fe oder Mn Magnesium eingebaut, so dass
auch mit diesem Mineral eine Verwandtschaft gibt. Man spricht dann
von einer Mischungsreihe, so dass die meisten Spessartine neben Mn
noch Fe, Mg, aber auch in Spuren noch Ca und andere Metalle
enthalten können. Deshalb werden diese Granate zu den
"Pyralspiten" (Pyrop, Almandin, Spessartin) zusammen gefasst, weil
man die Zugehörigkeit zu einem der namengebenden Endglieder nicht
ohne chemische Analyse entscheiden kann.
Das spezifische Gewicht des Spessartins ist mit 4,2 g/cm³ deutlich
größer als das von Quarz mit 2,65 g/cm³ (RAMDOHR & STRUNZ
1978, S. 666 ff).
Aus diesem Grund sind nicht alle Granate aus dem Spessart
Spessartine. Meistens handelt es sich um Almandine, insbesondere
wenn sie in den Gneisen, Quarziten oder Glimmerschiefern
eingewachsen sind. Nur wenige Pegmatite führen wirkliche
Spessartine. Sie sind besonders im Raum Glattbach-Aschaffenburg-Haibach (hier
finden Sie auch weitere Fotos vom Spessartin) verbreitet. Im 19.
Jahrhundert gab es zahlreiche Abbaue oder Abbauversuche auf diese
Pegmatite wegen der damals gewinnbringenden Feldspatgewinnung.
Dabei wurde Spessartin neben Turmalin und anderen, typischen
Pegmatit-Mineralien reichlich gefunden und gelangte durch den
damals schon bestehenden Handel auch in zahlreiche, bedeutende
Mineraliensammlungen, auch in das Ausland. Die im Spessart
gefundenen Spessartine sind bei zunehmender Größe (häufig schon ab
5 mm) oft rissig, braun und undurchsichtig, so dass keine
schleifbaren Qualitäten vorliegen. Kristalle unter wenigen mm
Größe sind meist gut ausgebildet (Rhombendodekaeder,
Ikositetraeder und Kombinationen), klar und von gelbroter bis
roter Farbe. Besonders die Exemplare, die in Glimmern eingewachsen
sind, lassen sich ohne Beschädigung bergen. Die Spessartine des
Spessarts (analysiert wurden wohl früher nur größere Kristalle)
zeigen alle deutliche Almandin-Anteile (das Verhältnis Mn:Fe ca.
2:1, siehe WEINELT 1962, S. 233f), so dass auch hier
Mischkristalle vorliegen.
Nun, bis vor wenigen Jahren sah ich als den schönsten
Spessartin-Kristall aus dem Spessart - gefunden im 19. Jahrhundert
- läge wohl im Museum of Natural History in London! Inzwischen ist
ein Spessartin-Kristall aus einem oberflächennahen, angewitterten
Pegmatit in Aschaffenburg aufgetaucht, der diesen an Größe und
Qualität übertrifft.
Umgekehrt gibt es heute bedeutende Funde von Spessartin in
Madagaskar, im San Diego Country Californien (USA), in Pakistan
und neuerdings in China (OTTENS 2005) mit bis zu mehreren
cm-großen Kristallen und in klarer, schleifwürdiger Qualität, wie
sie aus dem Spessart nie bekannt wurden. Spessartine werden in
Pegmatiten, Gneisen, Quarziten, Schiefern, in Rhyolith-Lithophysen
und seltener in Skarn-Lagerstätten, gefunden.

getreppter Spessartin-Kristall in Edelsteinqualität, rot, klar
durchsichtig
und stark glänzend aus der Navegadora Mine, einem Vorkommen in
einer
riesigen Druse von 10 x 10 x 2 m im Pegmatit mit bis zu 5 kg
schweren
Spessartin-Kristallen. Die Mine liegt 12 km von Penha do Norte,
Galileia
in Minas Gerais in Brasilien (WHITE 2009),
Bildbreite ca. 4 cm
Der wohl schönste bekannte Spessartin-Kristall ist transparent,
hat etwa 7 cm Durchmesser (!) mit schönen Innenreflexen,
glänzende, scharfe Flächen, wurde 2006 gefunden, stammt aus dem
Shigar-Tal in Pakistan und befindet sich in der Sammlung von
Stuart Wilensky in den USA (TOMPSON 2007:128f mit Abbildung) - ein
Traumstück. Für solche Steine werden auf dem internationalen
Mienralien-Markt unvorstellbare Summen bezahlt.
Der größte geschliffene Spessartin in Edelsteinqualität ist ein
"Mandarin-Granat" aus Nigeria, antik geschliffen bei Fa. Henn GmbH
in Idar-Oberstein und hat ein Gewicht von 78,03 ct. Er liegt im
berühmten (eine der besten Mineraliensammlungen der Welt)
Houston Museum of Natural Science in Houston, Texas.
Tiefrote, klare Spessartin-Kristalle (meist
Ikositetraeder)
auf Feldspat von Tongbei, Fujian Provinz, China,
Bildbreite ca. 4 cm
Die Mineralgruppe Granat ist durch die Verwendung als Schmuck (siehe
BAUER et al. 1982, Seite 100 ff) weithin bekannt und
Abbildungen von Spessartin finden sich in fast jedem Mineralienbuch,
so dass hier auf eine Abb. verzichtet werden kann.
Das Mineral wurde 1787 "im Spessart bei Aschaffenburg" vom
russischen Fürst Dimitrij Alexejewitsch GALLITZIN (1738-1803)
aufgesammelt. GALLITZIN war Gesandter in Paris und Den Haag und
wohnte auch längere Zeit in Braunschweig. Nach dem Ausscheiden aus
dem Staatsdienst baute er eine umfangreiche Mineraliensammlung
auf, die später nach Jena kam und von keinem geringeren als Johann
Wolfgang von GOETHE betreut wurde.
Die ersten chemischen Analysen wurde vom damals berühmten Martin
Heinrich KLAPROTH an dem damals noch "granatförmige Braunsteinerz"
- wegen des Mangangehalts - genannten Minerals gemacht.
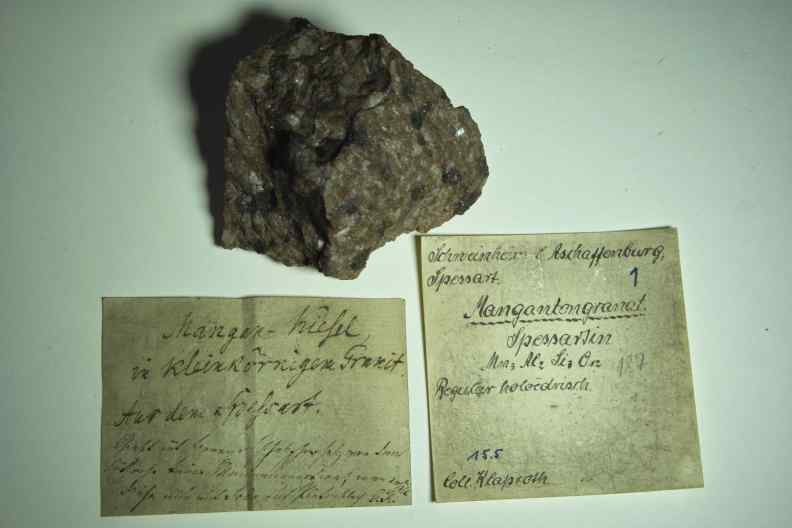
Unscheinbares Stück rundliche Spessartine im Gneis von Schweinheim
bei Aschaffenburg mit einem handschriftlichen Zettel von Martin
Heinrich KLAPROTH und einem Zusatz von Gustav Rose, Museum
für Naturkunde Berlin, Nr. 2004-4895,
Bildbreite ca. 12 cm
Die Namensgebung "Braunsteinkiesel" erfolgte dann 1813 durch den
Mineralogen J. F. L. HAUSMANN in seinem Handbuch der Mineralogie.
Der pariser Mineraloge François Sulpice BEUDANT benannte den
Mangantongranat mit dem Namen "Spessartine" im Jahre 1832.
Der Münchner Professor Franz von KOBELL veröffentlichte erneute
Analysen des Spessartins im Jahre 1868 (MURAWSKI 1992, S. 192f).
Neuere Analysen finden sich bei WEINELT (1962, S. 233f).
Die gesamte Geschichte der Entdeckung einschließlich der
Begründung für die Typlokalität kann man unter LORENZ 2010:453ff nachlesen.
Spezielle Literatur über Granate gibt es kaum. Ganz neu ist das
Heft "Garnet" des Magazins Elements Dezember 2013.
Bildergalerie von Spessartinen - weltweit:
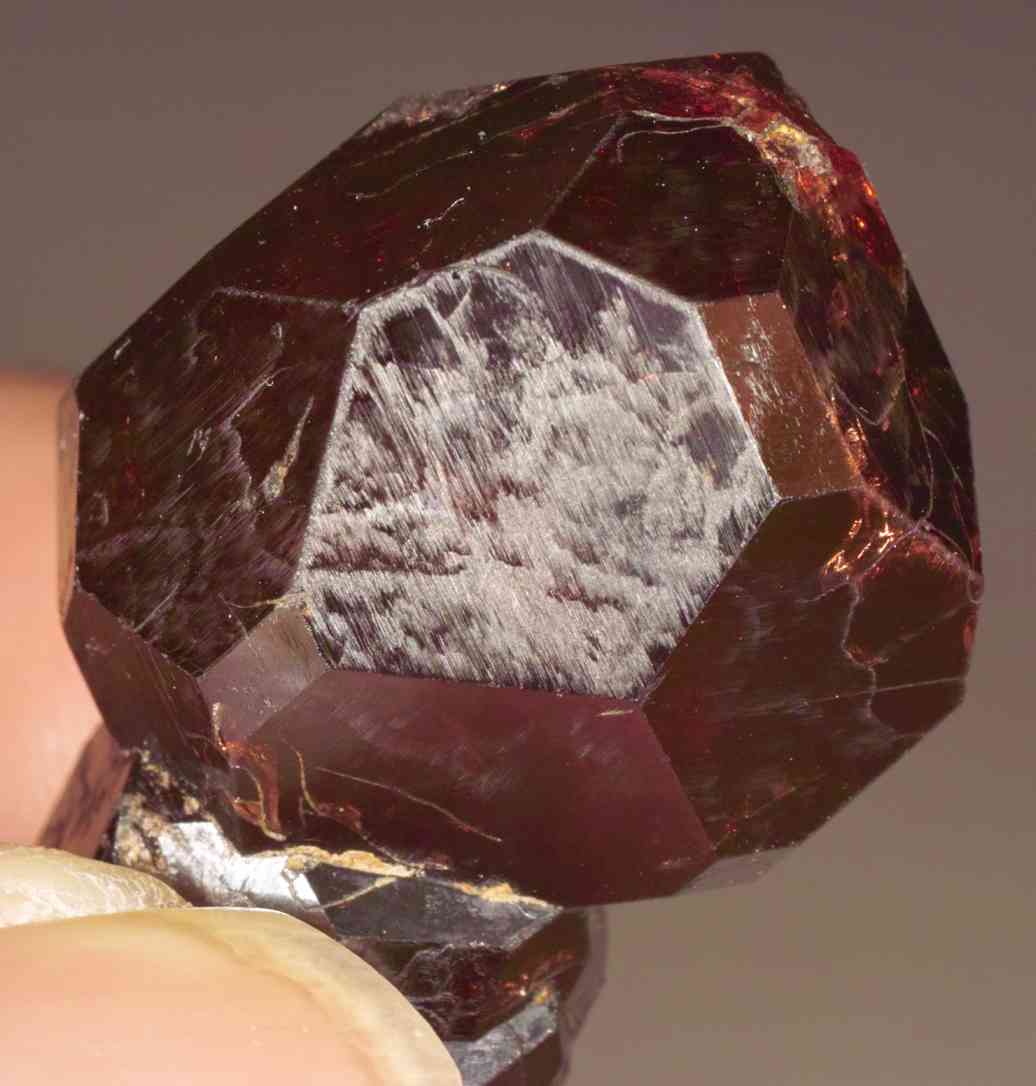
Spessartin-Kristall aus einem Vorkommen in Pakistan;
Bildbreite ca. 3 cm.
|

Kleine Spessartin-Kristalls auf einem großen
Vesuvian-Kristall, Fushan, Hebei, China;
Bildbreite 5 cm.
|

Spessartin-Kristall im drusigen Rhyolith von Garnet Hill bei
Ely in Nevada, USA;
Bildbreite 2 cm.
|

Eine eigentlich "unmögliche" Paragenese: Spessartin mit
Galenit, und Quarz von Broken Hill in Australien;
Bildbreite 10 cm.
|

Eine "unmögliche" Paragenese: Spessartin mit Galenit,
Chalkopyrit, Pyrit und Quarz von Broken Hill in Australien;
Bildbreite 5 cm.
|

Ausgewitterte Spessartin-Kristalle mir rauhen Flächen
(Rhombendodekaeder) aus dem Ankaratra-Gebirge bei Antsirabe
auf Magagaskar;
Bildbreite 9 cm.
|

Durchscheinende Spessartin-Kristalle von Loliondo in
Tansania;
Bildbreite 3cm.
|
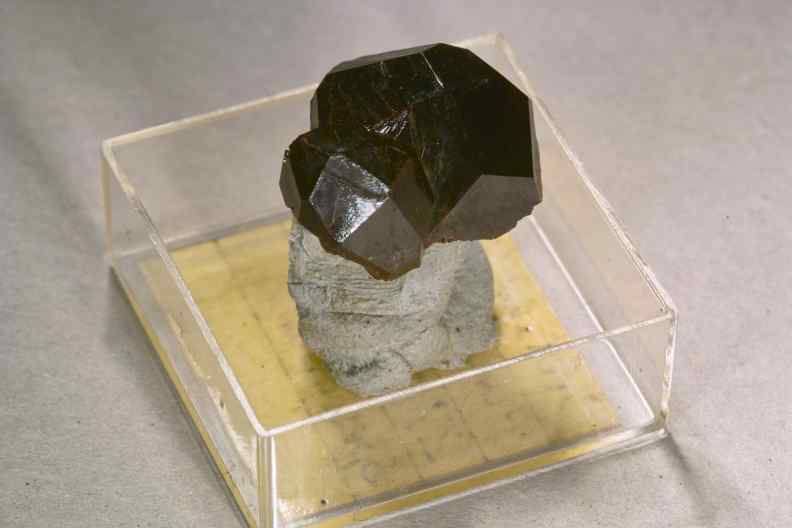
Beschädigter Spessartin-Kristall aus einem Pegmatit von
Knipan, Iveland, Südnorwegen, selbst gefunden im Sommer
1978;
Bildbreite 5 cm.
|

Rissige Spessartin-Kristelle im Muskovit eines Pegmatits von
Ljosland, Iveland, Südnorwegen;
Bildbreite 10 cm.
|

Hellrote bis braunrote Spessartin-Kristalle auf Quarz von
der berühmten Fundstelle von Tongbei im Yunxiao County,
Fujian Provinz, China;
Bildbreite 4 cm
|

Hellrote bis braunrote Spessartin-Kristalle auf und mit
Quarz von der berühmten Fundstelle von Tongbei im Yunxiao
County, Fujian Provinz, China;
Bildbreite 2 cm
|

Hellrote bis braunrote Spessartin-Kristalle auf und mit
Quarz von der berühmten Fundstelle von Tongbei im Yunxiao
County, Fujian Provinz, China;
Bildbreite 4 cm
|

Braunrote bis hellrote, klare bis undurchsichtige
Spessartin-Kristalle (meist Ikositetraeder) auf dem weißen
Feldspat mit farblosem Opal (stark fluoreszierend) von
Tongbei im Yunxiao County, Fujian Provinz, China;
Bildbreiten 14 cm.
|

Braunrote bis hellrote, klare bis undurchsichtige
Spessartin-Kristalle (meist Ikositetraeder) auf dem weißen
Feldspat (wie links) von Tongbei im Yunxiao County, Fujian
Provinz, China;
Bildbreite des Ausschnitts 5 cm.
|

Derber Spessartin als Gesteinsbestandteil aus einem
metamorphen Vorkommen von Praborna im Aostatal,
angeschliffen und poliert;
Bildbreite 13 cm.
|

Rhombendoedekaedrische Spessartin-Kristalle in einem
Quarz-Keratophyr von Byneset bei Trondheim in Norwegen;
Bildbreite 5 cm.
|

Mm-kleine, helle Spessartin-Kristalle auf Rhodonit-Tafeln
aus Pachapaqui, Ancash Dept., Peru. Diese
Spessartin-Kristalle sind außergewöhnlich rein und führen
kein Eisen;
Bildbreite 2 cm.
|

Idiomorpher Spessartin-Kristall mit etwas Muskovit aus
Iveland, Norwegen;
Bildbreite 4 cm.
|

Hervorragend aus dem Gneis gelöster Spessartin-Kristall von
Serote, Paraiba, Brasilien;
Bildbreite 5 cm.
|

Coticule: Das im Handstück unscheinbare Gestein ist
oberflächlich hell angewittert und besitzt auf den
Kluftflächen schwarze Flecken aus Manganoxiden. Das
schiefrige Gestein führt gesteinsbildenden Spessartin als
Hauptbestandteil: 35 - 40 % bestehen aus 5 - 20 µm großen
Granat-Kristallen - siehe REM-Foto rechts. Gefunden bei
Vielsalm in den belgischen Ardennen (Autorencollectif 2007);
Bildbreite 13 cm.
Davon werden die Wasserabziehsteine "Belgische Brocken"
herausgesägt. In dem Steinbruch gibt es auch noch eine
blauegraue Variante, dessen Farbe durch ein Pigment aus
Eisenoxid verursacht wird.
Mittels Röntgendiffraktion konnte in dem sehr feinkörnigen
gelben Gestein neben dem reichlich vorhandenen Spessartin
noch Quarz, Mikroklin (Kalifeldspat), Muskovit und Kaolinit
nachgewiesen werden. Dies spricht für eine niedrig-gradige
Metamorphose; der Kaolinit ist wahrscheinlich aus der
oberflächennahen Verwitterung des Feldspats entstanden.
Die ehemaligen Sedimentgesteine stammen aus dem Ordovizium
und wurden bei ~400 °C und 2 kB umgewandelt, wobei der
Spessartin aus Rhodochrosit entstand (SCHREYER et al. 1992).
Weitere Details mit Fotos können Sie hier
nachlesen.
|
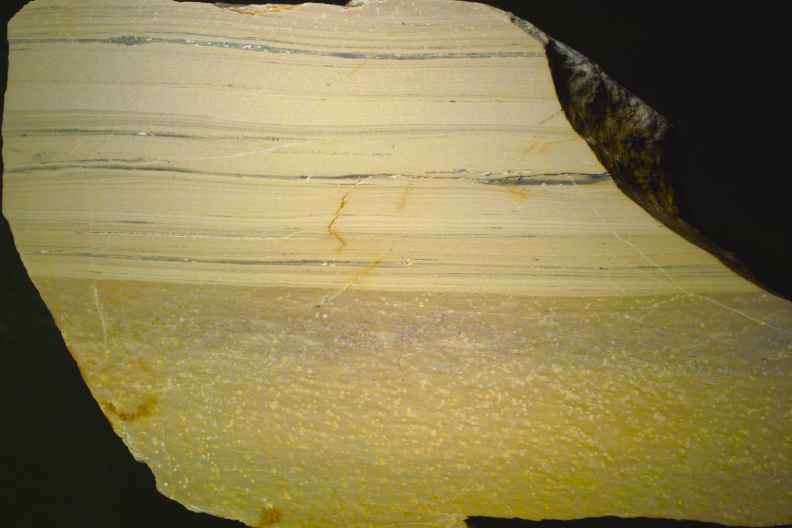
Der Belgische Brocken aus dem Stück links gesägt und
geschliffen (eine Politur ist wohl schwierig anzubringen).
Man erkennt sehr schön die unterschiedlichen Schichten, die
Spessartine sind erst unter dem Mikroskop zu sehen,
Bildbreite 7 cm.
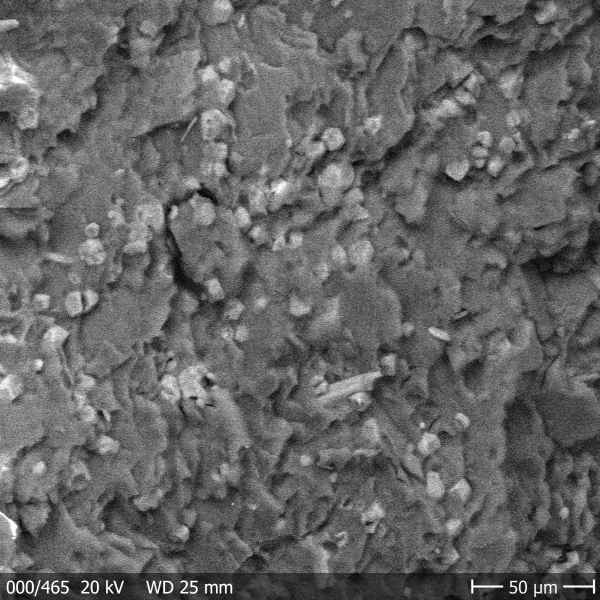
Die Spessartine sind extrem klein und kaum 5 µm groß,
Bildbreite 0,25 mm;
REM-Foto Stefan DILLER
|

Großer Spessartin-Kristall mit weiteren kleinen Kristallen
aus dem Tomboarivo-Pegmatit, Sahanivotry, Antsirabre,
Magagaskar. Der Feldspat ist rissig verwittert und wird von
etwas Muskovit begleitet;
Bildbreite 10 cm.
|

Spessartin-Kristalle im Calcit als Hauptbestandteil eines
Skarns von der weltberühmten Lagerstätte in Langban, in
Mittelschweden, gefunden 23.06.2005;
Bildbreite 4 cm.
|

Hellrote Spessartin-Kristallen mit einem Reaktionssaum in
einem Glimmerschiefer vom Marienfluss, Namibia. Sammlung Kay
MÜSSIG, Miltenberg;
Bildbreite 3 cm.
|

Winziger Spessartin-Kristall als Bestandteil eines
granitischen Gesteins vom Otratnaja Nunatak, northern Gruber
Mts., Queem Maud Land, Ostantarktis!
Bildbreite 5 mm.
|

Spessartin als Gesteinsbestandteil eines metamorph
umgewandelten, kambrischen Metasediments. Die dunkle Lage
enthält Sonolit, Tephort und Ca-Rhodochrosit. Die
helleren Lagen führen bis zu 50 % Spessartin, darüber hinaus
Rhodochrosit, Quarz, Tephorit, Kutnahorit, Jakobsit und
Magnetit. Risse sind mit weißem Quarz gefüllt. Angeschliffen
und poliert von der Llyn du Bach Mine (als Manganerz
abgebaut Ende des 19. Jahrhunderts), Harlach, früheres
County von Merioneth, nördliches Wales, Großbritannien;
Bildbreite 15 cm.
|

Spessartin-Kristalle aus einem hydrothermalen Gangsystem
zusammen mit Braunit, Quarz und Muskovit im Kristallin von
Archer´s Post, NW des Monut Kenya, Kenia;
Bildbreite 3 cm.
|

Derber Spessartin, wohl aus einem Pegmatit von Bajaur/NFWP
in Pakistan;
Bildbreite 6 cm.
|

Kleine, lose Spessartin-Kristalle vom Wada-toge Pass,
Nagano, Japan;
Bildbreite 2 cm.
|

Idiomorphe Spessartin-Kristalle mit farblosen
Quarz-Kristallen auf einer Kluftfläche in einem Quarzit von
Kyarvason, Tochigi, Japan;
Bildbreite 3 cm.
|

Spessartin-Kristalle auf weißem Plagioklas aus einem
Pegmatit bei San Piero, Insel Elba, Italien;
Bildbreite 2 cm.
|

"Braunskarn", ein Kalksilkatfels, der reich ist an Mn- und
Mg-Silkaten mit einem Alter von etwa 1,9 Ga. Es ist auch
Spessartin enthalten, ohne dass man die mit dem bloßen Auge
sehen kann. Der Fundort ist Man-Gruvan im Erzfeld von
Lindesberg in Schweden;
Bildbreite 14 cm.
|

Spessartin-Kristall aus einem Vorkommen im
Izumrudnye-kopi-Gebiet, Malyshevo, nordöstlich von
Ekaterinenburg, Sverdlovskaya Oblast im mittleren Ural,
Russland;
Bildbreite 2 cm.
|
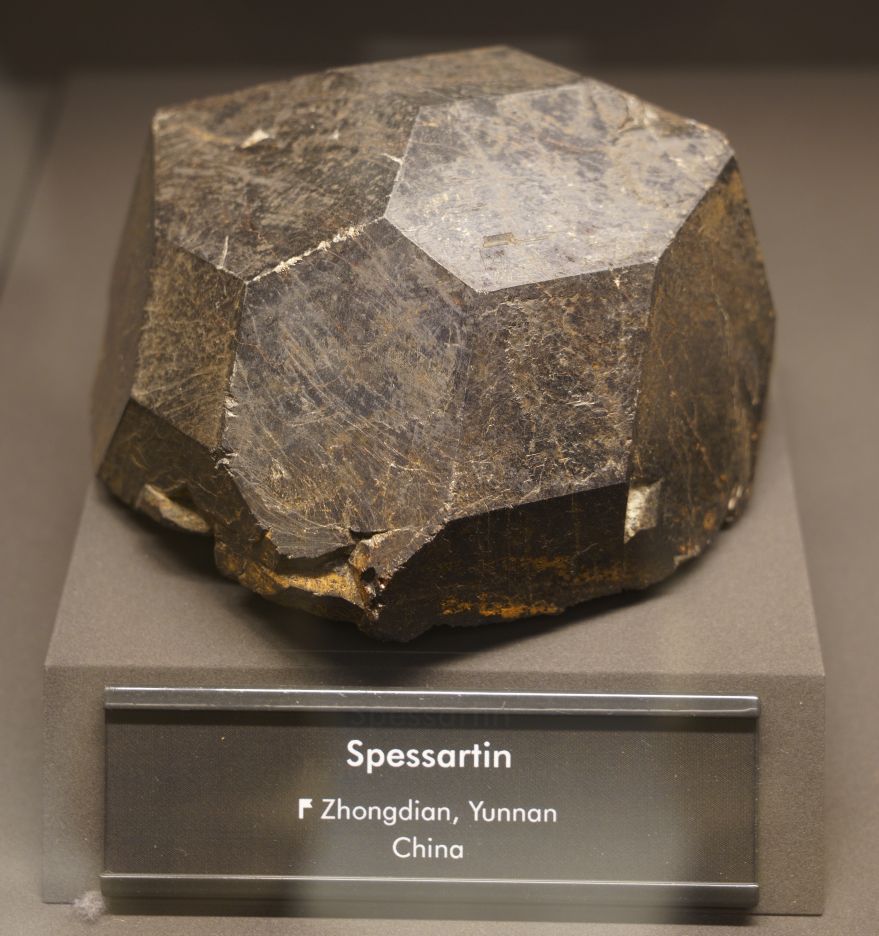
Der größte, mir bekannte Spessartin-Krisall, mit einem
Durchnesser von ca. 15 cm, aus Zhongdian, Yunnan, China,
liegt in der umfangreichen Ausstellung der "Terra Mineralia"
im Schloss Freudenstein in Freiberg im
Erzgebirge;
aufgenommen am 03.07.2019
|

Spessartin-Kristalle in einem Pegmatit aus Araquia in Minas
Gerais in Brasilien;
Bildbreite 3 cm
|

Spessartin (gelblich) in einem metamorphen Manganerz von
Furtschellas, Maloja, Graubünden, Schweiz. Hier ist neben
Rhodonit noch Hämatit, Braunit, Calcit und weitere
Mineralien wie Tephorit verwachsen. Randlich sind die
Manganphasen entlang kleiner Risse in schwarze Manganoxide
umgewandelt, angeschliffen und poliert;
Bildbreite 13 cm
Im Kristallin des zentralen Hauptkamms der Schweiz gibt es
weitere mehrere kleine Mangan-Lagerstätten mit exotischen
Mineralien:
- Grube Starlera, Viamala,Graubünden
- Falotta, Albula, Graubünden
- Alp Parsettens, Albula, Graubünden
|

Ein Rasen aus durchsichtigen Spessartin-Kristallen auf einem
alterierten Granit;
Bildbreite 6 cm
|

2022 als "Spessartin" aus dem Binntal in der Schweiz bei
Andre GORSAT gekauft. Es handelt sich um Granat-Kristalle
zusammen mit Chlorit und einem Amphibol auf einer
Kluftfläche in einem grünlichen Gestein. Aber die chemische
Analyse zeigt, dass es sich um einen Andradit mit einer
Grossular-Komponente und einem geringen Ti-Gehalt handelt.
Dies zeigt einmal mehr, dass man einen Granat nicht vom
Aussehen einem Glied der Gruppe zuordnen kann;
Bildbreite 3 cm.
|

Orangenfarbener Spessartin in Kristallen als
"Mandarin-Granat" mit einem Mn:Fe-Verhältnis von 2,8:1 aus
einer kleinen Lagerstätte am Grenzfluss Kunene in der
Kunene-Region im Norden Namibias. Der Granat ist der
Mittelpunkt einer weißlichen Aureole in einem
Muskovit-Schiefer;
Bildbreite 1 cm.
|

Fast modellhaft ausgebildeter Spessartin-Kristall im Quarz
eines Pegmatits aus dem Starokrymskiy-Steinbruch, Mariupol,
Donetsk-Region in der Ukraine. Der eisenreiche Spessartin
hat ein Mn:Fe-Verhältnis von 1,1:1. Gefunden von Vadym
LEVTEROV;
Bildbreite 6 mm.
|

Tiefrote Spessartin-Kristalle (Mn:Fe-Verhältnis von 2,2:1)
in einem glimmerhaltigen Gesteine aus der
Krasnoarkmeiskoe-Lagerstätte (Asbest) im Distrikt Izumrudnye
Kopi Gebiet, Sverdlovsk-Region in Russland. Zur Verfügung
gestellt von Vadym LEVTEROV;
Bildbreite 15 mm.
|

Lose, braune und undeutlich auskristallisierte
Granat-Kristalle aus Aschaffenburg, bezeichnet als
"Spessartin" aus der bekannten Mineralienhandlung von Dr.
Ing. H. Maucher in München;
Bildbreite 5 cm.
Die über die Plattform ebay verkauften Kristalle bestehen
nach chemischen Analysen aber aus Almandin mit etwas Titan,
aber nahezu ohne Mangan. Den anhanftenden Glimmerplättchen
nach stammen die Kristalle aus einem in oder um
Aschaffenburg anstehenden Glimmerschiefer.
|

Rissiger Spessartin-Kristall aus Tsilaieina in Madgaskar,
sicher gefunden im frühen 20. Jahrhundert (No.
485 der ehemaligen Sammlung CHENET in Frankreich);
Bildbreite 3 cm.
|

Hellroter "Mandarin-Granat" aus Mali (oder vielleicht auch
Nigeria), der sich als Spessartin erwies. Das
Mn-Fe-Verhältnis liegt bei etwa 4:1;
Bildbreite 3 cm.
|
|
Der Name des Minerals Spessartin ist, im Gegensatz zu vielen
anderen, aus der Frühzeit der Mineralogie, heute noch gültig. Eine
gute Zusammenstellung zum Mineral Spessartin bringen HOCHLEITNER
& WEISS (2004), wenn man von der falschen Typlokalität
absieht.
Spessartit
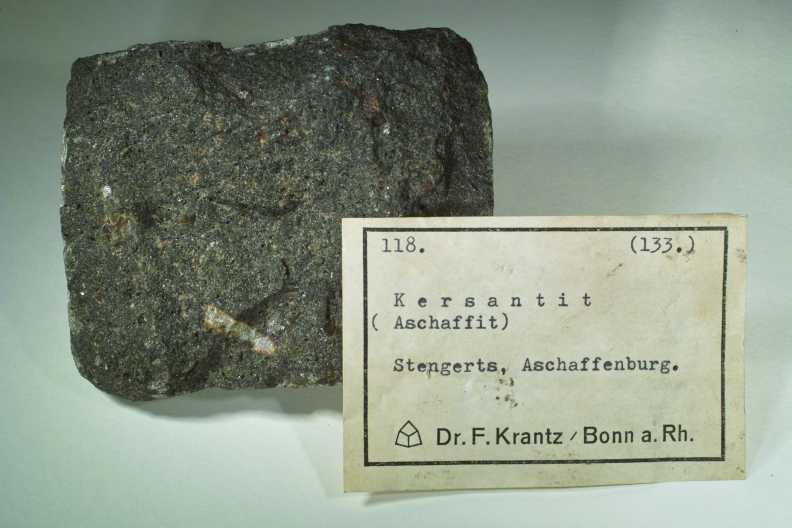
Kersantit (Aschaffit als Sonderform des Spessartits) vom Stengerts
bei
Schweinheim (Aschaffenbugr) aus der Produktion für die Fa. KRANTZ,
die solche Stücke in Losen zu 100 Stück schlagen ließ,
Bildbreite 13 cm
Dabei handelt es sich um ein dunkelgrau bis schwarz gefärbtes
lamprophyrisches Gang-Gestein (also ein Gemisch aus einzelnen
Mineralien), welches mit dem Kersantit zur Gruppe der Lamprophyre
gehört.
Lamprophyre sind dunkle Ganggesteine, vereinfacht ausgedrückt das
Gegenteil zu den Apliten (sie gibt es auch im Spessart). Sie sind
aus Schmelzen erstarrt, die im Erdinnern erzeugt wurden. Der
Mineralbestand wie auch der Kristallisationsverlauf der einzelnen
Bestandteile wird entscheidend von fluiden, wässerigen Phasen und
vom Kohlendioxidgehalt beeinflusst.
Der Spessartit besteht im Handstück aus einer dunklen Grundmasse,
die sich im Wesentlichen aus Feldspäten (Plagioklas >
Kalifeldspat) und Hornblende aufbaut. Olivin(-pseudomorphosen),
Quarz, Erzmineralien sind weitere Bestandteile mit sehr geringem
Anteil. In der feinkörnigen Grundmasse sind größere, grüne
Hornblende-Einsprenglinge verteilt (WIMMENAUER 1985).
Eine Abbildung aus dem Spessart findet sich bei MARESCH et. al.
(1987, S. 129 u. r.).
Örtlich sind bis zu mehrere cm-große Kailfeldspat-Kristalle
enthalten. Sie sind rundlich von der Schmelze angelöst, wie
bereits WEINSCHENK (1915:52f und Fig. 34) beschreibt. Diese
Kristalle stammen aus großer Tiefe und sind in dem Magma nicht
stabil, so dass die angeschmolzen sind und damit rundliche Formen
aufweisen.


Links im Bild sehen Sie eine Bruchfläche des Spessartits mit einem
ca. 2,5 cm langen Feldspat-Kristall, rechts das Bild zeigt einen
angeschliffen Spessartit (ca. 14 cm breit); beide stammen aus
einem Vorkommen nahe der Kirche von Gailbach.
Zu einer exakten Bestimmung von Gesteinen ist in der Regel ein
Gesteinsdünnschliff (Dicke 0,03 mm) nötig, der unter einem
Mikroskop mit speziellen Einrichtungen (unter anderem
polarisiertem Licht) untersucht werden können. Darüber hinaus ist
eine chem. Analyse vorteilhaft, weil damit auch nicht sichtbare
Veränderungen erfasst werden können.
Das Gestein Spessartit wurde von dem heidelberger
Geologie-Professor K. Harry F. ROSENBUSCH 1896 nach dem Spessart
benannt. Er hat dies in Band 2 (3. Aufl.) seiner "Mikroskopischen
Physiographie der massigen Gesteine" beschrieben. Der Name wird
heute infolge seiner überwiegend lokalen Bedeutung nur in
unfangreicheren Werken aufgeführt.
Der dunkelgraue bis rötlichgraue, oft auch schwarze Spessartit
findet sich als gangförmige Einschaltungen in den Dioriten und der
Elterhof-Formation des südlichen Vorspessarts. Sie treten meist in
Gangschwärmen auf. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 0,3 und 12 m
und beträgt in der Regel 5 - 6 m.
Sie waren früher die Grundlage von zahlreichen, kleinen
Steinbruchbetrieben, heute noch erkennbar an den langen, schmalen,
heute alle aufgelassenen und verwachsenen Steinbrüchen.


Straßenpflaster am Schloss in Aschaffenburg, zum Teil aus
Spessartit bestehend,
aufgenommen am 03.02.2008
Man fertigte aus dem Basalt-ähnlichen Gestein neben Schotter
auch Pflastersteine, wie z. B. am Schloss in Aschaffenburg, wo auf
der Ostseite eine größere Fläche aus einem Spessartit-Pflaster
erhalten ist. Die Pflastersteine sind leicht rechteckig (ca. 14 x
16 cm) und ca. 17 cm in den Boden eintauchend. Der leichte
Verjüngung sichert einen festen Sitz im Verband. Mit diesen Maßen
und einem Gewicht von ca. 7 kg sind sie deutlich schwerer wie die
typischen Pflastersteine aus den basaltischen Gesteinen. Einzelne
Pflastersteine des Spessartits sind durch die Bauarbeiten an
verschiedenen Stellen verschleppt worden und man finden sie im
Verband folegnder Straßen: Wermbachstraße, Schönborner Hof,
Schlossplatz, Paffengasse, Schlossgasse und Freihofgasse. Infolge
der fortschreitenden Bau- und Ausbesserungsarbeiten ist eine
weitere Verstreuung zu erwarten.



Einzelner, auf der Oberseite abgenutzter Pflasterstein aus dem
einem Lamprophyr der Reihe Spessartit-Kersantit (Bildbreite 30
cm), rechts im Ausschnitt der am Rand gelegene, rundliche
Kalifeldspat-Kristall (Bildbreite 8 cm) und ganz rechts ein
verzwillingter Kalifeldspat-Kristall (nach dem Karlsbader Gesetz)
mit der mittigen Zwillingsnaht an der nur behauenen Seite des
Pflastersteins. Die angeschliffene Oberseite zeigt, dass das Stück
in einer Straße eingebaut war und bei Bauarbeiten nach langer
Nutzungszeit ausgebaut und auf dem Bauhof gelagert wurde. Zur
Verfügung gestellt von Herrn Völker vom Bauhof der Stadt
Aschaffenburg (Tiefbauamt) am 26.04.2012. Das Gestein führt noch
gelegentlich Quarz, was man in den Fotos kaum erkennen kann. Als
Herkunft ist einer der Steinbrüche um Gailbach zu vermuten.
Das für Aschaffenburg so typische Stück ist in der
Gesteinssammlung des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt
Aschaffenburg (1. OG, Gang, Vitrine rechts) zu sehen.
Auch in Stockstadt!


Der Rinnstein in der Sackgasse der Galizienstraße enthält
überraschenderweise ebenfalls große Pflastersteine
aus Spessartit. Zwischen echten Basalten, den Steinen aus dem
Untermain-Trapp und lokalen Orthogneis sind
die Spessartite an den Quarzen und an den großen
Kalifeldspat-Kristallen leicht erkennbar,
aufgenommen während der Vorbereitungen zum Kulturrundweg am
17.05.2013.
Für einen Spessartit vom Nordabhang des Stengerts bei
Aschaffenburg (Schweinheim/Gailbach) wird folgende chem.
Zusammensetzung angegeben (WEINELT 1962, S. 230):
| Bestandteil: |
Anteil in Gew.-% |
| SiO2 |
56,18 |
| TiO2 |
0,77 |
| Al2O3 |
16,14 |
| Fe2O3 |
3,44 |
| FeO |
4,27 |
| MnO |
0,36 |
| MgO |
4,74 |
| CaO |
6,45 |
| Na2O |
4,37 |
| K2O |
2,97 |
| P2O3 |
0,13 |
| SO3 |
0,04 |
| CO2 |
0,03 |
| H2O |
0,68 |
Das Nebengestein war schon erkaltet als die Schmelze in die Gänge
eindrang. Veränderungen durch die hohe Temperatur wurden nicht
beobachtet. Aufgrund der Überlagerung des Zechsteins wird das
Alter als voroberpermisch eingestuft (>280 Millionen Jahre).
Die mineralogische Zusammensetzung sowie das Gefüge ändern sich
vom Salband zum Ganginnern, so dass in Teilbereichen verschiedene
petrografische Bezeichnungen verwendet werden müssten (WEINELT
1962, S. 93 ff).
Nach den aktuellen Untersuchungen von WROBEL ist das eigenartige
Gestein aus dem oberen Erdmantel im Spessart ca. 290 Millionen
Jahre alt.
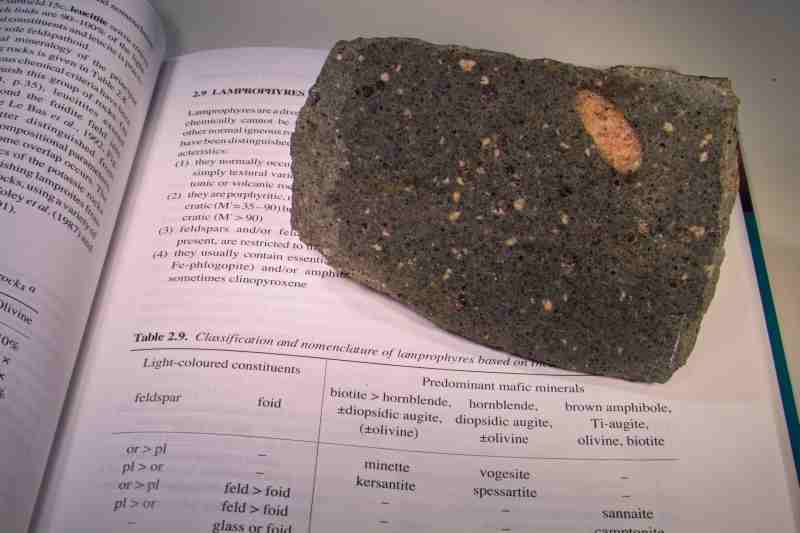
Die Abgrenzung der einzelnen Gesteine der Lamprophyre wie
Kersantit - Spessartit ist sehr schwierig und im Handstück nur
schwer möglich, da man die Menge der Mineral-Bestandteile kennen
muss:
Enthält ein Lamprophyr mehr Alkalifeldspäte als Plagioklas und
mehr Biotit als Hornblende, dann liegt eine Minette bzw.
vorherrschend Hornblende ein Vogesit vor.
Ist der Plagioklas gegenüber den Alkalifeldspäten dominierend,
dann ist mit einer Biotit-Vormacht gegenüber der Hornblende das
Gestein als Kersandtit zu bezeichnen, bei einer Vormacht der
Hornblende liegt ein Spessartit vor.
Enthält der Kersantit dann Biotit in einer Matrix aus Plagioklas
und Quarz, so wurde das Gestein früher als "Aschaffit" bezeichnet
(Lokalname).
Wer sich näher damit beschäftigen will, dem sei zur Nomenklatur
das Buch von LE MAITRE (Ed.) (2003) empfohlen.
Spessartit von Vorkommen außerhalb des Spessarts:

Permischer Spessartit vom Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Das
massige und
sehr harte Gestein wurde früher als "Proterobas" bezeichnet.
Dieses Gestein
wurde seit dem Frühmittelalter als Glasrohstoff aufgeschmolzen und
zu
schwarzen Glasperlen und Knöpfen verarbeitet,
Bildbreite 11 cm

Spessartit aus einem Vorkommen am 300 m hohen Whinlatter Pass,
Lake District, Cumbria, England, Großbritannien,
Bildbreite 7 cm


Im Straßenpflaster von Dresden - wohl wenig beachtet - (hier am
Luther-Denkmal an der wieder aufgebauten Frauenkirche) besteht aus
Graniten, Porphyren und zu einem großen Teil aus Spessartit (auch
als "Lausitzer Lamprophyr" beschrieben). Einzelne Pflastersteine
sind von grünen Klüften aus Epidot durchzogen; da dieser härter
ist als das aus Plagioklas, Klinopyroxen und Biotit bestehende
Gestein, werden diese durch das Begehen und Überfahren erhaben
herauspräpariert. Je nach Lage der Klüfte gibt es auch "grüne
Pflastersteine". Das im geschliffenen Zustand markante
Gestein stammt aus dem Devon und wurde sowohl in Sachsen als auch
im benachbarten Tschechien, auch zur Werksteingewinnung,
abgebaut.
Aufgenommen am 04.07.2019
Anhang:
Bei den Mineralien - im Gegensatz zu den Gesteinen leicht zu
definieren - gibt es ein Verfahren zur Benamung (DUNN et al.
1988). Die CNMMN (Commission on New Mineral and Mineral Names) der
IMA (International Mineralogical Association) prüft nach dem
Einreichen die Daten und den Anspruch zu einem neuen Mineral und
der Einreicher kann dann das neue Mineral in der Literatur
beschreiben (NICKEL & NICHOLS 1991).
Zur Zeit sind ca. 5.100 verschiedene Mineralien bekannt (BACK
2018); jährlich kommen ca. 30 bis 50 neue hinzu, einige werden
meist aufgrund besserer Analysenmöglichkeiten verworfen
(diskretidiert). Praktische Bedeutung und verbreitet sind jedoch
nur ca. 250 Mineralien, die in den meisten, bebilderten
Mineralien-Führern beschrieben werden. Es geibt derzeit in
deutscher Sprache kein Buch, in dem alle Mineralien aufgeführt
sind. In englischer Sprache sind in den letzten Jahren einige,
teils mehrbändige, Werke erschienen, die alle zu Druckzeitpunkt
bekannten Mineralien beschreiben bzw. aufführen.
Für die Benamung von Gesteinen existieren keine verbindlichen
Regeln, was zu einer unüberschaubaren Fülle (einige Tausend) von
Gesteinsnamen samt Varietäten und in der Wirtschaft genutzten
Namen in den letzten 200 Jahren geführt hat. Für bestimmte Gruppen
von Gesteinen wurden allgemein akzeptierte Klassifizierungen
erstellt (z. B. QAPF-Doppeldreieck nach STRECKEISEN für
magmatische Gesteine), die Eingruppierung in dieses System ist
jedoch ohne detaillierte Untersuchungen nicht möglich.
Ein Beispiel für die Schwierigkeit der Benamung von
Gesteinen möge dies erläutern:
Aus einer SiO2-reichen Schmelze kann eine Vielzahl von
Gesteinen entstehen, je nachdem wie lange die Schmelze abkühlt
(natürlich beeinflussen Druck, flüchtige Bestandteile usw. auch
die Genese): rasche Abkühlung erbringt ein Glas (Obsidian), viel
Gas und rasche Abkühlung ein schaumiges Glas (Bimsstein),
langsame Abkühlung (Rhyolith), geologisch langsame Abkühlung
(Granit), hoher Wassergehalt (Pegmatit) je langsamer die
Abkühlung, um so größer können die Kristalle wachsen. Aufgrund
der Größe von natürlichen Vorkommen kann dann der Rand eines
Ganges schnell, das Innere langsam abkühlen, so dass dann alle
denkbaren Übergänge auftreten können.
Literatur:
LORENZ, J. (1995): Spessartin oder Spessartit?.- Mitteilungsblatt
der Naturkundestelle Main-Kinzig, 7 (1), S. 35 - 37,
Gelnhausen
OKRUSCH, M. & MATTHES, S. (2009): Mineralogie. Eine Einführung
in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde.-
8. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 658 S., 438
Abb., davon 133 in Farbe), zahlreiche Tab., [Springer Verlag]
Berlin.
Spessartin:
Autorencollectif (2007): Ardoise et Coticule en Terre des Salm
Des Pierres & des Hommes. Les exploitations souterraines de la
commune de Vielsalm: un patrimoine géologique, historique,
culturel et biologique exceptionnel.- 408 pp., sehr viele farb.
Abb., Tab., Service géologique de Belgigue Département de
l´Institut Royal des Sciences naturelles des Belgique, Bruxelles.
Autorenkollektiv (2015): Grenats.- Le Cahier des Micromonteurs
Numero 129 - 3/2015, 218 S., sehr viele farb. Abb., L´Association
Francaise de Micromineralogie.
BACK, M. (2018): Fleischer´s Glossary of Mineral Species 2018.-
410 p., ohne Abb., The Mineral Record Inc., Tucson, Arizona, USA
BAXTER, E. F., CADDICK, M. J. & AUGE, J. J. [eds.] 2013:
Garnet.- Elements. An International Magazine of Mineralogy,
Geochemistry, and Petrology Vol. 9, Number 6 December
2013, p. 401 - 480, [Mineralogical Society of America].
CASSEDANNE, J. P. (1986): the Urucum Pegmatite · Minas Gerais,
Brazil.- the Mineralogical Record Volume 17, Number 5
September-October 1986, p. 307 - 314, 14 figs., [The Mineral
Record Inc.] Tucson.
COOK, R. B. (2009): Connoisseur´s Choice: Spessartine Marienfluss,
Northern Namibia.- Rocks & Minerals Volume 85, No. 1,
Jan/Feb 2010, p. 50 - 59, 24 figs., [Taylor and Francis Group]
Philadephia PA.
DEER, W. A., HOWIE, R. A. & ZUSSMANN, J. (1997): Rock Formig
Minerals, Vol. 1A Orthosilkates.- (2nd ed.), p. 590 - 602,
[The Geological Society] London.
American Min. 56, (1971) p. 791
BAUER, J., BOUSKA, V. & TVRZ, F. (1982): Edelsteinführer.- 227
S., [ARTIA-Verlag] Prag.
DAMASCHUN, F. & SCHMITT, R. T. (2025): Titanerze, Spessartin
und Schörl - Die Aufsammlung des Fürsten Gallitzin aus dem
Spessart.- S. 136 - 147, 22 Abb., 3 Tab.- in DAMASCHUN, F. &
SCHMITT, R. T. (2025): Uranentdeckung und Mineralanalysen. Die
Sammlung Martin Heinrich Klaproth im Museum für Naturkunde
Berlin.- 416 S., sehr viele farb. Abb., Tab., [Wallstein Verlag
GmbH] Göttingen.
DUNN, P. J. & MANDARINO, J. A. (1988): The Commission on New
Minerals and Mineral Names of the International Mineralogical
Association; Its history, purpose and general practice.- The
Mineralogical Record Vol. 19, p. 319 - 323, Tucson
(Arizona).
HOCHLEITNER, R. & WEISS, S. (2004): Steckbrief Spessartin.-
Lapis 29, Nr. 6, S. 8 - 11, 4 Abb., [C. Weise Verlag]
München.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 453ff.
LORENZ, J. (2018): Mangan – Spurenelement, Mineralbestandteil und
Stahlveredler. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 01/2018, S.
38 - 40, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.
MURAWSKI, H. (1992): "Nur ein Stein".- 308 S., Museen der Stadt
Aschaffenburg.
NICKEL, E. H. & NICHOLS, M. C. (1991): Mineral Reference
Manual.- 250 p., [Van Nostrand Reinhold], New York.
OTTENS, B. (2005): Tongbei Spessartine Localities, Fujian
Province, China.- The Mineralogical Record 36, Number 1,
January-February 2005, p. 35 - 43, 14 figs., [The Mineralogical
Record Inc.] Tucson, Arizona.
PALFI, A. (2006): Spessartin-Vorkommen im Kaokoland.- S. 138 -
143, 14 Abb.- in JAHN, S., MEDENBACH, O., NIEDERMAYR, G.
& SCHNEIDER, G. (2006): Namibia Zauberwelt edler Steine
und Kristalle Ein praktischer Ratgeber zum Entdecken,
Bestimmen und Sammeln in Namibia.- 2. Aufl., 286 S., mit
zahlreichen farbigen und wenige hist. SW-Bildern, Tabellen,
Grafiken und Karten, [Bode Verlag] Haltern.
RAMDOHR, P. & STRUNZ, H. (1978): Klockmanns Lehrbuch der
Mineralogie.- 16. Aufl., überarbeitet und erweitert, 876 S.,
[F. Enke Verlag] Stuttgart.
SCHREYER, W., BERNHARDT, H.-J. & MEDENBACH, O. (1992):
Petrologic evidence for a rhodochrosit precursor of spessartine in
coticules of the Venn-Stavelot Massif, Belgium.- Mineralogical
Magazine Vol. 56, p. 527 - 532, fig. 5., 1 tab.,
THOMPSON, W. A. (2007): Ikons Classic and Contemporary
Masterpieces of Mineralogy.- The Mineralogical Record Supplement
Vol. 38, No. 1, January-February 2007, 192 p., sehr viele
großformatige Abb., Tucson.
WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- 246 S., [Bay. Geolog.
Landesamt] München.
WHITE, J. S. (2009): Spessartine from the Navegadora Mine · Minas
Gerais, Brazil.- Rocks & Minerals Volume 84, No. 1,
Jan/Feb 2009, p. 42 - 45, 6 figs., [Heldref Publications]
Washington DC.
Spessartit:
LE MAITRE (Ed.) (2003): Igneous Rocks A Classification and
Glossary of Terms. Recommendations of the IUGS Subcommission on
the Systematics of Igneous Rocks.- reprint, 236 S., einige Tab.
und Fig., [Cambridge University Press] Cambridge, UK.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 698ff.
LORENZ, J. (2019): Spessartit - Das exotische Gestein, welches
nach dem Spessarts benannt wurde.- NOBLE Magazin Aschaffenburg,
Ausgabe 02/2019, S. 52 - 54, 13 Abb., 1 Tab., [Media-Line@Service]
Aschaffenburg.
LOTH, GEORG., GEYER, GERD., HOFFMANN, UWE, JOBE, ELISABETH,
LAGALLY, ULRICH, LOTH, ROSEMARIE, PÜRNER, THOMAS, WEINIG, HERMANN
& ROHRMÜLLER, JOHANN (2013): Geotope in Unterfranken.-
Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band 8, S.
56, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten, Profile, Hrsg.
vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei Joh. Walch]
Augsburg.
MARESCH, W., MEDENBACH, O. & TRIOCHIM H.-D.(1987): Gesteine.-
Die farbigen Naturführer, 287 S., [Mosaik Verlag] München.
WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- 246 S., [Bay. Geolog.
Landesamt] München.
WEINSCHENK, E. (1915): Die gesteinsbildenden Mineralien.- 3.
Aufl., 261 S., mit 300 Texfig., 5 Tafeln und einfach gefalteten 22
Tab. als loses Heft im Anhang (Einschub), [Herdersche
Verlagshandlung] Freiburg im Breisgau.
WIMMENAUER, W. (1985): Petrographie der magmatischen und
metamorphen Gesteine.- 382 S., [F. Enke Verlag] Stuttgart.
WROBEL, P (2001): im Druck
Zurück zur Homepage
oder zurück an den Anfang der
Seite