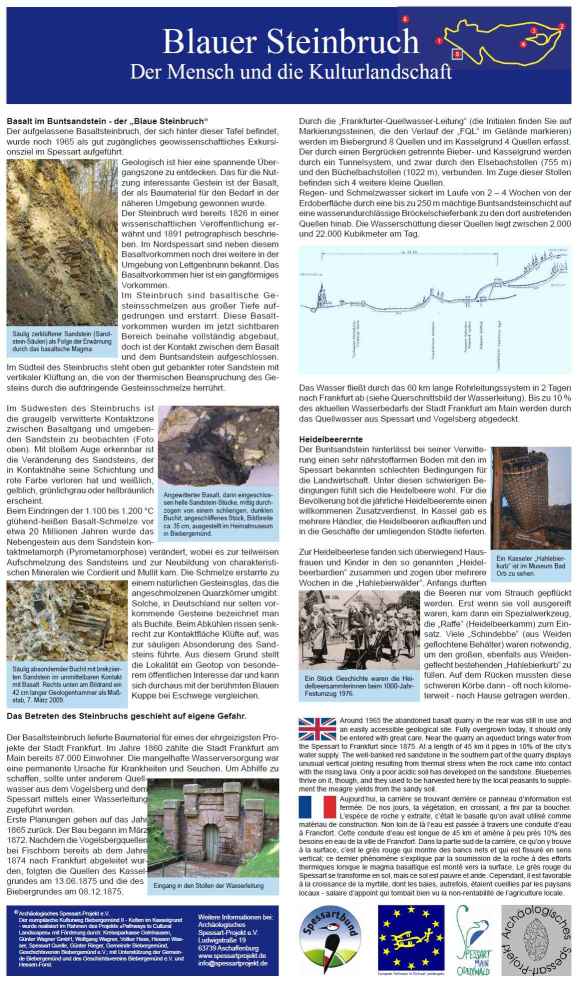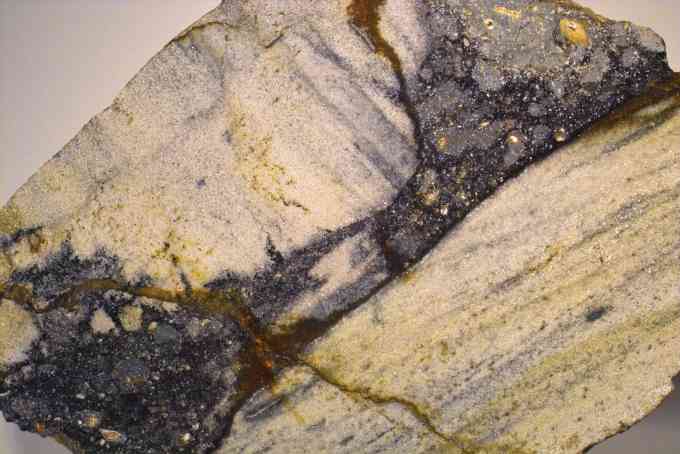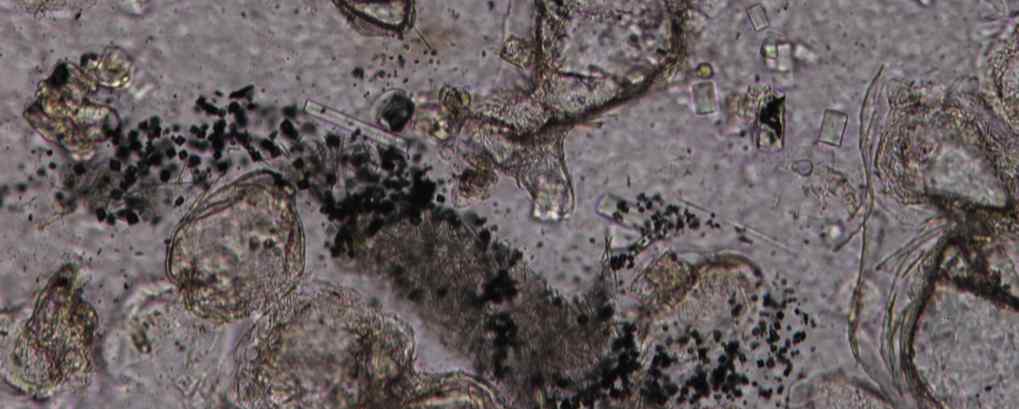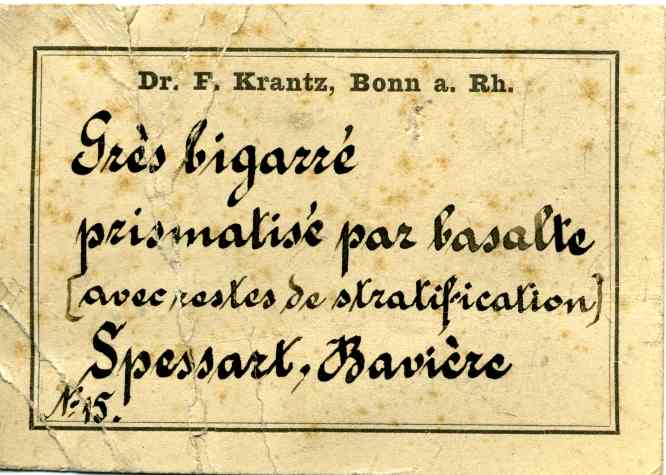Der Buchit* und
die Sandstein-Säulen
im Basalt-Steinbruch bei
(Biebergemünd)Kassel
im nordwestlichen Spessart.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Der kleine, alte und völlig überwachsene Steinbruch - nach dem
Herstellen des neuen Schurfs am 07.03.2009.

Buchit als dunkles, schlieriges Gesteinsglas im brekziierten
Sandstein mit
verwittertem Basalt, angeschliffenes Stück;
Bildbreite ca. 35 cm.
(Das Stück liegt im Heimatmusem Biebergemünd).
*Buchite (nach dem berühmten Geologen Leopold von BUCH
(*1774 †1853)
sind pyrometamorph (niedriger Druck, aber hohe Temperatur)
gebildete Gesteinsgläser die beim Kontakt einer basaltischen
Schmelze mit Sandstein entstehen. Sie bestehen vorwiegend aus Glas
mit einem ganzen "Zoo" an neu gebildeten Mineralien wie Mullit,
Spinell, Magnetit, Tridymit, Cordierit, Klinopyroxene und andere.
Diese sind aber nur im Dünnschliff unter dem Mikroskop bei hoher
Vergrößerung sichtbar - siehe unten.
Lage:
„Blauer Steinbruch“ unweit des Forsthauses Kassel (Biebergemünd),
ca. 250 m östlich davon (TK 5821 Bieber, siehe Okrusch et al.
2011, S. 208, Aufschluss Nr. 100) am Ende der Villbacher Straße.
Das ansteigende Gelände des ehemaligen Steinbruches ist weitgehend
verfallen und nur an einer Stelle sind noch Sandsteinfelsen zu
erkennen. Rechts und links des Weges finden sich die Halden. Am
Weg wurde eine Tafel des Kulturrundweges „Kelten im Kasselgrund“
als Nr. 5 aufgestellt. Davor sind 2 große Basaltsäulen (diese
stammen nicht aus dem Steinbruch, sondern vermutlich aus dem nahen
Vogelsberg; sie gehören nicht hierher und sollten entfernt werden;
Anschauungsmaterial ist im Steinbruch reichlich vorhanden.)
positioniert worden:

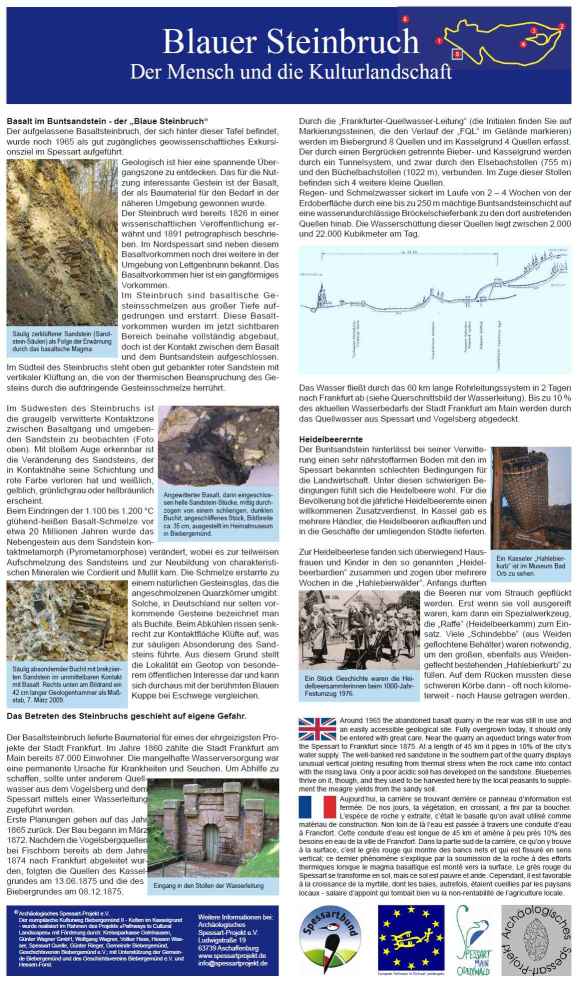

Am Sonntag, den 17.04.2016 wurde im Rahmen einer Führung von Peter
WARMBOLD vom Geschichtsverein Biebergemünd
die neue Tafel ihrer Bestimmung übergeben (wenn Sie das Bild der
Tafel anklicken öffnet sich eine Datei, so dass man den Text
lesen kann).
Rechts: Josef ACKER aus Kassel vom Geschichtsverein Biebergemünd
hat dankenswerterweise die beiden Basaltsäulen, die
nicht aus Kassel stammten, entfernt und durch Steine aus dem
"blauen Steinbruch" ersetzt;
aufgenommen am 07.08.2020.
Das Betreten des Steinbruches erfordert nach Regen oder Nässe
mindestens knöchelhohe Schuhe oder besser Gummistiefel. Das letzte
Stück bis zum neu geschaffenen Aufschluss ist sehr steil und nicht
behindertengerecht. Dazu wachsen dort Brennesseln, so dass lange
Hosen angekündigt sein sollten.
Geologie:
Im Tertiar (genauer ist das nicht bekannt) stiegen basaltische
Schmelzen in den hier viele hundert Meter mächtigen Sandstein auf
(wie am Beilstein bei Villbach und bei Bad Orb (Madstein und Hoher
Berg)). Ob die Schmelze die damalige Landoberflächer erreichte ist
nicht bekannt. Damit weiß man auch nicht, ob die Stelle als Vulkan
zu bezeichnen wäre. Wann das genau geschah, ist war bisher nicht
bekannt, wurde aber im Zuge weiterer Untersungen mittels Isotopen,
wie dem 40K, ermittelt. Das Ergebnis ist ein Alter von
18,1 ± 0.3 oder 19,3 ± 0.4 Ma (OKRUSCH et al. 2020).
Die ca. 1.150 °C heiße Gesteinsschmelze drang in den kalten
Sandstein ein und reagierte damit. Einerseits wurde der Sandstein
mechanisch brekziiert, angeschmolzen und es bildete sich im
direkten Kontakt ein braunes bis graues Gesteinsglas, welches als
Buchit, bezeichnet wird. Der unscheinbare Buchit enthält
zahlreiche Mineralneubildungen wie Mullit, Cordierit, Pyroxen,
Magnetit und andere Phasen in mikroskopischen Abmessungen. Dabei
sind alle denkbaren, fließenden Übergänge zwischen den Gesteinen
zu beobachten; es ist im Handstück im Steinbruch oft schwer, zu
entscheiden, was das ist. In etwas größerer Distanz wurde der
Sandstein gefrittet, d. h. angeschmolzen, aber die Quarzkörner des
Sandsteins sind noch sichtbar.
Beim langsamen Abkühlen über einige Jahre bildeten sich
Kontraktionsrisse, die den Sandstein zu einem polygonalen Muster
zerlegten, so dass es dort Sandstein-Säulchen gibt, was sonst nur
von den Basalten oder Rhyolithen bekannt ist. Dies ist eine extrem
seltene Besonderheit, die man in dem neu geschaffenen Schurf
wieder sehen kann. Dabei stehen die Säulen senkrecht zur
Abkühlungsfläche; da der Basalt weitgehend abgebaut wurde, sieht
man heute auf die Strirnseiten der Säulen.
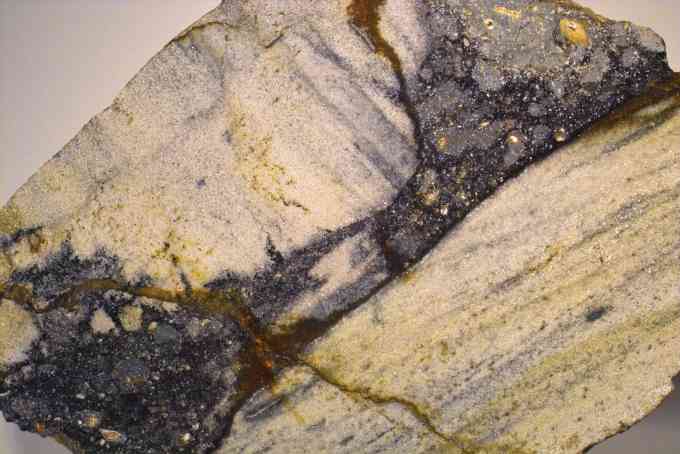

Links: Buchit mit Basalt im brekziierten Sandstein in
unterschiedlicher Orientierung, angeschliffen und poliert;
Bildbreite ca. 8 cm,
rechts Basalt aus dem Steinbruch bei Kassel, angeschliffen und
poliert;
Bildbreite ca. 12 cm.


Links: Gefritterer Sandstein mit dunklem Buchit, angeschliffen und
poliert,
Bildbreite ca. 15 cm.
Rechts: Das Vorkommen von gefrittetem, brekziösem Sandsteinen als
polygonale Säulen und teils als grauer bis brauner Buchit im
Steinbruch
(Hammer mit 40 cm Länge als Maßstab);
aufgenommen am 07.03.2009.
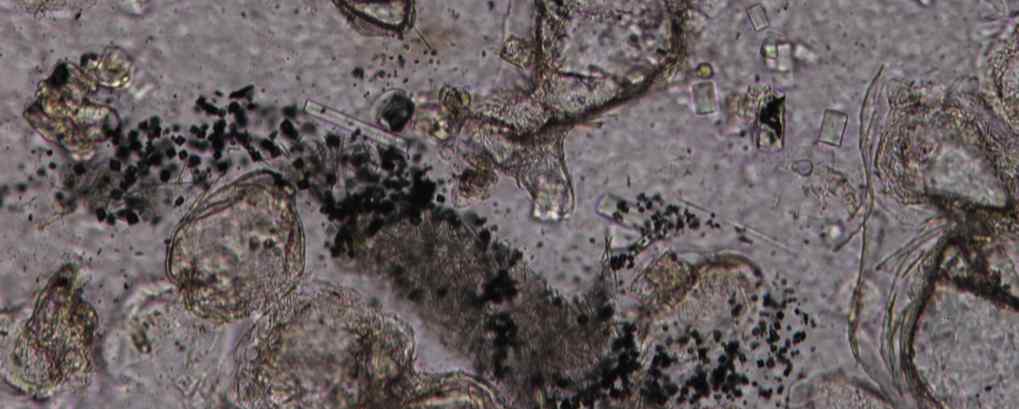
Der Blick durch´s Polarisationsmikroskop bei linear polarisiertem
Licht offenbart in dem natürlichen Glas Buchit einen
ganzen "Zoo" an kristallinen winzigen Neubildungen wie Mullit
(feiner Nadelfilz), Cordierit (farblose Täfelchen, siehe
ganz unten), Pyroxen als Nadeln und Spinell (schwarz) neben
einigen "unverdauten" Quarzkörnern aus dem Sandstein
mit einem Saum aus Tridymit;
Bildbreite 1 mm.


Links: Polygonale Sandsteinsäulen, links anstehend im Steinbruch
nach der Freilegung mit dem Bagger (rechts befand sich früher der
Basalt, der zur Schottergewinnung abgebaut wurde);
aufgenommen am 07.03.2009
Rechts: kleine Sandsteinsäulen in der Sammlung;
Bildbreite ca. 17 cm.
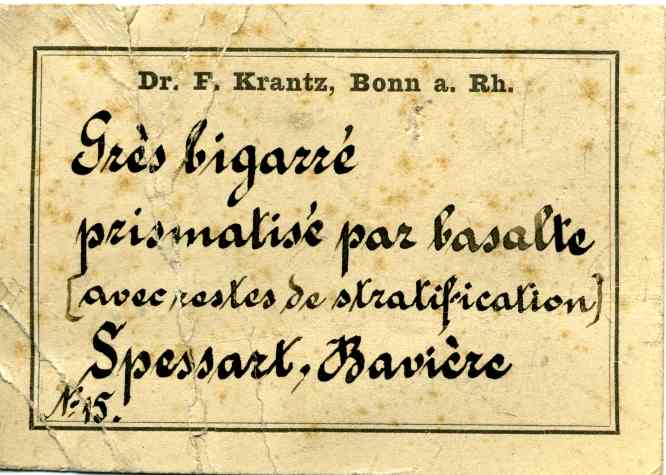
Alter, geduckter Sammlungszettel der Mineralienhandlung Dr. F.
Krantz
in Bonn mit Rahmen auf einem sehr stabilen, dicken Karton mit
einem
handschriftlichen Eintrag in französischer Sprache, dem man dem
Vorkommen von Kassel zuordnen kann; Übersetzung: "Buntsandstein
prismenfömig durch Basalt [mit Resten der Schichtung], Spessart.
Bayern Nr. 15".
Bildbreite 7 cm.
Anmerkung:
Aufgrund des Aufdruckes des Labels ist dieser nach 1890 entstanden
und vermutlich vor 1910. Kassel ist das einzige Vorkommen im
Spessart, von dem prismatische Sandstein-Säulen aus einem Kontakt
zum Basalt lange bekannt sind. Sicher liegt (Biebgemünd-)Kassel
nicht in Bayern, aber aus Bonner Sicht ist der größte Teil des
Spessarts bayerisch. Der Verbleib des zugehörigen Stückes ist
nicht bekannt; den Hinweis zu dem Zettel verdanke ich dem
bekannten Mineraliensammler Karlheinz GERL, Oberkotzau,
25.10.2012.
Geschichte:
Das gangförmige, ca. 30 m mächtige Basaltvorkommen wurde bereits
um 1825 entdeckt und sehr knapp in einer Auflistung angeführt. Der
erste gute Beschreibung lieferte der Mineraloge Hugo Bücking 1892,
der auch mittels Dünnschliffen die Mineralien in den neu
gebildeten Gläsern erwähnt. Sonst ist die vorhandene Literatur
sehr spärlich und eine moderne Beschreibung der Gesteine fehlt.
Dass das Gestein beim Bau der Fernwasserleitung nach Frankfurt
(1875) Verwendung gefunden haben soll (wie auf der
Erläuterungstafel beschrieben), ist unwhrscheinlich, da zu diesem
Zeitpunkt der Steinbruch bereits unergiebig war. Der benachbarte,
stark geklüftete Sandstein war unerwünscht und wurde auf Halden
verworfen und damit Teile des Steinbruches wieder verfüllt.
Im Zuge der Errichtung des Kulturrundweges 2005 wurde ein Teil der
Vegetation zurück geschnitten. Am 23.02.2007 wurde vom Geschichtsverein
Biebergemünd e. V. unter Leitung von Herrn Albrecht STAAB
mit einem Bagger ein Teil der Vegetation weggeschoben und 3 Löcher
angelegt, wo man den Kontakt vermutete. Wie eine Begehung am
03.03.2007 nach den sehr reichlichen Regenfällen zeigte, leider
die falschen Stellen und an der "richtigen" Stelle wurde zu wenig
Abraum weggebaggert. Aber es konnte ein ca. 30 kg schwerer
Sandstein mit Buchit geborgen werden, der heute im Museum in
Bieber liegt.
Eine Stelle im Aufschluss wurde durch Absprache von Josef ACKER
aus Kassel am 07.03.2009 vom Geschichtsverein Biebergemünd wieder
freigelegt, so dass der Gesteinsverband wieder sichtbar ist. Die
Besonderheit sind gefrittete bis aufgeschmolzene Sandsteine mit
Buchit und kleinsäulig absondernde Sandsteine (!) im Kontakt zum
Basalt. Die Lokalität ist ein Geotop von besonderem Wert, ähnlich
der berühmten Blauen Kuppe bei Eschwege.



Der Beginn der Aufwältigungsarbeiten am 07.03.2009, der die
Maschinen bis an die Grenzen des Machbaren forderte; rechts der
virtuos arbeitende Herr Dieter BECKER
von der Fa. Baustoff Becker (auch Erdbau und Holztransporte) in
Biebergemünd-Kassel, hier neben der frisch frei gelegten
Steinbruchswand; ganz rechts die beteiligten
Akteure (von links Josef ACKER, Dieter BECKER, Friedel
WAIDNER und Joachim LORENZ; es fehlt Albrecht STAAB) vor der
fertig gestellten Steinbruchwand mit
Basalt und Buchit.
Wichtiger Hinweis und Bitte:
Es wird gebeten, dass man(n)/frau an
der neu geschaffenen Wand keine Proben entnimmt, so dass alle
Besucher möglichst lange den gleichen Eindruck der
Verhältnisse sehen können. Der Aushub von mehreren Kubikmetern
wurde davor so platziert, dass über Jahre anschauliche Proben
gefritteter Sandsteine und kleine Säulchen aufgesammelt werden
können.
Der bedeutende Aufschluss wurde inzwischen als wertvolles
Geotop vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie in
Wiesbaden gelistet und wird als eindrucksvoller angesehen, als
die berühmte Blaue Kuppe bei Eschwege.
Mitarbeiter des Forstes haben inzwischen eine benachbarte Buche
gefällt und damit den Schattenwurf durch den Baum entfert, so dass
die Sonne die Steinbruchwand dauerhaft erreichen kann. Danke
dafür!

Für die Mitglieder der Geschichtsvereins und Interessierte aus der
gesamten
Region (sogar aus Offenbach kamen Besucher!) fand am Sonntag, den
05.04.2009 eine Führung durch Joachim LORENZ statt. Der
Geschichtsverein
rief und es kamen etwa 80 Erwachsene mit einigen Kindern! Während
dieser
kurzen Exkursion wurde in einer 3/4
Stunde über den bunten Sandstein, den
Basalt, den Kontakt und die historische Erforschung des
einzigartigen
Aufschlusses gesprochen. Bei sonnigem und warmen Frühlingswetter
konnte man sogar auf die sonst notwendigen Gummistiefel
verzichten.

Die Steinekinder und deren Eltern, Josef ACKER vom
Geschichtsverein Biebergemünd
und Max RETTINGER vom Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg
schaufelten
und trugen die in den letzen 11 Jahren abgefallenen Gesteinsmassen
von dem Geotop.
Wir schafften somit auch eine Stelle, an der man den gefrittenen
Sandstein nach einem
reinigenden Regen leicht aufheben kann, ohne an der Wand klopfen
zu müssen;
aufgenommen am 25.10.2020.
Nun wurde das große Stück mit dem schlierigen Buchit zersägt und
davon Dünnschliffe hergestellt, die neu untersucht u. a. mit der
Mikrosonde analysiert werden sollen. Dies ist die Basis für eine
neue Arbeit zu dem Buchit aus Kassel. Dabei liegt der Schwerpunkt
auf die Chemie und die Zusammensetzung der Komponenten, so dass
man eine genetische Entwicklung ableiten kann. Die Analysen der
winzigen Kristalle (meist unter 10 µm) im Glas mit der Mikrosonde
erwiesen sich als sehr schwierig, da man ja nur dort analysieren
kann, wo der Schliff das Mineralkorn schneidet. Und man sieht in
der Mikrosonde keine Farben, so dass man die Kristalle auch noch
suchen muss, das die Silikate sich kaum von Glas abheben.
Literatur:
BOHATÝ, J. (2016): Anstehend verglaster Buchit (KLIPSTEIN 1827) sensu
stricto vs. Exotzamit nom. nov. – ein neuer Name für
pyrometamorph verglaste, siliziklastische Krusten-Xenolithe mit
äußeren Glasschmelzkrusten.- Mainzer naturwiss. Archiv 53
S. 5 – 47, 4 Abb., 12 Taf., Mainz.
BÜCKING, H. (1892): Der Nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der
Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge 12,
VIII + 274 S., 1 geolog. Karte, 3 ausklappbare Tafeln mit 11
farbigen Profilen, [S. Schropp´schen Hof-Landkartenhandlung]
Berlin.
GRAPES, R. (2006): Pyrometamorphism.- 275 p., 192 figs., [Spinger
Verlag] Berlin.
KAPP, C. (1834): Neptunismus und Vulkanismus in Beziehung auf v.
Leonhard´s Basalt-Gebilde.- 222 S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´s
Verlagshandlung] Stuttgart.*
LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung
zu normalen und abnormen Felsmassen.- Erste Abtheilung XXII + 498
S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.
LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung
zu normalen und abnormen Felsmassen.- Zweite Abtheilung X + 536
S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.
LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung
zu normalen und abnormen Felsmassen.- Atlas, 8 S., XX Tafeln mit
Ansichten und kolorirten Durchschnitten [E. Schweizerbart´sche
Verlags-Handlung] Stuttgart.
LORENZ, J. & OKRUSCH, M. (2010): Der Buchit vom Kasselgrund
(Gemeinde Biebergemünd) im Spessart - ein bemerkenswertes
Kontaktgestein. Durch die basaltische Schmelze im Sandstein
entstanden auch Sandsteinsäulen. - S. 55 - 65, 13 Abb., in: Die
Alteburg bei Biebergemünd-Kassel. Geologische und historische
Besonderheiten am Kulturweg "Kelten im Kasselgrund.- 65 S.,
[Geschichtsverein Biebergemünd e. V.] Biebergemünd.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 144, 611ff.
LORENZ, J. & OKRUSCH, M. (2010): Der Buchit vom Kasselgrund
(Gemeinde Biebergemünd) im Spessart - ein bemerkenswertes
Kontaktgestein. Durch die basaltische Schmelze im Sandstein
entstanden auch Sandsteinsäulen. - S. 55 - 65, 13 Abb., in: Die
Alteburg bei Biebergemünd-Kassel. Geologische und historische
Besonderheiten am Kulturweg "Kelten im Kasselgrund.- 65 S.,
[Geschichtsverein Biebergemünd e. V.] Biebergemünd..
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, S. 156f, Berlin.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
OKRUSCH, M., SCHÜSSLER, U., VAN DEN BOGAARD, V, KOGLIN, N., BRÄTZ,
N., LORENZ, J., KARBUSICKA, C. & SPIEGL, T. (2020) Isolated
alkali basalt occurrences in the northern Spessart, Germany:
Outposts of the Early Miocene Vogelsberg shield volcano?- Neues
Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen. Journal of Mineralogy and
Geochemistry, Band 196 Heft 3, p. 199 - 219, 8 figs., 5
tab., [Schweizerbart Science Publishers] Stuttgart.
*Das Buch über den Neptunisten-Plutonisten-Streit ist ganz schwer
zu lesen und eine Anwort auf eine Rezension des Leonhard´schen
Werkes über den Basalt in München. Nach meiner Meinung hatte man
die Fakten auf 30 Seiten unterbringen können. Aber die
weitscheifig-blumigen Schmähungen sind auch schon eine
literarische Sonderklasse. Und man kann das nur verstehen, wenn
man die Beteiligten und deren Publikationen kennt. KAPP war wohl
an Ostern 1833 an der Kahler Kupferhütte beim Bergmeister A.
Bezold und bekam hier Gesteinsproben aus Kassel vorgelegt, die
denen aus dem Kahler Hochofen(?) sehr ähnlich waren (KAPP 1834:8).
Die Alteburg bei Kassel:
Nur ca. 1 km entfernt ist der Berg Alteburg, auf dessen Gipfel
sich ein imposanter, ca. 1,1 km langer keltischer Ringwall mit
Graben und 2 Toren befindet. In dem Bereich wurde 2004 eine
Ausgrabung in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein von
Biebergemünd veranstaltet. Der Befund mündete in eine wenige m
lange Rekonstruktion der Mauer aus Holz und Sandstein (mörtelloses
Trockenmauerwerk), so dass man sich ein Bild machen kann, wie die
Anlage vor mehr als 2500 Jahren ausgesehen hat. Dabei handelte es
sich um eine Höhensiedlung, die sicher über einen längeren
Zeitraum bewohnt war. Neben einem eisernen Tüllenbeil fand man
auch römische Keramik.
Das größte Bauwerk in Biebergemünd ist durch den Kulturrundweg
„Kelten im Kasselgrund“ erschlossen und mehrere Tafeln erläutern
die keltischen Bewohner.

Die Rekonstruktion der Mauer um die Alteburg bei Kassel
(Biebergemünd);
aufgenommen am 17.04.2011.
Cordierit
Der Cordierit in Kassel ist eine Besonderheit im Spessart, aber
nur mit dem Mikroskop zu sehen. Aus anderen Regionen und
Gesteinsvorkommen sind größere Kristalle bekannt:

Blick auf die Spaltflächen eines größeren
Cordierit-Kristalls im Quarz
eines Pegmatits, gefunden 1979 in Tvedestrand, Süd-Norwegen;
Bildbreite 8 cm.
Das Mineral Cordierit (benamt nach dem französischen
Bergbauingenieur und Geologen Pierre Louis A. CORDIER *1777 †1861) gehört zur Klasse der
Kettensilikate mit der idealisierte chemischen Zusammensetzung
(Mg,Fe)2[Al4Si5O18].
Es ist etwas härter als Quarz und lässt sich spalten. Cordierit
kommt in Gneisen, Graniten und Pegmatiten, aber auch in
Erzlagerstätten vor. Das oft bläuliche Mineral bildet
sechsseitige Kristalle aus, die in seltenen Fällen bis zu 20 cm
lang werden können. Eine wirkliche Besonderheit ist die optische
Eigenschaft des Pleochroismus, der an manchen Kristallen mit dem
bloßen Auge im Durchlicht wahrgenommen werden kann: von einer
Seite ist der Kristall violettblau und nach einer Drehung um 90°
ist der rauchgrau!


Cordierit, geschliffen im Gegenlicht in unterschiedlicher
Orientierung, so dass die verschiedenen Farben des Pleochroismus
zu sehen sind,
ohne Fundort;
Bildbreite 2,5 cm.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite