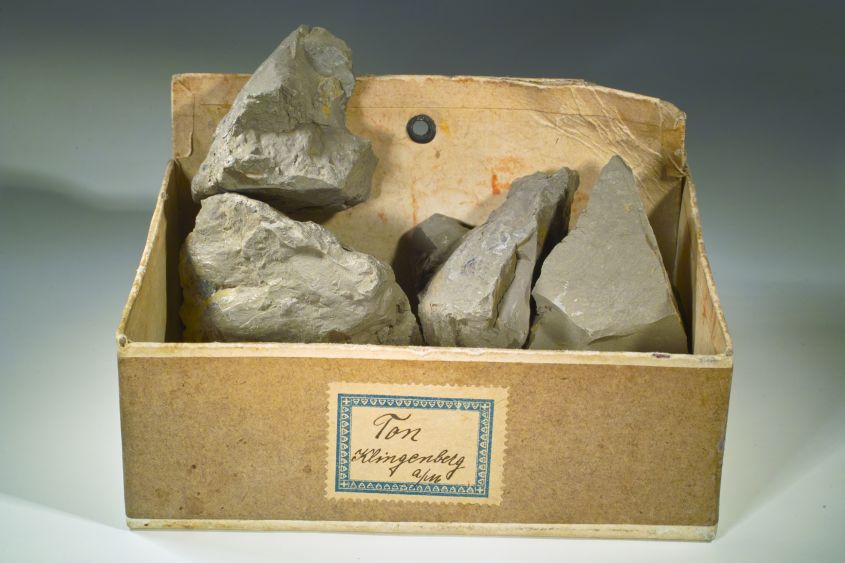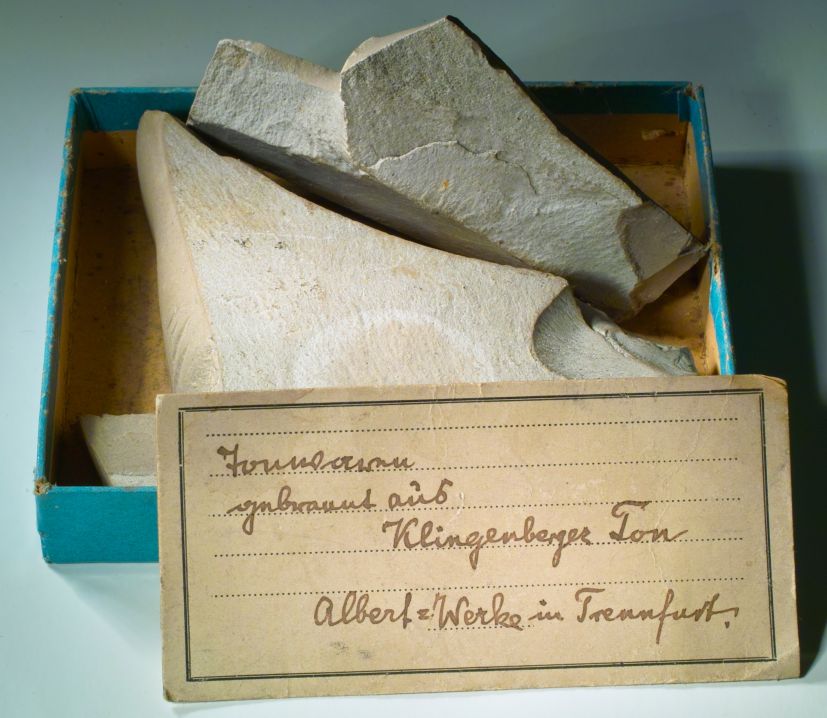Das ehemalige Tonbergwerk
(untertägig!) (1567) 1742 - 2011
und die Seltenbachschlucht
bei
Klingenberg am Main
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Ein Teil der Tagesanlagen mit der Sortieranlage
über dem Silo des kleinen Bergwerkes, rechts dasmit Tonbrocken
gefüllte Silo;
aufgenommen am 18.06.1993.
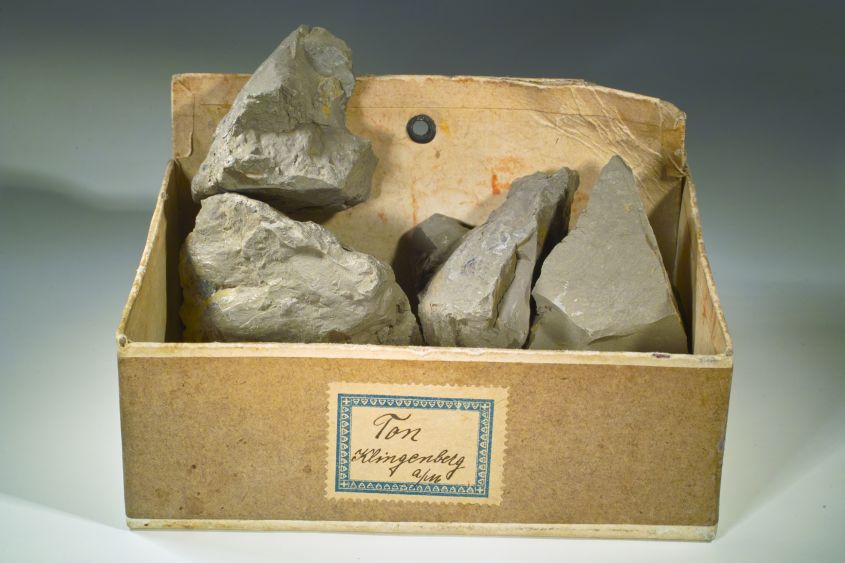
Tonproben aus Klingenberg, einst in einer
schulischen Lehrsammlung zum
Begreifen genutzt und wohl um die Jahrhundertwende 1900 (±15
Jahre)
zusammen gestellt,
Bildbreite 17 cm.
Ton ist das Gestein des Jahres 2025!
Weltweite Verwendung fand der "Bleistiftton" aus
Klingenberg, der untertägig abgebaut wurde. Das Vorkommen ist
seit langem bekannt und auch berümt wegen des daraus
erwirtschafteten „Bürgergeldes“ bei gleichzeitiger
Steuerfreiheit für die Bürger Klingenberges (SCHOBER
1905:131f). Als Besonderheit konnte der Autor 1993 und 2010
eine Befahrung dort unternehmen. Das Bergwerk wurde am
16.12.2011 geschlossen (SCHREINER 2011).
Das Bergwerk wurde nach der Schließung gesichert, verfüllt und
verschlossen. Heute hat der LBV die Außenanlagen unter seiner
Pflege. Eine Interessengemeinschaft will die Tradition des
Bergwerks erhalten. Führungen der Übertageanlagen werden von
den Bergleuten angeboten.
Hinweis:
Es handelte sich nicht um ein Besucherbergwerk, denn die
Untertageanlagen sind so eng und klein dass allenfalls wenige
Personen dort laufen können. Nach einer Befahrung besitzt man die
Farbe des Tones.
Lage:
Das Gelände der Tongrube liegt in einer Talsenke, welches der
Erosionsrest eines ehemaligen Stillwasserabsatzes darstellt. Die
Anlagen finden sich zu beiden Seiten der Straße von Klingenberg
nach Schmachtenberg (TK 1:25.000 Blatt 6221 Miltenberg R 1480 H
1640, siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 131, 231, Aufschluss Nr. 151).
Einen kleinen Einblick in die Bergbauwelt des Tonbergbaues mit
zwei verschieden alten, nachgebauten Strecken, samt Schaubilder
und der aus dem Ton hergestellten Produkte gibt das Heimatmuseum
in Klingenberg. Hier sind auch Bilder ausgestellt, welche einen
Einblick in die Historie des Tonabbaues geben.
Geologie:
Die Klingenberger und Schippacher Tone zählen qualitätiv in ihrer
Art zu den besten der Welt. Ihre hervorragenden technischen
Eigenschaften beruhen auf mehreren Faktoren: Die Tone sind
hochplastisch, homogen und gleichmäßig feinkörnig mit einem
Kornanteil <2 µm von 85-98 Gew.-%. Die mineralogische Analyse
der Klingenberger Tone ergibt
ca. 61 % Kaolinit,
4 % Montmorillonit,
10 % Muskovit und
25 % Quarz und Feldspat.

Tonschnitzel im Lager, Bildbreite ca. 40 cm
Durch den hohen Kaolinit-Gehalt erreicht man Seeger-Kegel-Werte
von 32-33. Die chem. Analyse ergibt etwa folgende Zusammensetzung
(getrocknete Substanz):
| Bestandteil: |
Gew.-%: |
| SiO2 |
49,0-54 |
| Al2O3 + TiO2 |
29,9-33,3 |
| Fe2O3 |
1,8-6,1 |
| MgO |
0,01-1,4 |
| CaO |
0,07-0,8 |
| Na2O+K2O |
0,4-2,4 |
| Glühverlust |
ca. 10 |
Die dunklen Bleistifttone enthalten 0,17 - 0,34 % organischen
Kohlenstoff (Angaben nach DOBNER (1984:477).
Der Ton kann auch als "Heilerde" verwandt werden. Insbesondere
der Montmorillonit bindet aufgrund der riesigen inneren Oberfläche
niedermolekulare Stoffe im Magen, so dass man davon eine ähnliche
Wirkung wie bei Aktivkohle erwarten kann.
Befahrungsbericht:
Nach einem Telefonat mit Herrn Werner FELICITTI hatte ich am
18.06.1993 die Möglichkeit, das kleine Bergwerk zu befahren. Zur
damaligen Zeit arbeiteten 9 Personen im Betrieb, der
eigenbilanzierend der Stadt Klingenberg gehört. Ich wurde von
Herrn HERBERICH geführt, der schon seit 34 Jahren dem Betrieb
angehörte. Er erzählte mir die Geschichte und die Technik des
Abbaues - im Prinzip das, was auch schon Herr FREYMANN ausgeführt
hatte. Die sicher beste Beschreibung der Tongrube und des Abbaues
schrieb der ehemalige Betriebsleiter EHRT (2008).
Die Übertageanlagen bestanden aus einem hölzernen Silohaus mit
einer Sortieranlage im Obergeschoss, einem kleinen Büroanbau an
dem Gebäude, wo Schnitzelwerk, Trocknung, Mahlung und Absackung
vorgenommen wird (letzteres wurde 2012 abgebrochen). In der Senke
über dem Tonvorkommen befand sich ein Schuppen mit Grubenholz -
aus den umliegenden, städtischen Wäldern. Weithin hörbar erzeugte
neben dem Mundloch ein Kompressor die notwendige Druckluft.
Auf einem Bohlenweg ging man zum Blindschacht im Buntsandstein,
der hier wegen der besseren Standfestigkeit aufgefahren wurde. Die
Senke, verursacht durch den absackenden Ton, ist mit einem
schilfumstandenen Weiher gefüllt. Er beherbergt neben Fröschen und
Kröten auch eine interessante Flora; eine große Ringelnatter quert
unseren Weg.

Ein Mann bediente den Förderkorb für das Personal
(4-6 Mann) und die Loren, welche
auf Schienen von Hand geschoben wurden. Im Bedienstand wohnen
3-4 Siebenschläfer,
die hier auch mit Obst gefüttert wurden. Die Förderung lag
damals bei ca. 250 bis 300 t/Monat.
Wir fuhren mit 2 m/sec ein, sahen das Gegengewicht vorbeihuschen
und im Hintergrund die Aluminium-Fahrten für den Notfall, dass die
Fördermaschine nicht funktionieren sollte. Im Sandstein sickert
Wasser ein, so dass es dort tröpfelt. An den Wänden dokumentierten
weiße bis braune Sinterschichten den Kalkgehalt des Wassers.
Kleine Stalagtiten erreichen 5 cm Länge bei 5 mm Durchmesser,
Stalagmiten 10 cm bei 3 cm Dicke. Das Wasser wurde aus einem Sumpf
mittels 2er, wechselseitig laufenden Pumpen gesümpft.
Die 60m-Sohle diente nur der Bewetterung wie auch als
Rettungsstollen. Wir befuhren die 70m-Sohle. Sie ist begann im Ton
und war mit Stahltübbings ausgebaut (röhrenförmig aus je 3
Segmenten im Abstand von ca. 0,5 - 1 m. Als Hinterfütterung wurde
Stahl verwendet. Weiter im Ton wurden auch Eisenbahnschienen und
alte Leitplanken verwendet. Vor Ort fand sich dann der Ausbau aus
Holz, als Türstock mit Holzbalken.

Da der Ton sich unter dem Druck des überlagernden
Gebirges plastisch verhält, schließ sich eine nicht
ausgebaute Strecken nach spätestens 8 Wochen. Der
Ton dichtet so gut, dass kein Wasser eintritt. Methangas
wird überwacht, stellte aber kein Problem dar. Bei der
Gewinnung wurden ständig alte, gut erhaltene
Grubenausbaue früherer Perioden angetroffen und
mussten mühsam ausgesondert werden.

Die Gewinnung erfolgte mittels Pressluftspaten.
Eine Mechanisierung konnte bis zur
Schließung infolge der Haftung des Tones nicht erreicht werden.
Die gewonnenen,
kg-schweren Tonbrocken wurden auf eine Holzrutschen, die
angefeuchtet war, abschüssig
bis zu den Loren gefördert. Die Strecken im Ton waren nicht
beleuchtet. Lediglich eine
Wetterlutte und Pressluft wurd vor Ort gebracht.
An vielen Stellen war der enorme Gebirgsdruck zu sehen.
Eingebrochene Hölzer oder Verbaue - selbst Eisenbahnschienen
wurden zerbrochen - mit dahinter hervorquellendem Ton zeugten von
den Kräften. Selbst durch kleine Ritzen oder Spalten drückte sich
der Ton als kleine Wurst.
Die Arbeiter begannen ihre Schicht um 6 Uhr und sie endete um
14.30 Uhr.

Klingenberger Ton mit einem großen Bleichungshof.
Den kg-schweren Tonbrocken entnahm ich
am 14.10.2010 auf der 65-m-Sohle. Trotz des langsamen Trocknens
wurde der rissig;
Bildbreite 17 cm.
Die aus dem Schacht kommenden Loren wurden um 180° gedreht, um
sie auszukippen. Ein Förderband förderte nach Qualität in 2 Silos,
von wo aus sie in die Aufbereitung der Übertageanlagen gefahren
wurden.
Dort wurde der Ton gehobelt oder besser geschnitzelt. Anschließend
folgte die Trocknung der 3 bis 15 mm großen Teile in einem
Drehrohrofen, der ölbefeuert war. Ein Teil wurde anschließend
abgesackt, der andere gemahlen und anschließend ebenfalls in
Papier- oder Jutesäcke gefüllt. Sie wurden mit einen speziellen
Nähmaschine zugenäht.
Die besten Qualitäten des fast schwarzen Tons gingen in alle
Länder der Welt, da es nahezu kein Konkurrenzprodukte für die
Bleistiftherstellung gabt. Die hellen Tone wurden der keramischen
Industrie zugeführt, die daraus Tiegel, Isolatoren usw. herstellt.
Durch die Arbeit von Herrn EHRT wurde der Abbau in den letzten
10 Jahren völlig neu aufgestellt und so waren die Jahre 2010 und
2011 sogar positiv. Trotzdem beschloss man die Schließung der
Tongrube im Dezember 2011 und damit des letzten Bergwerks im
Spessart. Die Tagesanlagen sind teiwelise teilweise erhalten
geblieben.


Das ist geblieben: das Silo, ein Teil der
Betriebsgebäude (wird jetzt vom LBV genutzt) und die
zugemauerten Zugänge zum Blindschacht im Buntsandstein, der
einst das
Tonvorkommen erschloss;
aufgenommen am 20.04.2014.


Calcit-Sinter aus dem angrenzenden Sandstein des
Mittleren Buntsandsteins. Rechts im Foto ein Ausschnitt, der
zeigt, dass der Sinter aus kleinen, skalenoedrischen
Calcit-Kristallen aufgebaut ist und in einem mit Wasser gefüllten
Hohlraum stammt; gefunden um 1975;
Bildbreite links 6 cm, rechts 1,5 mm
Hinweis:
In Eisenberg in der Pfalz bestand auch ein Tonbergwerk. Das
Betriebsgebäude mit einer sehr großen Lagerhalle ist noch
erhalten, darin auch die Einbauten für die Förderung von Unter
Tage und zahlreichen Loren bzw. Hunte. Bemerkenswert ist, dass es
auch dort einen Seltenbach gibt und einen Landgasthof "Zur
Seltenbach".
Direkt angrenzend befindet sich der Archäologische Park "Römerpark
Vicus Eisenberg", wo Mauerreste von Häusern gezeigt werden. Eines
der Gebäude ist mit reichlich Stahl, Gitter, Glas und Holz
überbaut.
Der Kulturrundweg:
"Vom Ton, Steinen und Scherben"
Der 7,5 km lange Runweg wurde eingeweiht und
von etwa 120 Interessierten erstbegangen am 11.10.2014. Trotz dem
anfänglichen Nieselregen freuten sich die Teilnehmer über
geologische und bergbaukundliche, wie historische, botanische und
weinkundliche Eindrücke in und um Klingenberg:

Im Rosengarten in Klingenberg, der
Treffpunkt und der Ort der Ansprachen.
|

In Klingenberg die letzte Erinnerung
an über 200 Jahre Bergbau auf den berühmten Ton: 1742 -
2011.
Anmerkung: Die Brocken in der Lore sind kein sondern
Kalkstein, denn der Ton würde nach kurzer Zeit verwittern.
|

Nach dem Gang durch die
Seltenbachschlucht wurde am Bergwerk die Historie
nachempfunden: Gleise und Loren, der Schachtkorb und dazu
die Erläuterungstafel des Rundwegs.
|

Der letzte Betriebsleiter und
Berginenieur Eckhardt. EHRT berichtete kurz die Geschichte
des Klingenberger Ton-Werks
|

Gemeinsam wurde das Steigerlied
gesungen und zum Abschluss gab es Schnaps aus Altenberg im
Erzgebirge
|

Es war einst Zugang für das Bergwerk
und wurde später für die Bewetterung des Bergwerks
genutzt:
Stollenmundloch - Glück Auf!
|
Klingenberg
Klingenberg (von Klinge, einem Wort für Schlucht - siehe weiter
unten) liegt am Main zwischen Aschaffenburg und Miltenberg und war
früher sehr viel mehr von Hochwässern des Maines betroffen wie
heute (auch wenn die Medien etwas anderes berichten). In der Stadt
findet man eine eindrucksvolle Hochwassermarke des Jahres 1784 -
einfach kaum vorstellbar, wenn sich dieses Hochwasser heute
wiederholen würde:


Hochwassermarke am rechten Bildrand in der Mitte zwischen den
Scheiben des Hauses, rechts vergrößert,
aufgenommen am 14.10.2007.
Sie erinnern sich:
Im fernen Island brach im Juni 1783 die Lakispalte aus und spie
über 12 km³ Lava. Die Gase gelangten als Höhenrauch bis nach
Mitteleuropa. Der Winter 1783/84 war einer der "großen Winter" mit
strengem Frost und viel Schnee. Im Frühjahr 1784 kam plötzliches
Tauwetter und ein Jahrhunderthochwasser war die Folge.
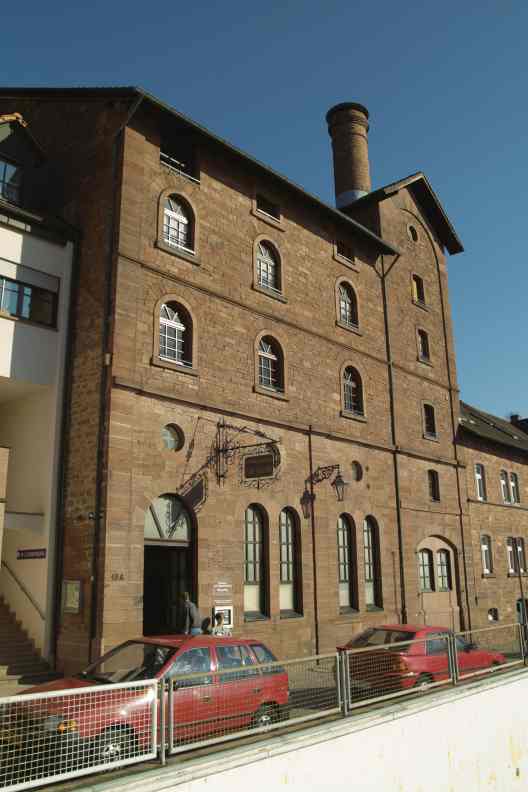
Das Museum in Klingenberg,
aufgenommen am 14.10.2007
Auch wenn das Tonbergwerk für Besucher nicht zugänglich war, kann
man doch einen Eindruck bekommen, wenn man das Heimatmuseum (oben
im Bild) in Klingenberg besucht. Hier ist ein Stollen mit einer
alten und moderenen Abbaustelle nachgebaut worden. In dem Vorraum
sind Produkte ausgestellt, die aus dem Ton hergestellt
werden.


Ausstellungsräume im Museum in Klingenberg, links
Tonprodukte und rechts ein typischer Stollen.
Aufgenommen am 14.10.2005
Weiter sehen Sie in dem Museum Ausstellungen zut lokalen
Geschichte, Weinbau, Geschäfte, Handwerk, Transport aus dem Main,
Landwirtschaft, ... insgesamt ein sehr sehenswertes. liebevoll
gestaltetes Museum.
Neben dem Ton ist der Buntsandstein tonagebend in Kingenberg.
Hier wächst der Wein und es gibt schöne, höhenparallele
Weinbergwege mit schöner Aussicht auf das Maintal.

Weinbergweg nördlich von Klingenberg mit einer
Stützmauer aus Sandstein.
aufgenommen am 14.10.2007

Das Zentrum von Klingenberg mit der Burg, dem
Main, den steilen Weinbergen im Sandstein,
aufgenommen am 14.10.2007.
Die Seltenbachschlucht
östlich von Klingenberg
Mit einem Festakt wurde am 20.05.2011 das 90. der 100 schönsten
Geotope in Bayern eingeweiht. Es handelt sich um die Felsen der
Seltenbachschlucht (siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 232, Aufschluss
153) östlich von Klingenberg, zwischen dem Ortsrand und dem
Tonwerk. In der Schlucht erläutert eine Tafel die Besonderheiten;
zu dem Geotop gibt es ein Faltblatt mit dem Titel "Wüstensand ?".
Leider ist das Parken an den Zugängen etwas eingeschränkt.
Die Seltenbach-Schlucht ist eine geologisch sehr junge Form.
Das hier frei gelegten Gesteins der teils überhängenden Felsen
aus dem mittleren Buntsandstein wurde vor etwa 248 Millionen
Jahren abgelagert. Es handelt sich um einen wenig festen, meist
dünn gebankten Sandstein, unterbrochen von dünnen Lagen aus
einem Tonstein. Diese Kombination ist sehr änfällig für die
Verwitterung, so dass der durch das Tal laufende Bach eine
erhebliche Erosionswirkung entfalten kann. Bedingt durch das
steile Gelände mit dem nahen Main und durch die mittelalterliche
Entwaldung der Hänge und flächige Landnutzung wurde die Schlucht
geschaffen, die in ihrer heutigen Form sicher erst seit dem
Mittelalter besteht. Das Abbrechen von Felsen bestätigen, dass
das Ausräumen der Sedimente in der Schlucht auch heute noch
geschieht.
Da die Faktoren weiter bestehen, besteht auch für die Bebauung
in Klingenberg am Ende der Schlucht ein Risiko, dass erhebliche
Wasser- und Geröllmassen bei starken Regenfällen Überflutungen
auslösen können. Dies wird durch die vielen Bäume und Baumstämme
noch verstärkt, denn diese können in kurzer Zeit Barrieren
bilden, die einen See stauen und der dann unter dem Wasserdruck
brechen kann, was zu verheerenden Überflutungen führen kann. Im
Rahmen von Pflegemaßnahmen (LFU 2014) zur Freihaltung der
Schlucht müssten alle hier liegenden Bäume zersägt und
abtransportiert werden.

Die Seltenbachschlucht bei der Einweihung
des Geotops am 20.05.2011.
|

Dünn gebankte, frei gewitterte Sandsteinfelsen in der
Seltenbachschlucht,
aufgenommen am 20.05.2011.
|

Die neu enthüllte Geotop-Tafel mit den Erläuterungen zur
Schlucht,
aufgenommen am 20.11.2005.
|

Der 1. Bürgermeister von Klingenberg Reinhard SIMON spricht
zu den Festgästen, rechts daneben Herr Dr. Roland EICHHORN
vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und Geologie, re.
daneben der damalige Landrat des Kreises Miltenberg Herr
Roland SCHWING und Dr. Oliver KAISER vom Naturpark Spessart
e. V. am 20.05.2011.
|

Am Eingang der Schlucht (nahe Klingenberg) ist der Mittlere
Buntsandstein steinbruchartig aufgeschlossen. An Wandfuß
wurden etliche Felsenkeller angelegt; der im Bild trägt
innen die Jahreszahl 1855, vermutlich das Jahr der
Herstellung;
aufgenommen am 11.10.2015.
|

Dieser überdimensionale Rost schützt die Stadt bei
Starkregen vor großen Steinen und Baumstämmen, die sonst mit
dem Wasser in die Stadt gespült werden könnten;
aufgenommen am 11.10.2015.
|

Die unterschiedlich dick gebankten Sandsteine;
aufgenommen am 11.10.2015.
|

Geologie-Schüler des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums
(P-Seminar) aus Aschaffenburg während einer Führung mit den
Bergmann Jörg WINKLER an den Resten des Sandsteinwand, wo
einst die Stollen zum Blindschacht führten;
aufgenommen am 29.03.2022.
|
|
Schöner aufgeschlossen war der Mittlere Buntsandstein an der
Autobahn A3 bei Bischbrunn, beiderseits
der Haseltalbrücke - aber auch schwerer oder nach Fertigstellung
der Autobahn garnicht mehr zugänglich.
Literatur:
Autorenkollektiv (1936): Die nutzbaren Mineralien, Gesteine und
Erden Bayerns.- II Band Franken, Oberpfalz und Schwaben nördlich
der Donau, 509 S., [Verl. R. Oldenbourg und Piloty & Loehle]
München.
DOBNER, A. (1984) in WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN,
W., STREIT, R. & WEINELT, W.: Oberflächennahe mineralische
Rohstoffe von Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der
Steine und Erden.- Geologica Bavarica 86, 563 S.,
[Bayerisches Geologisches Landesamt] München.
DOBNER, A. (1987): Tertiäre Tone bei Klingenberg.- Geologica
Bavarica 91, Der Bergbau in Bayern, S. 130 - 134, München.
EHRT, E. (2007): Das Tonbergwerk Klingenberg am Main.- Spessart
Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 101.
Jahrgang, Heft Dezember 12/2007, S. 17 - 24, 12 Abb., [Main-Echo
GmbH & Co KG] Aschaffenburg.
EHRT, E. (2013): Betriebschronik Tonwerk der Stadt Klingenberg a.
Main.- 165 S., 161 Abb., 11 Tab., dazu Anlage 1 Lagepläne und
Schnitte/Historisches Risswerk (20 teils gefaltete Blätter),
Anlage 2 Grundriss und Schnitte zur untertägigen Kartierung und
Vorratsabschätzung (9 Blätter), Anlage 3 Bohrlochbild
Erkundungsbohrung 2003 (1 gefaltetes Blatt), Anlage 4 Technische,
mineralogische und chemische Angaben zum Tonmaterial (7 Blätter),
Anlage 5 Grubenförderung in ausgewählten Betriebsperioden (3
Blätter), Anlage 6 Verwendete Ausbauarten im Tonbergwerk (5
Blätter), Anlage 7 Gebirgsdruckauswirkungen auf den Streckenausbau
(3 Blätter), Anlage 8 Senkungsmessungen auf dem Betriebsgelände
des Tonwerks (1 Blatt), Anlage 9 Schema der betrieblichen
Wasserhaltung (1 Blatt), Anlage 10 Grundriss der
Aufbereitungsanlage (Trocknung), Obergeschoss Mühlenhalle, 1976 –
2011 (1 Blatt), Anlage 11 Verfahrensschema –
Stofffluss/Aufbereitung (2 Blätter), Anlage 12 Verwendung von
Klingenberger Ton nach Branchen (1 Blatt), Anlage 13 Entwicklung
der Grubenbelegschaft und Organigramm 2007/2010 (3 Blätter),
Anlage 14 Im Tonwerk beschäftigte Betriebsführer (2 Blätter),
Anlage 15 Die Bürgermeister der Stadt Klingenberg a. Main (1
Blatt), BIT Tiefbauplanung GmbH [Eigendruck] Gera.
ELSNER, H. (2019): Spezialtone. Spezialtone und -sande in
Deutschland.- 83 S., zahlreiche, meist farb. Abb., hrsg. von der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.
FRANKE, H. (1996): Tonbergbau in Klingenberg.- S. 237 - 253, 11
Abb. - in Stadt Klingenberg (1996): Chronik der Stadt Klingenberg
am Main. Band III-. 358 S., zahlreiche SW- und wenige Farbabb.,
Tab., [Caruna Druck] Miltenberg.
FRANKE, H., BERNINGER, G. & SCHOCH, E. (1992): 250 Jahre
Tonbergwerk Klingenberg a. Main.- 52 S., Klingenberg.
HARTMANN, W. (2015): Rätsel der alten Clingenburg. Die
verschwundene Anlage könnte eine Bedeutung im Tonbergbau gehabt
haben.- Spessart Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft
Spessart 109. Jahrgang, Heft Juni 6/2015, S. 3 - 6, 7
Abb., [Main-Echo GmbH & Co KG] Aschaffenburg.
LFU (Bayerisches Landesamt für Umwelt (2014): Geotope in Bayern
erhalten, pflegen und erleben.- 44 S., zahlreiche farb. Abb.,
Karten, [Joh. Walch GmbH & Co. KG] Augsburg.
LORENZ, J. (2007): Ton - schmutzig, aber ein tolles Zeug.-
Noblesse, Ausgabe 03/2007, S. 86 – 87, 10 Abb.,
[Media-Line@Service] Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 765ff.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 72f, 77, zahlreiche farb. Abb. als Fotos,
Karten, Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt,
[Druckerei Joh. Walch] Augsburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, S. 160 - 161, Berlin.
MELZER, D. & EHRT, E. (2002): Der Ton von Klingenberg am Main
– eine Besonderheit der bildsamen Silicatrohstoffe.- Keramische
Zeitschrift 54, Heft 11 (November), S- 952 – 955, 8
Bilder, [Verlag Schmidt GmbH] Freiburg.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
PFISTER, P. (1976): Tonbergwerk der Stadt Klingenberg und seine
Geschichte.- S. S. 198 - 253, 4 Abb., in 700 Jahre Stadt
Klingenberg Beiträge zur gechichtlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Klingenberg am Main, 472
S., [Hch. Bigemer Buchdruck - Offset] Obernburg.
RAACK, W., SCHORN, P. & SCHRÖDTER, E. [Hrsg.] (1962): Jahrbuch
des deutschen Bergbaus.- Das Handbuch für Bergbau und
Energiewirtschaft 70. Erscheinungsjahr, 55, 1280 S.,
[Verl. Glückauf GmbH] Essen.
SCHOBER, J. (1905): Führer durch den Spessart, Kahlgrund und das
Maintal.- 233 S., mit Illustrationen, Spezial- u. Routenkarten, 4.
Aufl. [Verlag der Krebs´schen Buchhandlung] Aschaffenburg.
SCHREINER, J. (2011): Ein letztes Glückauf in 70 Metern Tiefe.-
Main-Echo vom 8. Dezember 2011, S. 23, 11 Abb.,
TROST, W. (2014): Klingenberg – Ein Märchen aus der Gründerzeit.
Das Tonbergwerk ließ die Stadt zwischen 1855 und 1916 erblühen.-
Spessart Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 108.
Jahrgang, Heft Dezember, S. 3 - 12, 20 Abb., [Main-Echo GmbH &
Co KG] Aschaffenburg.
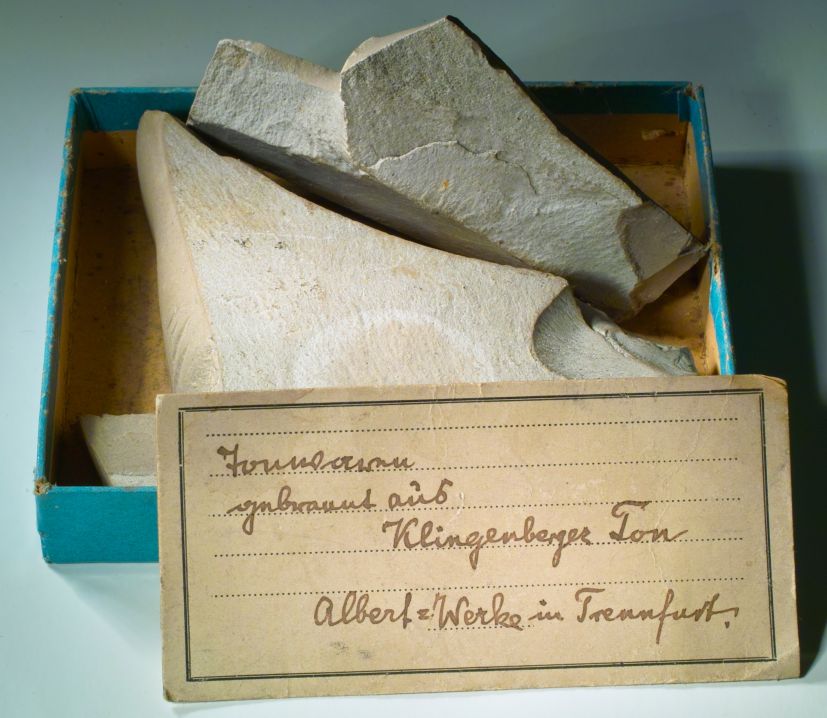
Muster aus gebranntem Ton aus Klingenberg am Main
in einer einstigen Lehrsammlung eines Gynasiums: "Tonwaren
gebrannt aus
Klingenberger Ton Albert=Werke in Trennfurt.". Nun die
Untersuchung mittels Röntgendiffraktion erbrachte, dass es sich
um einem
Beton (erhärteten Zement) handelt,
Bildbreite 14 cm
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite