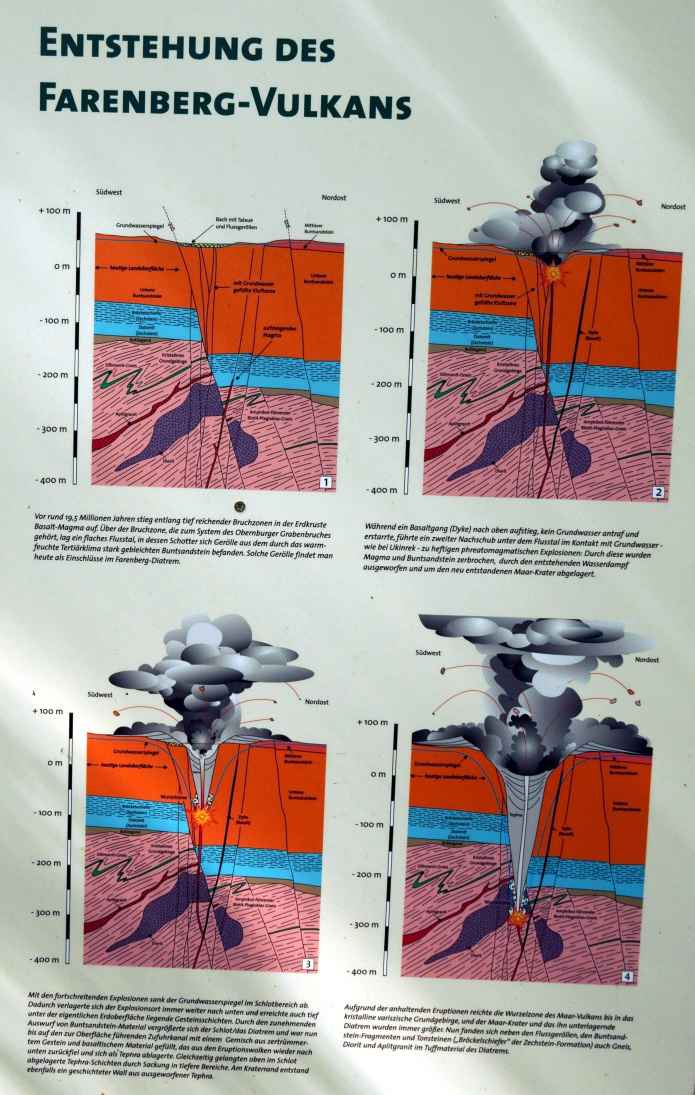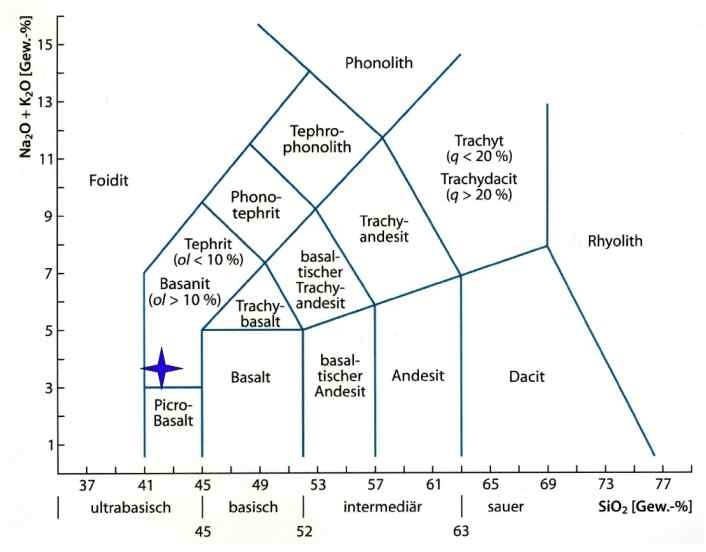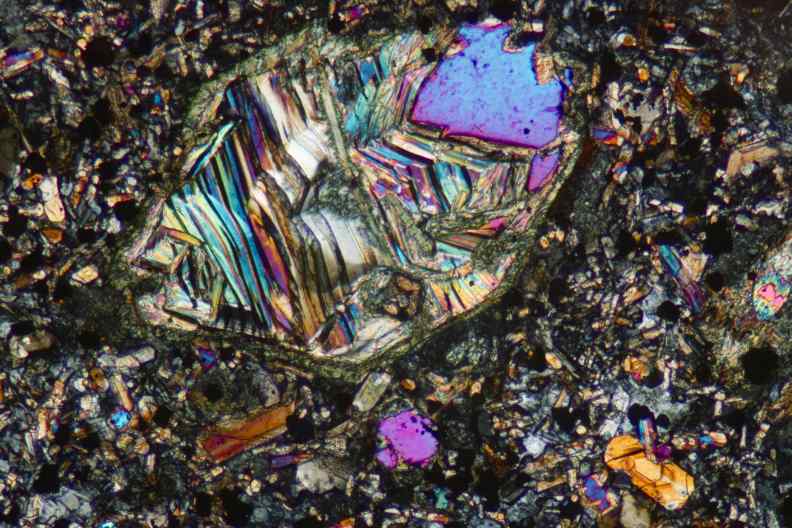Eisenerze, Basalt & Tuff
bei Großostheim, Großwallstadt, Mömlingen und Eisenbach
-
Bergbau & Vulkanismus.
von Joachim Lorenz, Karlstein
a. Main

Auch wenn es sehr unscheinbar aussieht. Das ist
das Eisenerz vom
Dörnberg, welches hier abgebaut und nach Laufach gebracht wurde,
Bildbreite 15cm
In einem Höhenrücken des nördöstlichsten Odenwaldes, zwischen
Großostheim und Obernburg, wurden an mehreren Stellen innerhalb
des hier verbreiteten Sandsteins vulkanische Gesteine (Basalte)
angetroffen, in deren Umfeld sich auch Eisenerze gebildet haben
(die Abbaue gehören zu Gemeinden Großostheim und Großwallstadt).
Darüber hinaus gibt es weiter südlich bei Eisenbach (Name!)
weitere Vorkommen, die nahezu alle zumindest hinsichtlich ihre
Erzhöffigkeit geprüft wurden. An einigen Stellen wurde der Basalt
als Schotter für den Straßenbau gewonnen. An den hier angeführten
Orten gab es auch einen Bergbau auf Eisenerze, dessen Spuren heute
noch sichtbar sind. Details zum Bergbau aus dem frühen 19.
Jahrhundert sind nicht bekannt.
Die Vorkommen wurden mit einiger Wahrscheinlichkeit von Heinrich
GMEINER (*1833 Laufach †1871
Fürth) entdeckt. Er war der Betreiber des Eisenwerks und
Blechfabrik-Inhaber in Laufach (heute Fa. DÜKER) und aufgrund der
Rohstoffsituation an der Geologie seiner Umgebung interessiert.
Das bezeugen die Bemerkungen, die von den regionalen
Wissenschaftlern aufgrund seiner Hinweise publiziert wurden. Auf
der Suche nach Eisenerz prospektierte er sicher auch das Gebiet
zwischen Großstheim, Eisenbach, Mömlingen und Obernburg und fand
dabei die kleinen Erzvorkommen in dem Zusammenhang mit den
vulkanischen Gesteinen.
Infolge der für ein Eisenerz geringen Gehalte, den hohen
Gewinnungs- und Transportkosten und der kleinen Vorräte wurde der
Bergbau sicher nur in geringem zeitlichem Umfang betrieben. Ob es
bereits früher einen Bergbau oder Gewinnungsversuche gab, kann man
heute nicht mehr feststellen, da diese Spuren einer noch kleineren
Gewinnung mit dem späteren Bergbau getilgt wurden.
Für ein Rennfeuer sind die Gehalte an Eisen in dem Erz in den
meisten Fällen zu klein. Eine Aufbereitung wäre auch im
Mittelalter unwirtschaftlich gewesen, da an anderer Stelle
ausreichend hochprozentige Eisenerze und leichter gewinnbare
Vorkommen vorhanden waren. Das gilt im Prinzip auch für die Römer,
deren Spuren in der Nähe noch heute zu finden sind.
- Fahrenberg bei Großostheim

Schachtpinge mit ringförmiger Halde der Grube Treue bei
Großostheim,
aufgenommen am 11.02.2007
Das Vorkommen eines Schlottuffes ist im geologischen
Schrifttum bereits seit 1826 bekannt; damals gab es bereits
einen Steinbruch und den Abbau von Eisenerzen.
Auch hinsichtlich der Gesteine kann das Vokommen als sehr gut
untersucht (STREIT & WEINELT 1971, SCHMEER 1973,
OKRUSCH, GEYER & LORENZ 2011) gelten. Der
Olivin-Basalt wurde auf ein Erstarrungsalter von ca. 74
Millionen Jahre datiert (HORN, LIPPOLT & TODT
1971). Gänge mit Basalt im Tuff sind heute nicht
mehr zugänglich. Aus dem petrographischen Untersuchungen an
den Gesteinen weiß man auch, dass sich hier ein Vulkan befand,
wohl sehr ähnlich dem viel jüngeren von Mainaschaff.
Auch hier ist von dem ehemaligen Vulkangebäude nichts mehr
vorhanden.
Auch hier ist von dem ehemaligen Vulkangebilde nichts
mehr vorhanden. Der Vulkan hatte nur einen Ausbruch, so dass
man davon ausgehen kann, dass es sich dann um ein typisches
Maar gehandelt hat. Solche Vulkane sind in Deutschland wie
auch weltweit in sehr großer Zahl vorhanden (SCHMINCKE 2004,
NEMETH & KEREZTURI 2015). Der Maartrichter, die
Ausbruchsmassen und die vermutlich darin abgelagerten
Sedimente sind lange der Erosion anheim gefallen. Wir schauen
heute nur noch einen kleinen Teil des Förderschlotes an.
Die Schlotbrekzie ist hier sehr reich an Bruchstücken aus
dem Kristallin, insbesondere aus Diorit. Einschlüsse aus dem
Zechstein scheinen zu fehlen, so dass man daraus schließen
kann, dass hier der Sandstein direkt auf dem Kristallin
aufliegt. Die thermische Einwirkung war nicht sehr hoch, denn
beispielweise sind die Sandsteine nicht gefrittet und die
Tonlinsen darin nich verziegelt.
Der anstehende Sandstein um das Tuffvorkommen ist auch
erheblich mit Goethit und Manganoxiden wolkig imprägniert
(LORENZ 2010:274). Im Tuff und im Kontakt zum Sandstein baute
die Grube "Treue" von ca. 1840 (wegen des Eintrags in der
Karte von KITTEL 1839/40) bis 1857 Eisenerze ab, deren
Produktion nach Laufach gekarrt wurde. Ziel des Bergbaues
waren die mit Goethit und Manganoxiden imprägnierten
Schlottuffe und die Sandsteine des umgebenden Buntsandsteins.
Infolge der Abbaues von Hand, der sehr scharfen Trennung bei
der Sortierung und des derzeitigen Nutzung durch Wald auf den
Halden ist es heute sehr schwer, noch Erzstücke zu finden.
Am sonnigen Donnerstag, den 16.04.2015 wurde unter
Zuhilfenahme eines Kleinbaggers ein Weg planiert und unter
Weisung der Herren Prof. Dr. Volker Lorenz, Jochem Babist,
Hartmut Hasenkopf und 2 weiteren Mitgliedern der
Altbergbauforschung aus dem Odenwald wurde die vorhandene
Felswand frei gelegt und erweitert, so dass man jetzt ca. 10 m
des Aufschlusses mit den Tufflagen studieren kann.


Links: Schlottuff mit Basaltbröckchen,
Kristallinbruchstücken und Ascheteilchen;
rechts Sandstein, durch die Bewegung der Ausbruchstätigkeit
gerundet und ohne Eisen- bzw. Manganerze aus dem Vorkommen am
Fahrenberg bei Großostheim, angeschliffen,
Bildbreite 14 cm

Eisenerz von der Grube Treue bestehend aus einem
mit Goethit impränierten
Schlottuff, angeschliffen,
Bildbreite 8 cm
Aus unverständlichen Gründen wurde hier 2010 seitens des
bayerischen Staats eine große "Gefahr" erkannt,
Rammkern-Sondierungen vorgenommen und Schilder
aufgestellt, die sicher mehr anziehen als abschreckend
wirken.

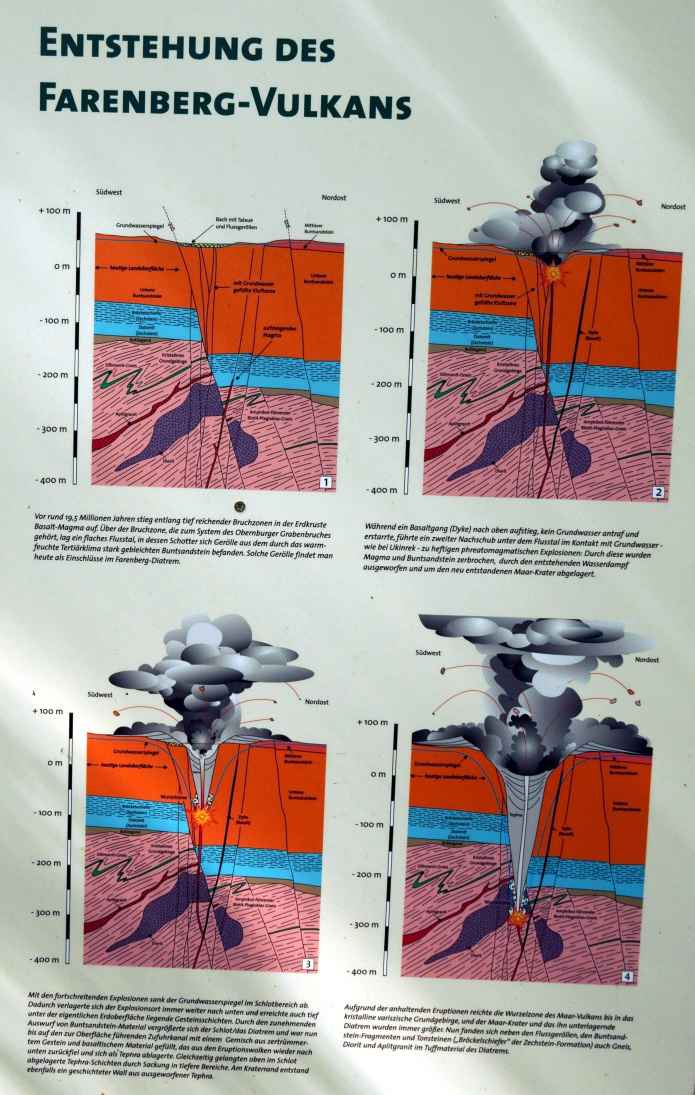
Unmittelbar vor dem Aufschluss des kleinen
Steinbruchs wurden Tafeln des Geo-Naturparks
Bergstraße-Odenwald aufgestellt, in denen sehr
anschaulich und in Schritten illustriert die Bildung des
Farenberg-Vulkans bei Großostheim beschrieben wird. Leider
steht am Parkplatz neben
dem Reiterhof kein Schild, das auf die Besonderheit hinweist,
aufgenommen am 24.07.2016

Keine Steine, aber doch bemerkenswert: man
beachte auf dem Weg
aus Hexel und Rindenmulch die sehr zahlreichen Becherlinge,
vermutlich Peziza varia,
gesehen am 24.07.2016
- Neidberg bei Großwallstadt

Etwa 3 m tiefe Schachtpinge am Neidberg bei
Großwallstadt,
aufgenommen am 04.01.2014
Halden, grabenförmige Einschnitte und Schachtpingen bezeugen
einen umfangreichen Bergbau auf Eisenerze im Zusammenhang mit
einem Basalt am Neidberg westlich von Großwallstadt. Das
Gelände wird von einem breiten Forstweg durchschnitten. In der
Halde konnten sowohl Eisenerze (Goethit als Imprägnation im
Sandstein) als auch stark verwitterter Basalt gefunden werden.
Ein Grubenname ist nicht überliefert. Die älteste Beschreibung
stammt von BEHLEN (1823). Die in der Literatur angegebenen
Maße für Stollen und Schächte erscheinen im Vergleich zu den
Haldenmassen sehr fraglich. Bei KITTEL (1839/40) sind die
Basaltvorkommen in der geologischen Karte eingezeichnet. Das
südlichste Vorkommen ist mit der Bergwerkssignatur aus
Schlegel und Eisen versehen, so dass man davon ausgehen kann,
dass es damals noch einen Abbau gab.
Der Basalt steht in direktem Kontakt zum Sandstein, ist aber
heute nicht mehr aufgeschlossen. Eine Schlotbrekzie ist nicht
gefunden worden. Aus den alten Beschreibungen kann man
schließen, dass es sich um eine Intrusion handelt (LEONHARD
1832). In welchem Zusammenhang die Eisenerze mit dem Basalt
stehen, ist nicht sicher bekannt (KLEMM 1933). Es scheint so
zu sein, dass die Goethit-Imprägnation stratiform im Sandstein
erfolgte.
Dass der Basalt von hier zu Schotter geklopft wurde, erscheint
bei dem Verwitterungsgrad unwahrscheinlich. Vermutlich wurde
aus diesem Grund auch keine Altersdatierung von LIPPOLT et al.
(1975) durchgeführt. Da der moderene Wegebau im Wald auch
basaltische Schotter von der Bundesbahn verwandte, ist auf den
Waldwegen und davon erodierten Teilen mit frischen
Basaltschottersteinen zu rechnen, die aber von überall her
stammen können. Man kann daher nur Proben verwenden, die
direkt dem Vorkommen zugesprochen werden können.
Alle Vorkommen vulkanischer Gesteine wurden Ende der 1960er
Jahre mit einer magnetischen Feldwaage vermessen. Dabei kann
man aufgrund des Gehaltes an Magnetit in den vulkanischen
Gesteinen diese vom Sandstein unterscheiden, da dieser in der
Regel keinen Magnetit führt. Darüber hinaus entdeckte Otto
Mäussnest dabei weitere Basaltvorkommen auf dem Blatt
Obernburg (MÄUSSNEST 1978, 1985).

Stark verwitterter Basalt vom Neidberg
bei Großwallstadt, angeschliffen (das Gestein
ist für eine chemische Analyse - zur Klärung um welchen
Vulkanit es sich handelt - zu
schlecht erhalten),
Bildbreite 10 cm

Mit Goethit wolkig imprägnierter
Buntsandstein vom Neidberg bei Großwallstadt,
angeschliffen,
Bildbreite 10 cm
- Dörnberg bei Großwallstadt

Große Halde am Dörnberg bei Großwallstadt,
aufgenommem am 12.01.2014
Am südöstlichen Dörnberg ist eine Schachtpinge mit einer
außergewöhnlich großen Halde am Berghang sichtbar, die auf ein
größeres Grubengebäude hinweist; hierbei könnte es sich um den
von BEHLEN (1823) beschriebenen Ort handeln. Merkwürdig ist
das völlige Fehlen von Basalt. Die Halde besteht zum größten
Teil aus Ton mit eingestreuten Sandstein-Brocken. Der
Eisensandstein von hier fällt durch eine große Zahl von
Tonklasten auf. Auch hier scheint es so zu sein, dass der
Sand- und Tonstein in einer Lage mit unbekannter Mächtigkeit
mit Goethit imprägniert ist. Auch dürfte der Gehalt an FeO im
Erz kaum höher als 30 Gew.-% liegen, so dass man das Erz nur
in einem Hochofen zu Eisen verarbeiten kann. Auch hier ist
kein Grubenname erhalten.
Im Umfeld kommt ebenfalls ein vulkanisches Gestein vor,
welches sich von den anderen vulkanischen Gesteinen der Gegend
unterscheidet. Es handelt sich um nach der Literatur um einen
Alkali-Olivin-Basalt. Dafür liegt eine Alter von 50 Millionen
Jahren vor (LIPPOLT et al. 1975:209). Das Vorkommen befindet
sich fernab des Schachtes in einem alten Steinbruch auf der
Ostseite des Berges. Der Steinbruch führt auf den ersten Blick
keinen Basalt; möglicherweise wurde das Vorkommen ganz
abgebaut worden und der Sandstein im Hangschutt dominiert
deshalb heute. Am Rand ließen sich wenige Belegstücke
aufsammeln, die für eine Ansprache ausreichten. Dies ist wohl
der Steinbruch, von dem BEHLEN (1823) die Schottergewinnung
beschreibt. Auch die sehr frühe chemische Analyse des Basaltes
von Großwallstadt des Freiherrn von BIBRA (1838) und dessen
Vergleich mit anderen Basalten stammt sehr wahrscheinlich von
diesem Steinbruch. Er besuchte die Grube im Herbst 1837. Der
Steinbruch weist eine unverhältnismäßig große Halde auf.

Der ehemalige und völlig verwachsene
Basaltsteinbruch mit der hangseitigen Abraumhalde am
Dörnberg bei Großwallstadt,
aufgenommen am 19.01.2014

Schotterstücke aus dem Basalt vom Dörnberg bei
Großwallstadt,
Bildbreite 14 cm
MÄUSSNEST (1985:116) beschreibt die Stelle:
"... Auf der anderen Seite des hier vorbeiführenden
Holzabfuhrweges befindet sich eine alte Bergwerkshalde
mit viel Basalt. Diese Halde gab Anlaß zu der Vermutung,
hier müsse Basalt anstehen, und deshalb wurde die
Schürfgrube angeleg, die mangels eines positiven
Ergebnisses sehr rasch wieder verlassen wurde
(freundliche Mitteilung des Bürgermeisteramtes
Großwallstadt). Wie Herr Oberforstwart SCHNABEL
(Großwallstadt) berichete, wurde hier etwa 1972 Material
anläßlich des Baues von Holzabfuhrwegen entnommen, und
dabei wurden 2 völlig in Vergessenheit geratene
Bergwerksstollen freigelegt, die man durch
Materialanschüttungen verschloß, um das Eindringen
Unbefugter zu verhindern. Eine Untersuchung dieser
Stollen scheint versäumt worden zu sein."
Dass es hier Stollen gibt, lässt sich nachvollziehen, denn
man wird versucht haben, Eisenerze im Bereich des Basaltes
zu finden, da dies an anderen Stellen auch so war.
Lesesteine eisenschüssiger Sandsteine indes gibt es aber
am Dörnberg praktisch überall, wie die Auswertung der
Steine in den vielen Wurzeltellern ungestürzter Bäume
zeigen. An den Hängen des Berges sind an einigen Stellen
Trichter und Gräben zu sehen, die man als Spuren einer
frühen Prospektion auf Eisenerze interpretieren kann. Da
die Beobachtungen in der alten Literatur nicht genau
lokalisiert werden können und er mehr Bergbauspuren gibt,
wie in der Literatur angeführt sind, ist eine Aufklärung
wer wann was wo beschrieben hat, kaum mehr möglich.
Möglicherweise gibt in dem gemeindlichen Archiv weitere
Unterlagen als Rechnungen oder Verträge, die bisher nicht
gesichtet werden konnten.
Im Bergamt in Bayreuth (Staatsarchiv Bamberg) sind Akten
zu einer Eisensteinzeche "Neuer
Fund" in der Markung Großwallstadt, BA Obernburg; Muter war
Steiger Peter Müller i. A. der Firma Jacobi, Haniel und Huyßen
in Rheinpreußen (1870-1877) und einer weiteren Eisensteinzeche
"Reicher Segen" in der Markung Großwallstadt, BA Obernburg;
Muter: Steiger Peter Müller, dann: Hüttengewerkschaft Jacobi,
Haniel und Huyßen in Rheinpreußen (1870-1877); es ist
unwahrscheinlich, dass in dieser Zeit ein Abbau statt fand, da
die Erze gegen Siegerländer Erze keine Chance hatten.
Aus der Zeit vor 1850 sind vermutlich keine Akten
vorhanden oder sie liegen z. B. in den Staatsarchiven
Würzburg oder München.
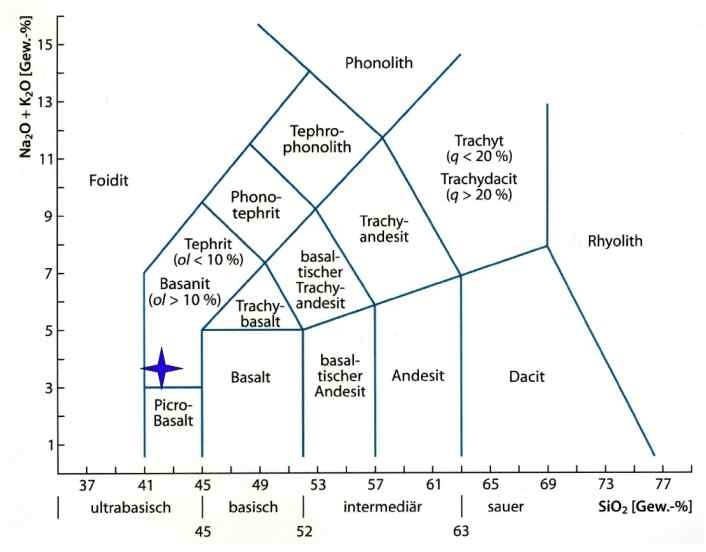
Nach der chemischen Analyse handelt es
sich um einen Basanit.
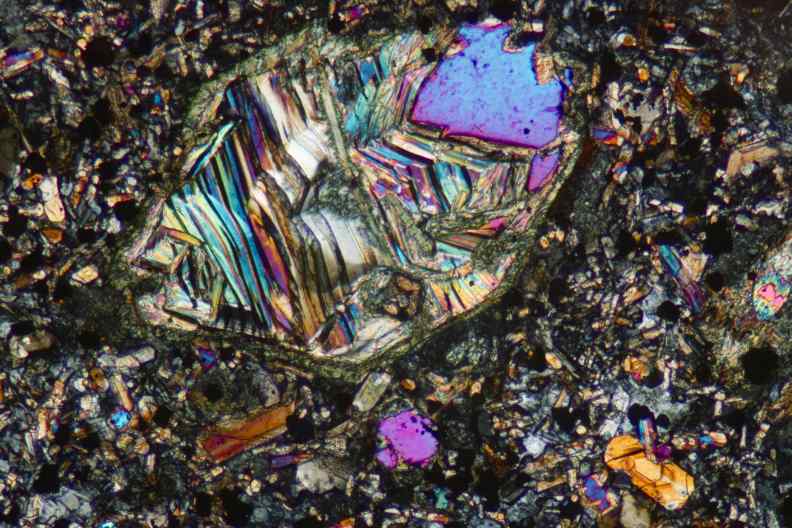
Im Dünnschliff sieht man u. a.
einen in Iddingsit umgewandelten Olivin-Kristall,
Dünnschlifffoto bei gekreuzten Polarisatoren,
Bildbreite etwa 1 mm.
Grube "Berta" bei Mömlingen

Die Halden und Schachtpinge der Grube Berta bei
Mömlingen,
aufgenommem am 02.02.2020
Im Eichwäldchen südwestlich von Mömlingen sind die Reste der
Grube Berta im Wald zu sehen (TK 6120 Obernburg am Main N 49°
51´ 100´´ E 9° 04´ 025´´). Es handelt sich um flache Halden
aus einem tonigen Basalt-Zersatz, darin eingestreut kleine
Bröckchen eines goethitischen Eisenerzes, welches stark
konkretionär ausgebildet ist. Es erinnert an die typischen
Basalteisenerze des Vogelsberges. Vererzte Sandsteine konnten
hier nicht gefunden werden.

Eisenerzkonkretion aus Goethit von der Grube
Berta,
Bildbreite 14 cm
Nach VOGEL (1930) und der hier aufgestellten Tafel des
GEO-NATURPARKS Bergstraße-Odenwald wurde das Vorkommen von
Heinrich GMEINER aus Laufach 1826 erschlossen und bis zu einem
Wassereinbruch 1838 bebaut. Die Mutung wurde mehrfach
verlängert. Erst mit der Autarkiebestrebungen des Deutschen
Reiches wurde 1934/35 erneut ein 17 m tiefer Schacht geteuft,
ohne dass es erneut zu einem Abbau von Erzen kam. Dafür wurden
1.000 Reichsmark seitens der Gemeinde investiert.
Mühlhansenloch
Nur wenige hundert Meter südwestlich der Grube Berta befindet
sich das "Mühlhansenloch" (TK 6120 Obernburg am
Main N 49° 51´ 000´´ E 9° 03´ 426´´). Dies wird
bereits im 17. Jahrhundert urkundlich erwähnt.

Der Steinbruch des Mühlhansenloches bei
Mömlingen,
aufgenommen am 02.02.2020
Das steinbruchähnliche Gelände weist im oberen Teil anstehende
vulkanische Gesteine auf, die Prof. Dr. Volker Lorenz (früher
Universität Würzburg) als Hinweise deutete, dass es sich um
das tiefe Stockwerk eines ehemaligen Maars handelt; dies wird
eindrucksvoll auf 2 dort aufgestellten Tafeln beschrieben. Es
gelang mir hier nicht, ein Eisenerz nachzuweisen und völlig
untypisch ist auch das Fehlen einer Halde. Ich würde bis zum
Beweis des Gegenteils, daraus schlussfolgern, dass es sich um
einen Basalt-Steinbruch handelt
Buchberg
Südwestlich von Mömlingen befindet sich der 306 m hohe
Buchberg. An seiner Nordostflanke befinden sich ebenfalls
Abbauspuren eines einstigen Basaltabbaues, der nach den
Angaben von VOGEL (1930) 1852 begann. Neben einem Steinbruch
befindet sich der Eingang eines Stollens, in dem ebenfalls
Basalt, aber untertägig gewonnen worden sein soll. Die Pingen
deuten darauf hin, dass sich tatsächlich hier ein Stollen
befindet, dessen Zugang verstürzt ist. In der umfangreichen
Halde (TK 6120 Obernburg am Main N 49° 50´
243´´ E 9° 04´ 187´´) aus tonigem Material mit
Sandstein konnte auch Eisenerz gefunden werden; dabei handelt
es sich um Sandstein, dessen Porenraum mit Goethit gefüllt
ist.

Die Zufahrt zum Stollen am Buchberg,
aufgenommen am 02.02.2020
Eisenbach (Obernburg)
Der Ort führt das Eisen im Namen. Aber dort Eisenerz zu finden
ist sehr schwierig, weil die Abbaue seit Langem aufgelassen
sind und von zahlreichen, z. T. eindruckvollen Basalt-Abbauen
üerdeckt sind. Im örtlichen Heimatmuseum hat man einen Stollen
nachgebaut, zeigt Fotos und Urkunden, konnte aber bis zum
Februar 2020 kein örtliches Eisenerz ausstellen.
Die Vorkommen vulkanischer Gesteine mit basaltähnlichen
Eigenschaften erstreckt sich entlang von Störungen, die im
Gelände kaum wahrgenommen werden können (MÄUSSNEST 1978). Bei
dem "Basalt" handelt es sich in Wirklichkeit um einen
Nephelin-Basanit mit einem radiometrischen Alter von 49
Millionen Jahren (LIPPOLT et al. 1975). Dieser sondert auch
säulig ab, so dass man von größeren Vorkommen und nicht nur um
Schlotfüllungen sprechen kann. Dieser Basanit ist an der
Oberfläche tonig verwittert und sondert mit zunehmender Tiefe
kugelig ab, bis bei größeren Vorkommen eine säulige
Absonderung gesehen werden kann. Diese rundlichen
Gesteinsbrocken findet man häufig im Gelände und besonders um
und in den verfallenen Steinbrüchen:

Die namenlose Basaltgrube am Grundgraben (TK 6120
Obernburg am Main N 49° 49´ 250´´ E 9° 42´ 425´´)
führt zu einem zugesprengten Stollen, in dem zunächst Basalt
abgebaut wurde. Im 2. Weltkrieg diente der Stollen als
Luftschutzeinrichtung für die Bevölkerung von Eisenbach. Auf
der vorgelagerten und relativ großen Halde konnte ich
ausschließlich Sandstein und Basalt, aber kein Eisenerz
finden.
Aufgenommen am 02.02.2020

In dem relativ großen Steinbruch in der Wald-Abteilung
Steinknuss ist säulig absondernder Nephelin-Basanit
aufgeschlossen (TK 6120 Obernburg am Main N 49°
49´ 227´´ E 9° 05´ 497´´). Schriftstücke des
Abbaues befinden sich im Heimatmuseum in Eisenbach.
Unmittelbar daneben befindet sich der ebenfall völlig
zugewachsene Steinbruch im Buntsandstein, in dem der örtliche
Bedarf an Bausteinen gedeckt wurde. Der Kontakt zwischen
dem vulkanischen Gestein und dem Buntsandstein ist leider
nicht aufgeschlossen;
aufgenommen am 09.02.2020

Weit entfernt von der Ortschaft und unmittellbar an der
bayerisch-hessischen Grenze befindet sich auf einem
Höhenrücken des Querbergs der Steinbruch "Eiserner Pfahl" nahe
eines "Dreimärkers", also eines Grenzsteines, an dem die
Gemarkungen von 3 Ortschaften zusammen stoßen (Eisenbach,
Oberburg, Herrschaft Breuberg). Der kleinstückig absondernde
Basalt wurde in einem großen, tiefen Steinbruch (TK
6120 Obernburg am Main N 49° 48´ 698´´ E 09° 04´ 894´´)
gewonnen. Infolge von gestiegenen Qualitätsansprüchen, die
nicht erfüllt werden konnten, musste der Steinbruch 1924
aufgegeben werden. Nach oben hin ist das Gestein stark
verwittert, im hinteren Teil ist noch eine eindrucksvolle
Felswand erhalten;
aufgenommen am 09.02.2020

Der Versuchsabbau auf Eisenerz im Sandstein des Buntsandsteins
in der Waldabteilung Steinknuss (TK 6120 Obernburg
am Main N 49° 49´ 286´´ E 9° 05´ 787´´). Bei dem Eisenerz
handelt es sich um einen Sandstein, dessen Porenraum teilweise
- bis gegen die Klüfte völlig - mit Goethit ausgefüllt ist.
Infolge der geringen Ausdehnung der Abbauspuren, wie auch dem
relativ kleinen Haldenvolumen kann man davon ausgehen, dass es
sich um einem Bergbau handelte, der nicht lange angehalten hat
und nur geringe Mengen an Erz lieferte;
aufgenommen mit Walter Klotz am 09.02.2020
Anmerkung:
Der örtliche Jäger Walter KLOTZ konnte sich daran einnern,
wie der Stuttgarter Geologe Dr. Otto MÄUSSNEST
(*19.01.1931 †10.11.1983)
in den 1970er Jahren mit der Feldwaage die magnetischen
Feld-Messungen zum Auffinden der Basalt- und
Eisenerzvorkommen im Wald von Eisenbach ausführte. Er traf
ihn inmitten von Brombeerstauden an und führte ein längeres
Gespräch.


Unscheinbare Halde in der Feldflur am
Eisenberg bei Eisenbach Bei
dem (TK 6120 Obernburg am Main N 49° 49´ 610´´ E 9° 06´
539´´). Auch hier ist es Sandstein, der mit
Goethit imprägniert wurde; zusätzlich sind alle Klüfte und
Risse mit Goethit ausgefüllt, so dass man das Erz am besten
erkennen kann. Im Gelände ist es jedoch kaum von den
anderen Sandsteinbrocken zu unterscheiden. So ein Brocken wird
im Heimatmuseum in Eisenbach ausgestellt. Auf der als Weide
genutzten Fläche konnten keine weiteren
Spuren - wie Pingen, Gräben usw. - eines Bergbaues
festgestellt werden.
Aufgenommen am 09.02.2020; Bildbreite 11 cm.
Vermutlich existieren weitere Abbaustellen, die jedoch in den
letzten Jahrzehnten durch Flufbereinigungen, Überbauungen,
Straßen- und Wegebau und durch Zuschütten mit Müll getilgt
wurden.
Dann bleibt noch die Antwort auf die Frage, woher stammt das
Eisen und wie wurden die Lagerstätten gebildet. Es sind ja nur
kleine Vorkommen, die nach heutigem Denken als "wertlos"
anzusehen sind. Der Prospektorenbegriff "Rucksacklagerstätte"
ist sehr treffend, denn diese Lagerstätten beinhalten sicher
nur einige 100 bis 1.000 t Eisenerz. Das ist für einen
modernen Hochofen nicht einmmal der Tagesbedarf!
Hier im Odenwald wurde bereits vor sehr langer Zeit und
vermutlich früher als im Spessart, Eisenerze abgebaut und
verhüttet. Die älteste Erwähnung betrifft eine Urkunde aus dem
Jahr 773, die dem heutigen Erzbach bei Reichelsheim zugeordnet
wird (EINECKE & KÖHLER 1910:637), was nicht ganz sicher
ist. Dort baute man Eisenerze aus dem Zechstein ab.
Dank:
Den Hinweis zu den Vorkommen von Großwallstadt im Gelände verdanke
ich dem Archäologen Alexander REIS aus Großwallstadt. Dem
ehemaligen Bürgermeister Erich HEIN aus Großwallstadt danke für
weiter gehende Infomationen zu den Erinnerungen der örtlichen
Bürger.
Dem Jäger und Büchsenmacher Walter KLOTZ aus Eisenbach danke ich
für die vielen Hinweise und für eine Führung zu den Abbaustellen
in der Gemarkung Eisenbach.
Literatur:
BEHLEN, S. (1823): Der Spessart. Versuch einer Topografie dieser
Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirge, Forst-, Erd- und
Volkskunde.- Erster Band, 274 S., 1 mehrfach gefaltete Tabelle im
Anhang, [F. A. Brockhaus] Leipzig.
BIBRA, Freiherr E. v. (1838): LXXVI. Analyse des Basaltes von
Großwallstadt bei Aschaffenburg.- Journal für praktische Chemie 14.
Band Jahrgang 1838 2. Band, S. 413 – 418, ohne Abb., Tab., Verlag
von Johann Ambrosius Barth] Leipzig.
BIBRA, Freiherr E. v. (1838): LXXVII. Analyse des bunten
Sandsteins von Großwallstadt.- Journal für praktische Chemie 14.
Band Jahrgang 1838 2. Band, S. 419 – 420, ohne Abb., Tab., Verlag
von Johann Ambrosius Barth] Leipzig.
EINECKE, G. & KÖHLER, W. (1910): Die Eisenerzvorräte des
Deutschen Reiches.- Archiv für Lagerstätten-Forschung Heft 1,
766 S., 16 Tafeln und 112 Textfig., Hrsg. von der Königlich
Preussischen Geologischen Landesanstalt, Berlin.
HORN, P., LIPPOLT, H. J. & TODT, W. (1971): Altersbestimmungen
nach der K-Ar-Gesamtgesteinsmethode an den Basalten des
Strietwaldes bei Kleinostheim und vom Fahren-Berg (Büschchen) bei
Großostheim.- In Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern
1:25 000 Blatt Nr. 6020 Aschaffenburg, S. 130 – 132, [Bayerisches
Geologisches Landesamt] München.
KITTEL, M. B. (1839/40): Skizze der geognostischen Verhältnisse
der Umgegend Aschaffenburgs.- Programm des Königl.
Bayerischen Lyceums zu Aschaffenburg für 1838 in 1839 63 S.,
zweite und letze Abtheilung, 1839 in 1840, 23 S., 1 colorierte
geologische Karte und eine Tafel mit farb. Profilen im Anhang,
[Wailandt´sche Druckerei] Aschaffenburg.
KLEMM, G. (1933): Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des
östlichen Odenwaldes.- Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der
Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt für die
Jahrgänge 1931/1932, V. Folge, 14. Heft, S. 8 – 19, ohne
Abb., Hrsg. Von der Direktion des Geologischen Landesanstalt
[Hess. Staatsverlag] Darmstadt.
LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung
zu normalen und abnormen Felsmassen.- Erste Abtheilung XXII + 498
S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.
LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung
zu normalen und abnormen Felsmassen.- Zweite Abtheilung X + 536
S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.
LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung
zu normalen und abnormen Felsmassen.- Atlas 1, 8 S., XX Tafeln mit
Ansichten und kolorirten Durchschnitten [E. Schweizerbart´sche
Verlags-Handlung] Stuttgart.
LIPPOLT, H. J., BARANYI, I. & TODT, W. (1975): Die
Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen
Oberrheingrabens.- Aufschluss Sonderband 27, S. 205 - 212,
2 Abb., [VFMG e. V.] Heidelberg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von OKRUSCH, M., GEYER, G., JUNG,
J., HIMMELSBACH, G. & DIETL, C. (2010): Spessartsteine. Spessartin,
Spessartit und Buntsandstein - eine umfassende Geologie und
Mineralogie des Spessarts. Geographische, geologische,
petrographische, mineralogische und bergbaukundliche Einsichten in
ein deutsches Mittelgebirge. VI + 912 S., 2.532 meist farbigen
Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer ausklappbaren
Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.
LORENZ, J. (2022): Die Konkretionen im Spessart und am Untermain.
Ortsteine, Raseneisensteine, Lösskindel, Hornsteine, Ooide.- in
LORENZ, J. A. & der Naturwissenschaftliche Verein
Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen & Mangan. Erze,
Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten des
Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,
S. 61 - 132, 105 Abb., 7 Tab.
MÄUSSNEST, O. (1978): Die vulkanischen Vorkommen des
Meßtischblattes Obernburg/Main.- Jahresberichte und Mitteilungen
des Oberrheinischen Geologischen Vereins N. F. 60, S. 167
- 173, 1 Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung]
Stuttgart.
MÄUSSNEST, O. (1985): Bergbau und Vulkane auf Blatt 6102 Obernburg
a. Main.- Geologica Bavarica 87, S. 97 – 117, 9 Abb., GLA
München.
MÖSSINGER, F. (1955): Aus der Geschichte des Odenwälder
Bergbaues., S. 75 – 81, 4 Abb., - in: Neue Beiträge zur Kenntnis
der Mineral- und Gesteinswelt des Odenwaldes.- 2.
Sonderheft zum Mitteilungsblatt „DER AUFSCHLUSS“, 124 S., 59 Abb.,
VFMG Roßdorf anläßlich der Jahrestagung 1955 in Darmstadt.
NEMETH, K. & KERESZTURI, G. (2015): Monogenetic volcanism:
personal view and discussion.- International Joural of Earth
Sciences - Geologische Rundschau Volume 104, Number 8,
November 2015, Thematic Issue: From Mantle Roots to Surface
Eruptions: Cenozoic and Mesozoic Continental Basaltic Magmatism,
p. 2131 - 2146, 7 figs., Journal of the Deutsche Geologsiche
Gesellschaft - Geologische Vereinigung DGGV, [Springer Verlag]
Berlin - Heidelberg.
NICKEL, E. & FETTEL, M. (1985): Odenwald. Vorderer Odenwald
zwischen Darmstadt und Heidelberg.- Sammlung Geologischer Führer
Band 65, 2. Aufl., 231 S., 63 Abb., 45 Fig., 6 Tab., 1
petrographische Karte in der Umschlagtasche [Gebrüder Borntraeger]
Berlin.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
SALGER, M. (1973): Bunte Tertiärtone bei Alzenau/Unterfranken.-
Geologica Bavarica 67, S. 249 - 252, 1 Abb., GLA München.
SCHMEER, D. (1973): Petrographische und genetische Beobachtungen
an Einschlüssen (Knollen) in kleinen Tuffvorkommen der Umgebung
von Aschaffenburg.- Geologica Bavarica 67, S. 215 - 228, 3
Abb., 1 Tab., GLA München.
SCHMINCKE, H.-U. (2004): Volcanism.- 324 S., 401 figs. (396 in
Color), [Spinger Verlag] Berlin.
STREIT, R. & WEINELT, W. (1971): Geologische Karte von Bayern
1:25000 Erläuterungen zum Blatt Nr. 6020 Aschaffenburg.- S. 116 -
125, München.
TRAUTMANN, L. (1955): Die geologischen Verhältnisse einiger
Odenwälder Bergwerke.- S. 71 – 74, ohne Abb., in Chudoba, K. F.
(1955): Neue Beiträge zur Kenntnis der Mineral- und Gesteinswelt
des Odenwaldes.- 2. Sonderheft zum Mitteilungsblatt „Der
Aufschluss“, 124 S., Hrsg. Von der VFMG Roßdorf anläßlich der
Jahrestagung 1955 in Darmstadt.
VOGEL, A. O. (1930): Heimat- und Ortsgeschichte Mömlingen.-
274 S., 1 SW-Foto, diverse Zeichnungen, [ohne Verlag] ohne Ort.
Zurück zur Homepage
oder zurück an den Anfang der Seite