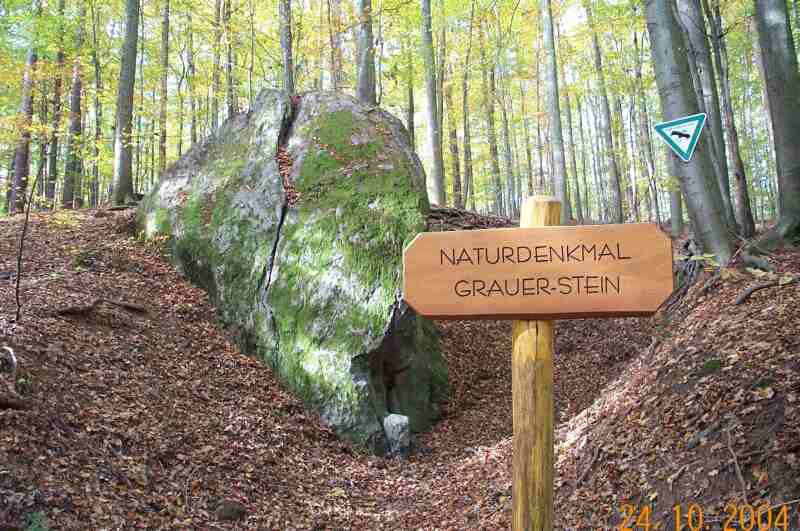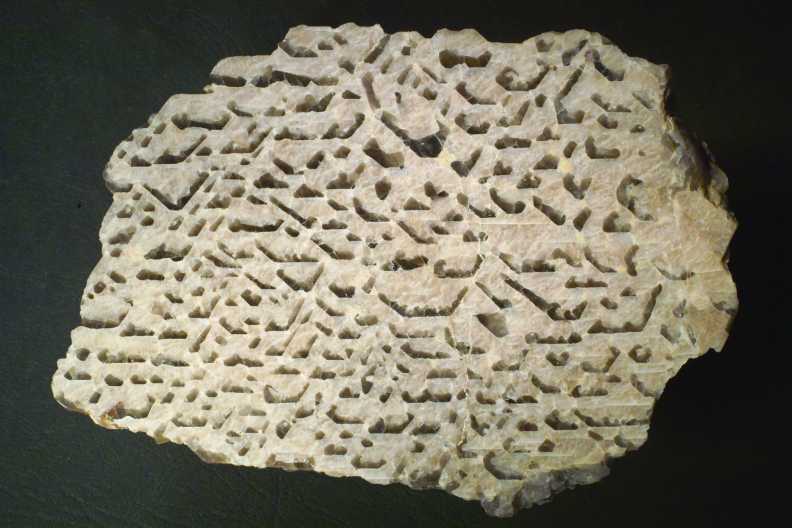Der Pegmatit
vom Grauenstein
zwischen Glattbach und Unterafferbach
im Spessart
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main
seit dem 09.09.2007 ist der Grauenstein bei Glattbach durch
einen Kulturrundweg "Künstlerdorf Glattbach" erschlossen:

Auftaktveranstaltung mit dem Gesangsverein, Dr. HIMMELSBACH, Dr.
ERMISCHER, Bürgermeister Fridolin FUCHS
und einem Besucher aus dem fernen Neuseeland am Morgen des
09.09.2007.

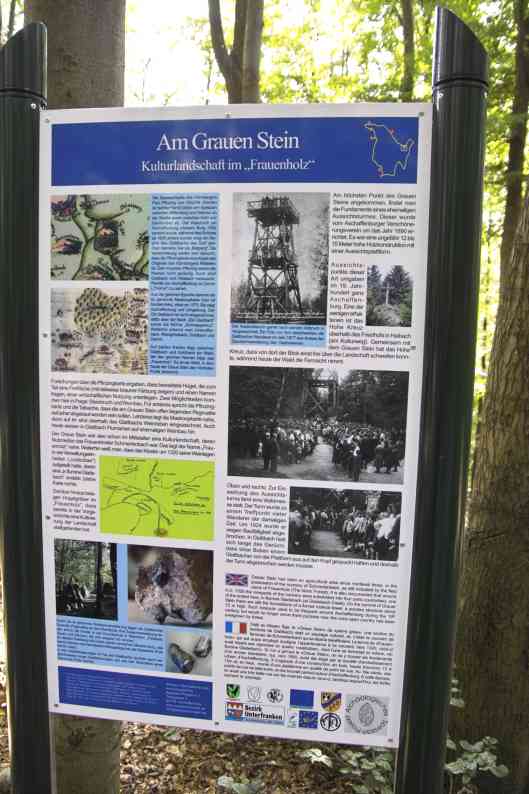
links: Joachim LORENZ (rechts neben Dr. Gerrit HIMMELSBACH)
erläutert die Natur eines Pegmatits, wo man sie findet, wozu
man sie braucht und was heute damit macht.
rechts: Die Tafel Nr. 2 des Rundweges auf dem Gipfel des 308 m*
hohen Grauensteins
mit den Ausführungen zum früher hier stehenden hölzernen
Aussichtsturmes;
aufgenommen am 09.09.2007.
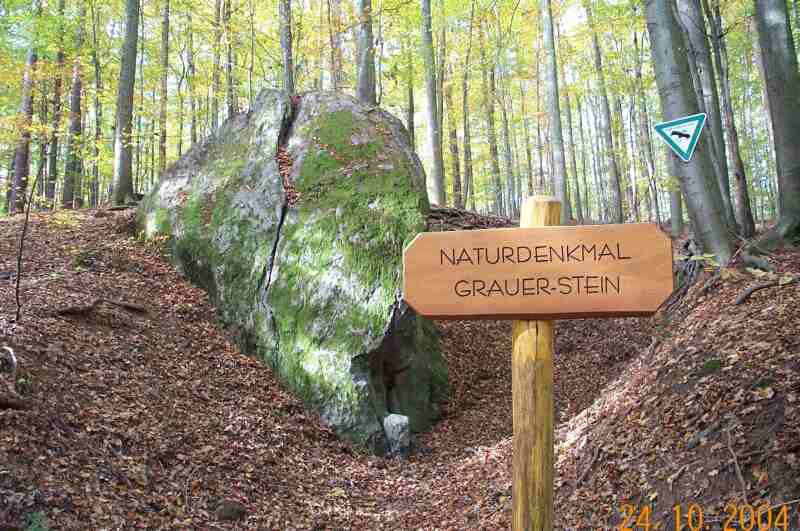
Auch wenn es so ausgeschildert ist: Es handelt sich um eine
freigelegte Scholle eines
Staurolith-Gneises am Grauenstein bei Glattbach. Der Grauenstein
ist jedoch bekannt für
die dort auftretenden Pegmatite;
aufgenommen am 24.10.2004.
*nach der Angabe der Topographischen Karte von Bayern Blatt
Alzenau (1:25.000); das Faltblatt desKulturrundweges weist 388 m
aus.
Lage
Historisches
Geologie
Mineralien
Literatur
Lage:
Der 308 m hohe Berg Grauenstein befindet sich zwischen den
Ortschaften Glattbach, Golbach und Unterafferbach (siehe auch
Okrusch et al. 2011 S. 159, Aufschluss Nr. 41). Am einfachsten
folgt man der Straße von Goldbach nach Unterafferbach. Vom
Schwimmbad in Goldbach windet sich die kurvige Straße durch einen
hohen Mischwald und errreicht auf dem Scheitelpunkt eine breite
Wegkreuzung mit einem ausgebauten Parkplatz. Hier folgt man dem
markierten Weg - durch eine Schranke gesichert - zum Grauenstein.
Hier auf dem höchsten Punkt findet man stark verwitterte Felsen
und Blöcke aus Pegmatit, der in kleinen Schürfen abgebaut worden
ist.
Die Felsen und Blöcke sind mit Moosen überwachsen. Der Name
Grauenstein ist sicher eine Folge der zahlreichen rundlichen
Felsblöcke des Berges, großtenteils aus Gneis, Pegmatit und
Amphibolit: graue Steine!
Der heutige Bestand an bis zu m³-großen, gut gerundeten Blöcken
ist sicher nur der kleine Rest eines des Berg umgürtenden
Blockmeeres, von dem der grösste Teil der Steingewinnung zum Opfer
fiel. Man erkennt das daran, dass sich an vielen Stellen die
frischen und splittrigen Abschläge von einer Steingewinnung
aufsammeln lassen. Weitere Pegmatit-Vorkommen um den Grauenstein
wurden durch einfache Abbaue erschlossen, wie zahlreiche
Abbauspuren zeigen.
Historisches:
Der Pegmatit (vom griechischen pegma für das
"Festgewordene") am Grauenstein wurde nachgewiesenermaßen im 19.
Jahrhundert abgebaut. Man benötigte die aus dem Pegmatit zu
gewinnenden Quarze und Feldspäte bei der Herstellung des
Steingutes und der Glasur in der Dämmer Pozellanmanufaktur.
Steingut als Geschirr und beeindruckende, bunt bemalte Figuren aus
dieser Produktion sind in dem Museum der Stadt Aschaffenburg im
Schloss Johannisburg zu sehen:


Hier zwei Bilder aus der sehr umfangreichen Sammlung mit Geschirr
und Figuren,
aufgenommen am 14.12.2003.
Es handelt sich trotz des Aussehens nicht um Porezllan, sondern
um Steingut, welches gut glasiert und bemalt ist. Porzellan ist
innen auch weiß, wogegen Steingut innen braun und nicht
transparent ist. Die Herstellung ist aber sonst weitgehend gleich,
aber man verwendet andere Rohstoffe. Man stellte die Gegenstände
mit heimischen Rohstoffen her und da es hier keine größeren
Kaolinit-Vorkommen gibt, konnte man kein Porzellan erzeugen.
Infolge der früher hohen Transportkosten (ganz im Gegensatz zu
heute) hätte sich das nicht gelohnt.
Größere Pegmatit-Vorkommen wurden im 19. Jahrhundert neben dem
Grauenstein auch bei Bessenbach und bei Dörrmorsbach abgebaut.
Leider ist wegen fehlender Akten und kaum mehr erkennbarer Abbaue
nicht sehr viel darüber bekannt.
Geologie:
Bei einem Pegmatit innerhalb des Staurolith-Gneises mit Amphibolit
handelt es sich um grob- bis riesenkörnige Gesteine mit einer sehr
variablen Zusammensetzung, entstanden aus den Restschmelzen von
gesteinsbildenden Prozessen. Die Kristallgröße kann bei großen
Vorkommen einige Meter erreichen; in den USA (Colorado) fand man
einen Feldspat mit einem Volumen von ca. 25.000 m³! Im Spessart
treten Pegmatite bevorzugt in den Gneisen und Dioriten als bis zu
einige Meter mächtige Gänge und Linsen auf. Die Feldspäte
erreichen dabei bis zu 0,5 m Größe.

Ca. 15 cm starker Pegmatit-Gang im Diorit (Dörrmorsbach). Man
erkennt
deutlich, dass die Quarze und Glimmer in der Mitte des Ganges
angereichert
sind,
aufgenommen am 12.07.2001.

Mittig aufgebrochener Pegmatit-Gang im Diorit. Man erkennt den
hohen Anteil
an den weißlichen bis leicht rosafarbenen Feldspäten, dazwischen
grauer Quarz
und ganz wenig schwarzer Glimmer (Biotit); Breite des Stückes ca.
1 m
(Dörrmorsbach);
aufgenommen am 09.02.2002.

silbrig glänzender Muskovit-Pegmatit mit sehr spärlichem Granat
und Spuren
von Turmalin (Sailauf),
Bildbreite ca. 14 cm
Diese Restschmelzen können bis zu 10% Wasser gelöst haben,
welches über komplexe Prozesse (Keinauslese) dazu führen, dass
wenige Kristalle gebildet werden, die dann zu einer enormen Größe
anwachsen können. Wenn durch Abkühlung keine Schmelze mehr
vorliegt, kommt ein Stadium, bei dem Mineralien aus einer
"wässrigen Phase" gebildet werden (Pneumatolyse). Nach weitere
Abkühlung kann noch ein hydrothermales Stadium folgen.
Dabei werden neben diesen Mineralien auch solche mit
leichtflüchtigen Elementen wie Fluor und Bor gebildet, aber auch
solche die sonst kaum in größeren Mengen zu finden sind: Seltene
Erden, Beryllium, Uran, Thorium, .... Dies macht größere Pegmatite
zu sehr wertvollen Lagerstätten für diese Elemente.
Pegmatite können enorme Größen von einigen hundert Metern
Mächigkeit bei Längen von km erreichen. Pegmatite sind in allen
Gegenden mit Graniten, Gneisen und metamorphen Gesteinen
verbreitet: Oberpfalz, Bayerischer Wald, Skandinavien, Ural,
Namibia, USA, Brasilien, .... Die in anderen Pegmatiten
verbreiteten Hohlräume mit frei auskristallisierten Mineralien
fehlen im Spessart.
Eindrucksvolles
Beispiel
für einen typischen Turmalin-Pegmatit:

Polierte Platte eines
Turmalin-Pegmatits mit dem Handelsnamen "Patagonia" aus
Brasilien;
aufgenommen am 03.11.2018.
Rechts unten sieht man den periodischen Beginn der
Kristallisation aus der Schmelze in der Form kleiner
Kristalle. Das Gestein hat hier eine granitische
Zusammensetzung (vermutlich stammt der Pegmatit aus
einem Granit). Die Keimauslese führt mit zunehmendem
Wachstum zu großen Kristallen aus
einem perthitischen, leicht gelblichen Feldspat und
Quarz, dazu große schwarze Schörl-Kristalle, etwas
silbriger Muskovit und schließlich grauer Quarz.
Im Zentrum des Pegmatits bilden sich riesige Kristalle,
wie man an dem Feldspat (Mikroklin) links oben erkennen
kann. Der Feldspat zeigt makroskopische
Entmischungslamellen (Perthit). Entlang der bräunlichen
Risse wurde auch etwas Pyrit gebildet. Infolge der
Schnittebene sind die Turmaline (Schörl) quer
bzw. schräg zur Längsachse geschnitten. Vermutlich sind
weitere Mineralien enthalten, so z. B. Amphibol. Die
eindrucksvolle Platte hat eine Breite von
etwa 2,5 m.
Solche Platten werden zur Raumgestaltung im Innern von
Gebäuden eingesetzt. Der Reiz dieses Werksteins liegt in
der selektiven Transluzenz des Quarzes,
wenn man eine solche Platte von Hinten beleuchtet.
Gesehen bei der Manufaktur Horst Zentgraf
GmbH, Im Gewerbegebiet 2, 63846 Laufach (Hain).
|
Im Spessart bestehen die Pegmatite meis aus grauem Quarz und bis
zu 15 cm großen Feldspatkörnern, die stellenweise auch typisch
"schriftgranitsch" verwachsen sind. Weitere Bestandteile sind die
Glimmerminerale Muskovit und Biotit. Diese können auch bis zu 10
cm Größe erreichen. Seltenere (akzessorische) Mineralien wie
Turmalin, Apatit, Spessartin, Allanit, Titanit und weitere
Mineralien kommen nur in den größeren Pegmatiten vor.
Infolge der schlechten Aufschlussverhältnisse sind Funde kaum
mehr möglich.
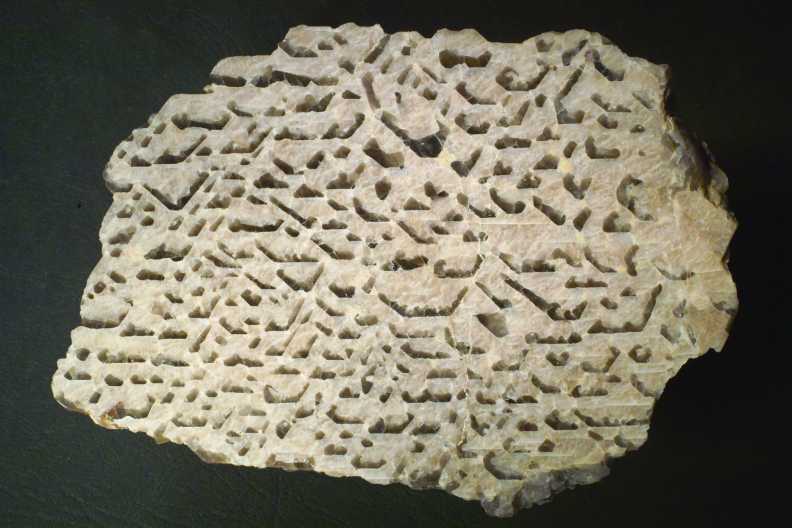
Pegmatit in schriftgranitischer Verwachsung von Quarz (dunkelgrau)
mit
Mikroklin (Kalifeldspat) aus einem Pegmatit von Arendal, Norwegen,
Bildbreite 13 cm
Als Besonderheit kann der Quarz und der Feldspat als orientierte
Verwachsung vorkomen. Dabei sind die Quarze als Relikte in der
Form einer nur teilweise ausgebildeten Form und d. h. in der Regel
ohne Kern in einer Matrix aus Kalifeldspat als Mikroklin bzw.
Mikrolinperthit eingewachsen. Weitere Mineralien fehlen in diesen
Partien. Werden solche Bereiche senkrecht zur c-Achse des
Pegmatits geschnitten, entsteht ein Bild welches entfernt an alte
Schriften erinnern, so dass man solche Gesteine als
"Schriftgranit" bezeichnet. Sie sind auch aus Glattbach bekannt
(siehe OKRUSCH & MATTHES 2013:338 Abb. 22.3):, jedoch liegt
mir kein geschliffenes und poliertes Stück vor. Die Genese dieser
Strukturvariante in den Feldspatpegmatiten ist nicht hinreichend
geklärt.
Mineralien:
Aus der Betriebszeit des Abbaues am Graustein werden in der
älteren Literatur erwähnt:
Quarz, Kalifeldspat, Muskovit, Biotit, Turmalin, Spessartin,
Ilmenit, Rutil und Magnetit.
Diese Mineralien können heute nicht mehr gefunden werden, weil nur
verwitterte Partien zugänglich sind. Allenfalls finden sich Stufen
in alten Sammlungen. Infolge fehlender Hohlräume gibt es keine
idiomorphen Kristalle, so dass kaum sammelwürdige Mineralien gab
und die "gewöhnlichen" Stücke wurden kaum aufgehoben.
Dass es keine Drusen mit frei kristallisierten
Mineralien gibt, kann man so erklären:
Nicht alle Pegmatite sind Neubildungen, die in der Spätphase der
Metamorphose entstanden sind. Insbesondere die Pegmatite der einst
magmatischen Gesteine wie Granite und Diorite entstanden in der
Spätphase der Gesteinskristallisation. Mit der metamorphen
Überprägung wurden diese Gesteine in den Prozess einbezogen und
mechanisch verändert, was man an den verbogenen Mineralien wie dem
Turmalin und den Glimmern gut sehen kann. Die Glimmer wurden
wellig, die Granat-Kristalle deformiert und die Turmaline
zerbrachen und wurden von neu gebildetem Quarz verheilt (siehe
Abb. unten). Dabei kam es auch zum Schließen eventuell verhandener
Hohlräume, die es sicher gab, wie aus historischen Berichten und
auch aus ganz wenigen Eigenfunden bekannt ist.

Schwarzer Turmalin (Schörl), extrem zerbrochen im grauen Quarz,
darüber Muskovit in kleinen Blättchen, gefunden in der 1930er
Jahren
im Steinbruch im Wendelberg bei Haibach, ehemalige Sammlung
GOTTLIEB, aufgenommen in der Universität Frankfurt am 24.06.1997
(heute im Naturwissenschaftlichen Museum der Stadt Aschaffenburg),
Bildbreite ca. 15 cm
In den Pegmatit-führenden Gesteinen im Spessart kann man
grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Pegmatiten unterscheiden:
- Pegmatite, die nach der Kristallisation des
Vorläufergesteins entstanden
Diese sind daran erkennbar, dass die Glimmer, Turmaline,
Allanit usw. verbogen, rissig und ganz zerissen sein können
(siehe Foto oben). Eine Materialzufuhr sorgte für ein
Schließen der Risse nach dem Zerbrechen. Damit ist auch
erklärbar, warum es keine Hohlräume mit frei gewachsenen
Kristallen gibt, denn diese sind bzw. wären zerdrückt worden.
Es ist die Folge der Metamorphose bei der Umwandlung des
Granites in einen Gneis. Beispiele sind die Pegmatite im
Biotit-Gneis im Wendelberg bei
Haibach.
- Pegmatite, die nach der Metamorphose entstanden
Diese sind daran erkennbar, dass die Glimmer, Turmaline,
Allanit usw. nicht verbogen sind. Die Glimmer sind dabei
gerade und die Turmaline nicht zerbrochen. Dabei durchschlugen
die jüngeren Pegmatite die älteren Pegmatite (siehe Foto
unten); diese Art der Pegmatite sind in der Regel weniger
mächtig und seltener. Ein Beispiel sind die Pegmatite im
Biotit-Gneis am Godelsberg bei Aschaffenburg; diese
Steinbrüche waren im 19. Jahrhundert im Betrieb.

Verschieden alte Pegmatit-Gänge im Diorit aus dem Tunnel
Metzberg
bei Hain im Spessart, aufgenommen am 05.02.2017,
Bildbreite etwa 1,5 m
Wie in der Natur üblich, gibt es auch zahlreiche
Übergangsformen, die Eigenschaften von beiden Arten
zeigen.
Literatur:
Autorenkollektiv (2012): Granitic Pegmatites.- Elements. An
international Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology
Vol. 8, Number 4, August 2012, p. 241 - 320,
LONDON, D. (2008): Pegmatites.- The Canadian Mineralogist Special
Publication 10, 345 p., many figs., Mineralogical
Assiciation of Canda, Ottwa, Canada.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 663ff.
LORENZ, J. (2020): Pegmatite – Quell für seltene Mineralien.-
NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe Herbst/Winter 2020, S. 58 -
60, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer, Band 44, 220 S., 14 Abb., 3 gefaltete
Beilagen, 1 großformatige mehrfarb. geolog. Karte, [Gebrüder
Borntraeger] Berlin.
MEIER, S. (2021): Schriftgranit. Lapis Info Gesteine und ihre
Mineralin 11.- Lapis Das aktuelle Monatsmagazin für Liebhaber
& Sammler von Mineralien & Edelsteinen, Jahrgang 46,
Nr. 1 Jan. 2021, S. 42 - 45, 10 Abb., [C. Weise Verlag GmbH]
München.
OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen
zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- 336
S. München 1967.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
OKRUSCH, M. & MATTHES, S. (2013): Mineralogie. Eine Einführung
in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde.-
9. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, 728 S., 476
Abb., davon 182 in Farbe), zahlreiche Tab. und Formeln,
[SpringerSpektrum Verlag] Berlin.
PFEIFER, E. (1996): 1746 wurde in Höchst am Main die
Pozellanmanufaktur gegründet. Ab 1840, als sie es nicht mehr gab,
kamen die Hächster Figuren als Dämmer Steingut auf den Markt.-
Spessart Heft 3 1996, S. 3 - 6, 6 Abb., [Druck und Verlag
Main-Echo Kirsch GmbH & Co.] Aschaffenburg.
SCHNEIDERHÖHN, H. (1961): Die Pegmatite.- Die Erzlagerstätten der
Erde Band II, 720 S., 264 Abb. im Text und auf 16 Falttafeln,
[Gustav Fischer Verlag] Stuttgart.
STENGER, E. (1948): Die Steingutfabrik Damm bei Aschaffenburg 1827
- 1884.- 208 S., unveränderter Nachdruck 1990 als Veröffentlichung
des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e. V., 117 Abb.,
davon 24 Seiten als Anhang, [Verlagsdruckerei Schmidt GmbH]
Neustadt a. d. Aisch

Der Rotbuchenwald am Grauenstein im Herbst
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite