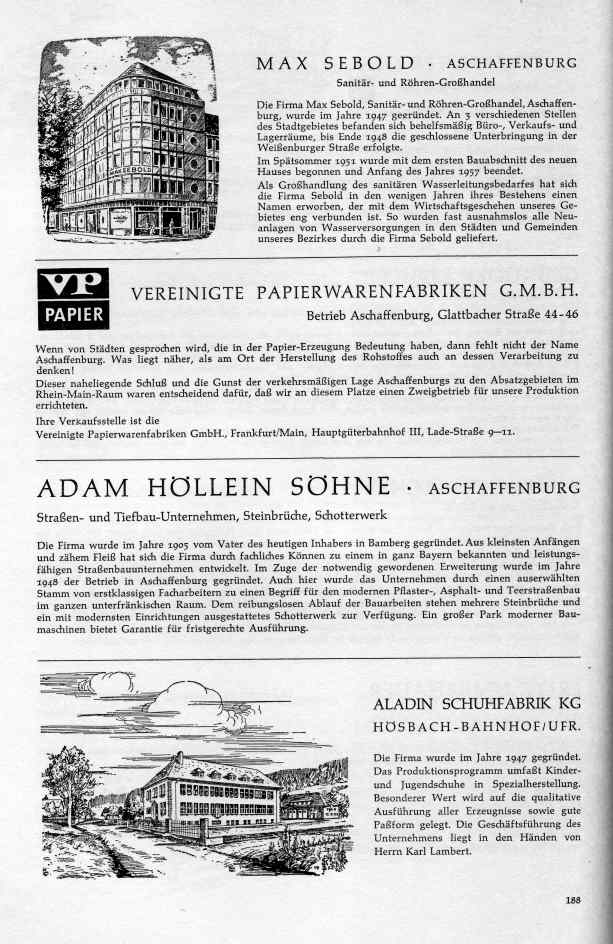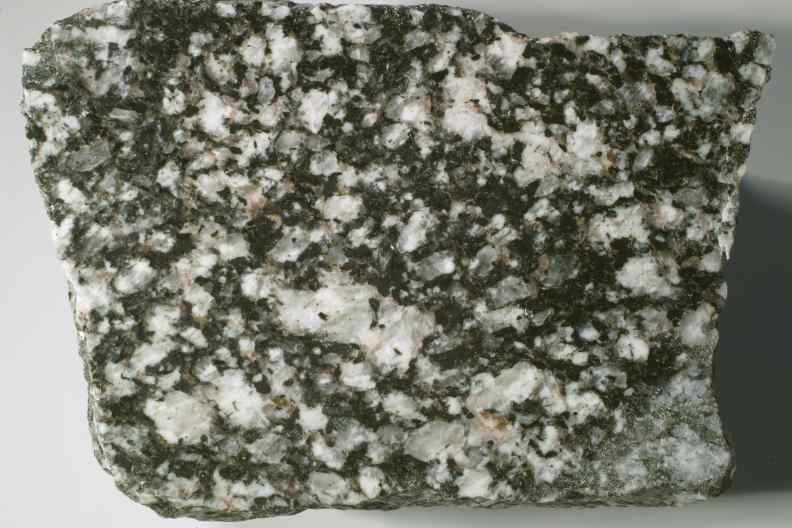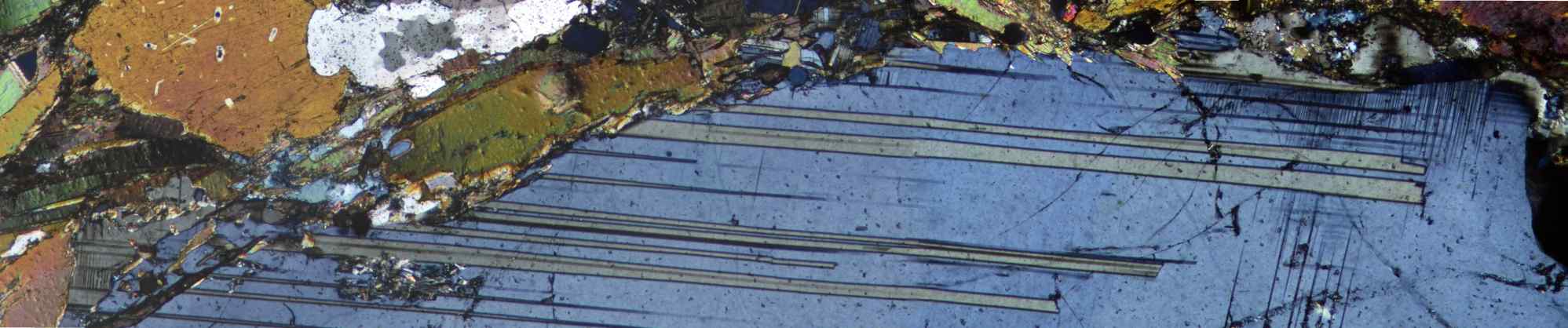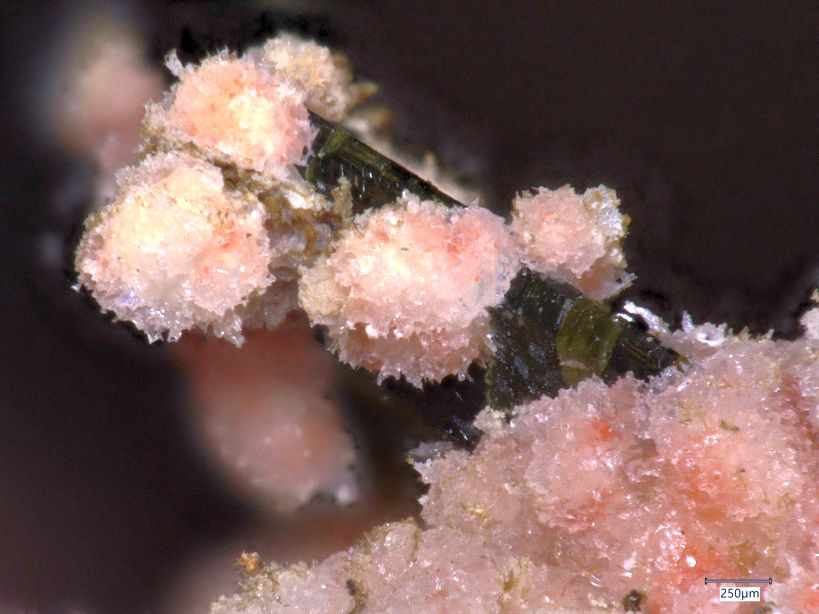Der aufgelassene Höllein´sche
Steinbruch
am Stengerts bei
Schweinheim
(Aschaffenburg)
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Teilehmer der Exkursion ins
Spessart-Kristallin unter Führung von Prof. Dr. MATTHES
aus Würzburg anlässlich der 99. Jahrestagung des
Oberrheinischen Geologischen Vereins (OGV) in Bad Orb
besuchten
am 31.03.1978 den Steinbruch.


Der große Steinbruch am Stengerts am 06.09.2006,
also noch vor dem Umbau und rechts am 5. Februar 2012

Der Steinbruch hat inzwischen ein treppenfömiges
Aussehen und die neuen Wände sind entlang der Klüfte angelegt
worden,
aufgenomen am 22.12.2015

Der fertig sanierte Steinbruch mit den
treppenförmigen Absätzen, die sich an den Kluftflächen
orientieren. Der Bewuchs wurde entfernt, so
dass sich die Bewohner der Felsen ansiedeln können,
aufgenommen am 25.02.2018

Mit einem Tag der offenen Tür beim
Schützenverein wurde die Sanierung des Steinbruchs
abgeschlossen,
aufgenommen am 06.07.2019.
Zugang
Der große Steinbruch liegt am Stengerts zwischen Schweinheim,
Aschaffenburg und Gailbach. Zur Anfahrt benutzt man die Straße
zwischen Schweiheim und Gailbach. Von hier führt eine geschotterte
Straße zum Vereinsheim; dahinter liegt der eingezäunte Steinbruch
("Granit" der GK) SE Aschaffenburg-Schweinheim, östlich des
früheren Truppenübungsplatzes der US-Streitkräfte (GK 6021
Haibach, R 1360 H 3450, siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 191,
Aufschluss Nr. 81), die früher in Aschaffenburg stationiert waren.
Achtung!
Da es sich um das eingezäunte Gelände eines
Schützenvereins handelt, ist der Zugang nur außerhalb der
Schießzeiten und nach Absprache mit dem Vorstand des
Vereins möglich.
Ein Betreten ist sonst lebensgefährlich!
Zahlreiche Steinbrüche zeugen von einer ehemaligen Steinindustrie
zwischen Gailbach und Schweinheim. Der große und eindrucksvolle
Steinbruch im Diorit am Stengerts wurde bis 1969 durch die Fa. A.
Höllein zur Schottergewinnung abgebaut.
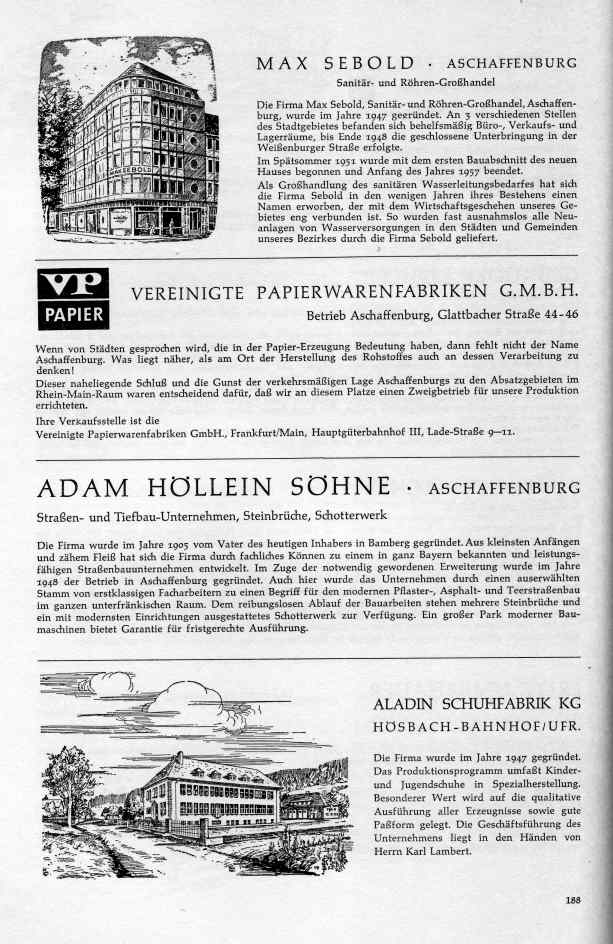
Anzeige der Fa. Adam Höllein Söhne Aschaffenburg
aus dem Jahre
1957 (Stadt Aschaffenburg & Nagel).
Später aufgelassen, wurde er 1974 vom sehr erfolgreichen
aschaffenburger Schützenverein "St. Sebastianus Aschaffenburg
1899 e. V." in eine Schießanlage umgewandelt. Hier können
nahezu alle gängigen Waffen geschossen werden. Neben Wettbewerben
werden auch Schützen und Jäger aus- und fortgebildet. Es gibt
einen Trapp-Stand, auch dem man auch mit alten
Steinschlossgewehren auf Tonscheiben schießt!
Das Gestein in dem Steinbruch ist ein Diorit - kein
Granit!

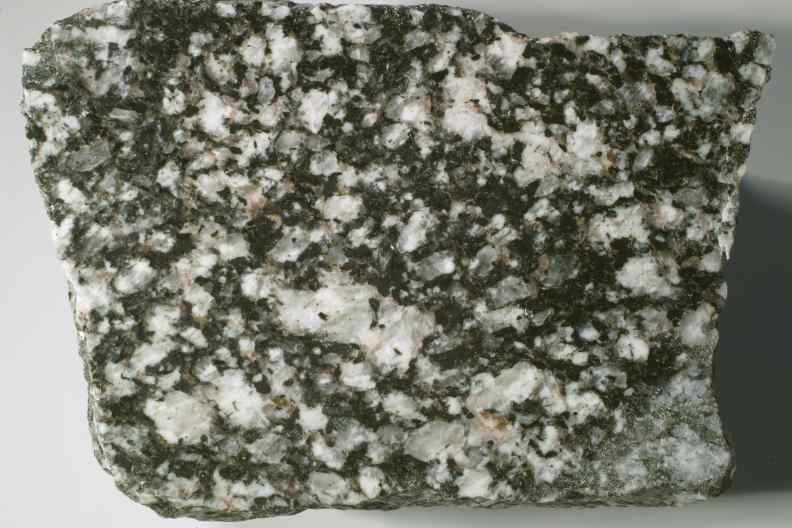

Links: Dunkle, steil stehende Amphibolit-Scholle
im Diorit Bildbreite ca. 1 m,
Mitte: Diorit aus dem Steinbruch angeschliffen und poliert,
Bildbreite 10 cm. Hier erkennt man sehr schön den Aufbau des
gesprenkelten Gesteins aus dem hellen Feldspat (Plagioklas), dem
dunklen Biotit und der schwarzen
Hornblende.
Rechts: Rundliche, metergroße Kernsteine des Diorit im oberen
Bereich des Steinbruchs,
aufgenommen am 03.12.2011.
Die Gefügemerkmale des Quarzdiorit-Granodiorit-Komplexes waren
bereits den älteren Beobachtern aufgefallen und hatten zu
widersprüchlichen Deutungen Anlass gegeben. Diese reichten von
rein metamorpher Entstehung des „Hornblendegneisses“ (Thürach
1893) bis zu einer rein magmatischen Bildung des „Diorits“ (Klemm
1895). Vermittelnd nimmt Bücking (1892) an, dass der „Dioritgneis“
durch tektonische Überprägung aus einem Plutonit entstanden sei.
Auch in neuerer Zeit wurde die Entstehung des
Quarzdiorit-Granodiorit-Komplexes kontrovers diskutiert. Der rein
magmatischen Deutung von Braitsch (1957a) setzte Okrusch (1963)
ein „transformistisches“ Modell entgegen, wonach der Diorit durch
„metablastische“ Umkristallisation aus einem metamorphen
Altbestand entstanden ist. Heute unterliegt es jedoch keinem
Zweifel mehr, dass der Quarzdiorit-Granodiorit-Komplex – ähnlich
wie die Diorit- und Granodiorit-Plutone der Bergsträßer Odenwaldes
- eine echte magmatische Intrusion darstellt (Anthes 1998). Die
verbreiteten basischen (schwarzen) Schollen stellen
endomagmatische Einschlüsse dar, wie sie in I-Typ-Magmatiten
typisch sind (White & Chappell 1977). Sie weisen auf den
Bildungsort des quarzdioritischen Magmas im Oberen Erdmantel hin.
Demgegenüber muss die gestreifte Gneis-Amphibolit-Scholle, die im
Höllein’schen Steinbruch am Stengerts ansteht, als großer
Nebengesteins-Einschluss aus der Elterhof-Formation gedeutet
werden. 207Pb-206Pb-Datierungen an einem Einzelzirkon aus dem
Quarzdiorit ergab einen Alterswert von 329,8 +/- 2,1 Ma, der als
Intrusionsalter interpretiert wird (Anthes & Reischmann 2001).
Eine neuere Datierung an Zirkonkristallen erbrachte ein
Kristallisationsalter von 330,4 ±2,0 Ma für den Spessart (SIEBEL
et al. 2012).
Der auflässige Steinbruch am Stengerts, der immer noch frisches
Material bietet, er erschließt den Quarzdiorit-Granodiorit-Komplex
in der Nähe seiner Nordgrenze zur Elterhof-Formation, die zugleich
die Südflanke der Spessart-Antiform bildet. Diese Grenzregion ist
durch eine ausgeprägtere Foliation im Quarzdiorit gekennzeichnet,
ferner durch Einschaltungen von Biotit-Amphiboliten, die in der
SE-Ecke des Steinbruchs in Form einer großen Scholle
aufgeschlossen sind. Sie ähneln den Amphiboliten der
Elterhof-Formation und wechsellagern wie diese mit
Biotit-Hornblende-Plagioklas-und Biotit-Plagioklas-Gneisen,
Biotit-Plagioklas-Schiefern aplitischen Quarz-Plagioklas-Adern
sowie prä- bis syntektonischen pegmatoiden Einschaltungen.

Pegmatit aus Quarz, Kalifeldspat und Biotit im
Diorit,
aufgenommen am 15.11.2011
Mineralien
Bemerkenswert ist das verbreitete Vorkommen von bis zu 2 cm
großen, braunen und oft rissigen Titanit-Kristallen. Diese
„briefkuvertförmigen“ Kristalle fallen durch den starken Glanz
auf. Solche Stücke wurden bis in die 1960er und ~70er Jahren
reichlich gefunden und gelangten in viele Sammlungen. Infolge
des Mangels an zerkleinertem Gestein konnten solche Exemplare
bis zur Sanierung 2011 nicht mehr gefunden werden.

verzerrter, brauner und beschädigter
Titanit-Kristall im Diorit,
Bildbreite 1 cm.
Die wenigen Pegmatite führen selten auch etwas Allanit, wenn
auch nur in Größen bis zu 1 cm.
Als Sekundärmineralien treten in den Klüften selten auf:
Epidot, Chlorit, Sericit, Skapolith, Saponit, Prehnit, Quarz,
Adular, Calcit, Pyrit und Hämatit. Bemerkenswert dabei sind die
bis zu 5 cm mächtigen Kluftfüllungen aus weißem bis bräunlichem
Skapolith. Dieser führt dann reichlich hellbraune
Titanit-Kristalle.

Brauner Titanit-Kristall in einer feinkristallinen
Matrix aus Skapolith (Mejonit mit
deutlichen Marialith-Gehalten),
Bildbreite 4 cm
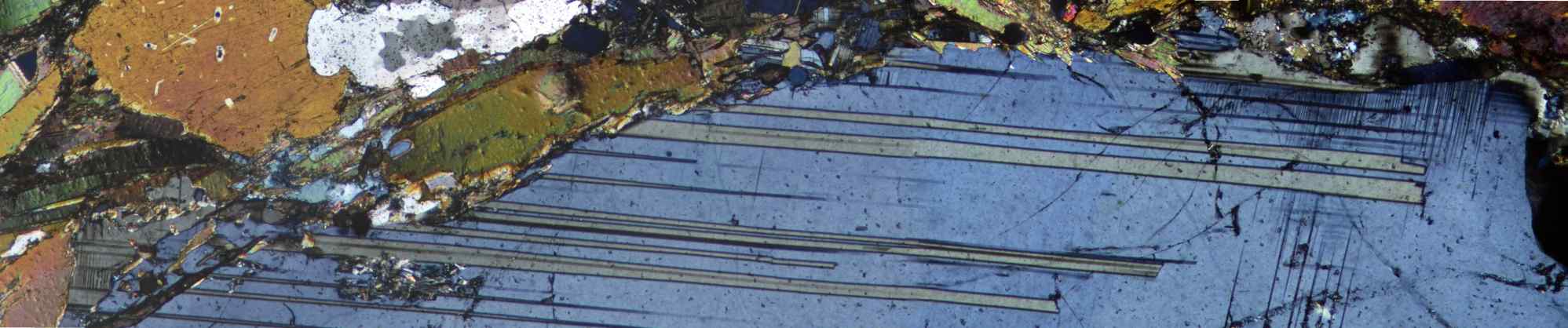
Plagioklas-Kristall aus dem Diorit (Dünnschliff im
polarsierten Licht und gekreuzten Polarisatoren),
Bildbreite 4 mm
Bemerkenswert ist, dass die größten Skapolith-Massen, die aus dem
Spessart bekannt wurden, aus diesem Steinbruch stammen. Sie sind
unscheinbar und werden im Steinbruch bzw. im Haufwerk beim Abbau
kaum als solche erkannt, da man diese beim flüchtigen Hinsehen mit
Feldspäten oder Calcit verwechselt:

Weißliche Massen aus einem derben Skapolith im Diorit als
ca. 2 cm mächtige Gangfüllung,
Bildbreite 22 cm
|

Bruchfläche eines derben, körnigen Skapolith mit lagenweise
eingelagertem Titanit und Amphibol,
Bildbreite 6 cm
|

Angeschliffen und poliertes Gangstück eines feinkörniges,
rissigen Skapoliths aus dem Diorit,
Bildbreite 13 cm.
|

Rissiger Titanit im feinkörnigen, sehr verschiedenfarbigem
Skapolith, der durch die Sprengung zur Lockerung des
Gesteins rissig ist, angeschliffen und poliert,
Bildbreite 6 cm
|

Klüfte mit hellbraunen Eisenoxiden und Schichtsilkaten auf
dem Diorit unter einer Bedeckung aus rundlichen
Verwitterungsformen,
aufgenommen am 21.04.2013
|

Kluft mit Chlorit, Quarz, Epidot und final mit Calcit
gefüllt, wobei der Calcit hier partiell natürlich weggelöst
wurde, Bildbreite ca. 7 cm,
aufgenommen am 21.04.2013.
Es bestand keine Chance, diese Mineralien aus dem ca. 1 t
schweren Block zu lösen.
|

Ca. 3 mm großer, metamikter und dunkelbrauner
Allanit-Kristall im Diorit mit einer charakteristischen
"Sprengsonne";
Bildbreite 5 mm
|

Kleiner, briefkuvertförmger und brauner Titanit-Kristall im
Diorit,
Bildbreite 5 mm
|

Ca. 2 m hoher, schräg durch Bild laufender Harnisch im
Diorit (man beachte den Hammer als Maßstab unten rechts),
aufgenommen am 21.04.2013
|

Felsblock mit grauem Quarz und weißem Skapolith als
Kluftfüllung im Diorit;
aufgenommen am 06.05.2017
|

Der Steinbruch am 15.02.2019
|

Der Steinbruch am 10.04.2020
|

Chlorit-Blättchen neben Epidot auf Quarz einer Kluft im
Diorit,
Bildbreite 1,5 mm
|

Blättriger Hämatit als Tafel in einer Kluft im Diorit,
Bildbreite 6 mm
|
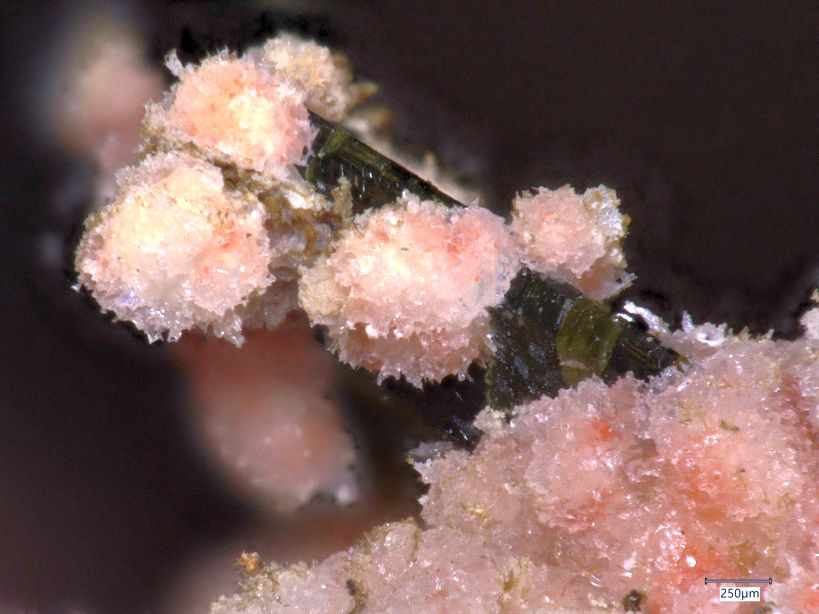
Weißliche Prehnit-Kristalle als kugelig-runde Aggregate auf
Epidot-Kristallen,
Bildbreite 3 mm
|
Die hier aufgeführten Beobachtungen zeigen die Bedeutung des
Aufschlusses für die Genese des im südlichen Vorspessarts
verbreiteten Gesteins. Im Spessart wird derzeit nur noch in einem
Steinbruch bei Dörrmorsbach (Fa. Erwin Stahl)
das gleiche Gestein zur Herstellung von Wasserbausteinen abgebaut.
Aus den vorgenannten Gründen ist der Steinbruch als Geotop im
Kataster des Landesamtes für Umwelt und Geologie in München
geführt (LFU-Nr. 660A004).

Teilnehmer der Führung in den Steinbruch zum Tag
des Geotops am 17.09.2006 im
Schatten der großen Wand.
Die Universitäten der weiteren Umgebung – von Bonn über Mainz
bis nach Erlangen suchen diesen Steinbruch mangels anderer
Vorkommen – im Rahmen von Exkursionen regelmäßig auf. Der
Schützenverein ermöglicht interessierten Gruppen den ungehinderten
Zugang, z. B. auch am bundesweiten Tag des Geotops am 3. Sonntag
im September. Termine können mit dem Vorstand des Vereins
vereinbart werden. Für die Mitglieder des Schützenvereins wurde
zuletzt am 22.05.2011 eine geologische Führung angeboten und bei
schönem Wetter durchgeführt.
Problem?
Der Diorit weist – wie man in dem Steinbruch unschwer erkennen
kann – nur wenige, sehr dünne Klüfte auf, die jedoch keine
Wegsamkeit für eine zirkulierendes Wasser darstellen. Der
Untergrund der Steinbruchsohle besteht aus kaum verwittertem
Gestein mit den gleichen Eigenschaften wie es im Bruch an den
Wänden zu sehen ist, so dass es keine Grundwasservorkommen gibt.
Mit einer Änderung der Eigenschaften des hier anstehenden, von
granitähnlichen Eigenschaften geprägten Gesteins ist aufgrund der
Verwitterungsresistenz und Frostbeständigkeit in den
nächsten paar Generationen nicht zu rechnen. Die Steinbruchsohle
besteht nach einer ebenen Schicht von aufgefülltem Material und
der Bebauung aus dichtem Fels. Ein Versickern von Wasser über die
Klüfte findet – wenn überhaupt – in einem sehr geringen Umfang
statt. Wie man sehen kann, läuft das Regenwasser auf der Zufahrt
aus dem Steinbruch ab.


Der in Teilen nach dem Umbau wieder begrünte
Steinbruch am 05.11.2011 und am 03.11.2011.
Der Steinbruch wurde nach über 30 Jahren des Schießens mit Blei-
und anderen Metallschrot in den Jahren 2010 bis 2012 umgebaut und
dabei die Sedimente aus dem Schrot wiedergewonnen. Ein Abgang von
schwermetallhaltigen Wässern in tiefere Klüfte ist infolge des
Aufbaus des Diorits und der weitgehend geschlossenen Klüftung
nicht zu befürchten. Dazu wurden alle Bäume und Sträucher aus der
Steinbruchwand entfernt und die losen Gesteinsmassen gesprengt.
Immer dort wo mit Schrot geschossen wurde, sind die Reste der
Schrotkügelchen vorhanden. Je nachdem welches Schrot verwendet
wurde (früher nahezu ausschließlich Blei) ist dieser nachweisbar.
Heute wird als Substitut neben Bismut, Stahl auch Wolfram und
Legierungen verschossen, wobei auch ummantelte Metalle Verwendung
fanden. Es gibt inzwischen auch Untersuchungen zum
Langzeitverhalten und zur Verwitterung der Schrote. Diese bestehen
nach BABIUN et al. (2014) aus den aus dem Mineralreich bekannten
Phasen wie z. B. Plattnerit, Cerrusit, Anglesit, Galenit,
Stolzit, Scheelit, Goethit, Lepidokrokit, Smithsonit, Bismoclit
und Abhurit. Diese Mineralien sind aus den Oxidationszonen von
Erzlagerstätten und Bergbauhalden gut bekannt.
Das Material wurde dann bis auf ca. 50 cm mit einem Hammer am
Bagger zerkleinert und abgefahren. Ein Teil des Materials wurde in
Obernau zwischen gelagert. Leider wurden dabei keine der hellen
Partien angefahren, die die schönen Titanit-Kristalle beinhalten.
Auch fanden sich kaum Kluftflächen oder gar offene Klüfte mit den
typischen Mineralien wie Epidot, Chlorit usw. Mit dem Ende der
Sanierungsarbeiten schwinden auch die Chancen auf weitere
Funde.



Wurfmaschinen für die Wurfscheiben oder Tontauben,
rechts die "Tontauben" mit einem Durchmesser von ca. 11 cm,
hergestellt aus einem sehr spröden, keramischen Material und
lackiert mit einer auffälligen Farbe. Die
Scherben der Scheiben findet man im gesamten Steinbruch.
Neuerdings werden auch knallig gelbe Tontauben verwandt,
aufgenommen am 24.12.2011.
Der Steinbruch wird derzeit von Zeit zu Zeit mit schwerem Gerät im
oberen Bereich bearbeitet und die dabei gewonnenen Gesteinsmassen
werden vor Ort zerkleinert und abgefahren. Leider sind dabei kaum
nennenswerte Funde gemacht worden.

Der große Steinbruch mit den teilweise
wiederhergestellten Anlagen (im Vordergrund nicht sichtbar),
aufgenommen am 08.09.2012
Derzeit wird das Gestein abgebaut und in einer mobilen Anlage
zerkleinert und klassiert. Ein Teil der Steine wird an den Rhein
nach Biblis gefahren und dort als Verstärkung in den
Hochwasserdamm des Rheins eingebaut. Das sehr harte und
verwitterungsresistente Gesteine bietet einen hervorragenden
Schutz gegen im Damm wühlende Tiere, die die Dichtigkeit des
Dammes beeinträchtigen können.

So liegen in Sichtweite des inzwischen aus
politischen Gründen still gelegten
Kernkraftwerks Biblis die Berge des Diorits aus Schweinheim,
aufgenommen am 03.04.2014
Wie in vielen, baumlosen Steinbrüchen des Spessarts, wurde
auch dieser Steinbruch zu einem Nistplatz eines Uhus, der sich
aber an dem Schießen nicht stört. Damit sind aufgrund einer sehr
anthropozentrischen Naturschutzgesetzgebung Probleme
vorprogrammiert, die durch eine mehr oder minder merkwürdige
örtliche Auslegung zu Interessenskollisionen führt.
Literatur:
ABTHES, G. (1998): Geodynamische Entwicklung der Mitteldeutschen
Kristallinschwelle: Geochronologie und Isotopengeochemie. – Dr.
rer. nat. Diss. Univ. Mainz, 154 S.
ANTHES, G. & REISCHMANN, T. (2001): Timing of granitoid
magmatism in the eastern mid-German crystalline rise. – J. Geodyn.
31, 119-143.
BABUIN, J. L., MILLER, J. W. & MOORHEAD, K. K. (2014):
Corrosion Mineralogy of common Bird Shot Types in North Carolina,
USA, Environments.- The Canadian Mineralogist Vol. 52 Part
3 June 2014, p. 487 - 500, 6 fig., 5 tabs., The
Mineralogical Society of Canada.
BRAITSCH, O. (1957a): Beitrag zur Kenntnis der kristallinen
Gesteine des südlichen Spessarts und ihrer geologisch-tektonischen
Geschichte. - Abh. hess. Landesamt Bodenforsch. 18, 21-72,
Wiesbaden.
LIPPOLT, H. J. (1986): Nachweis altpaläozoischer Primäralter
(Rb-Sr) und karbonischer Abkühlungsalter (K-Ar) der
Muskovit-Biotit-Gneise des Spessarts und der Biotit-Gneise des
Böllsteiner Odenwaldes. - Geol. Rundschau 75, 569- 583.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- IV + 912 S., 2.532
meist farbigen Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer
ausklappbaren Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 56f, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,
Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei
Joh. Walch] Augsburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965b): Spessart. - Sammlung
geologischer Führer 44, X, 220 S., Berlin (Borntraeger).
MATTHES, S., OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1967): Das kristalline
Grundgebirge des Vorspessarts.- in Backhaus, E. (1967):
Exkursionsführer zur 88. Jahrestagung des Oberrheinischen
Geologischen Vereins vom 28. März - 1. April 1967 in
Aschaffenburg.- Nachricht. d. Naturwissenschaftl. Museums d. Stadt
Aschaffenburg, Heft 74, 113 S., Aschaffenburg.
MATTHES, S. (1978): Der kristalline Spessart (Exkursion C am 31.
März 1978).- Jahresberichte und Mitteilungen des
Oberrheinischen Geologischen Vereins N. F. 60, S. 65 - 78,
4 Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
NASIR, S., OKRUSCH, M., KREUZER, H., LENZ, H. & HÖHNDORF, A.
(1991): Geochronology of the Spessart crystalline complex,
mid-German crystalline rise. - Mineral. Petrol, 43, 39-
55.
OKRUSCH, M. (1963): Bestandsaufnahme und Deutung dioritartiger
Gesteine im südlichen Vorspessart. Ein Beitrag zum Dioritproblem.
- Geol. Bavarica 51, 4-107, München.
OKRUSCH, M. & RICHTER, P. (1969): Zur Geochemie der
Diorit-Gruppe – Vergleichende Untersuchungen an Gesteinen des
Bayerischen Waldes, des Spessarts und des Odenwaldes
(Süd-Deutschland). - Contrib. Mineral. Petrol. 21, 75-
110.
OKRUSCH, M. & WEBER K. (1996): Der Kristallinkomplex des
Vorspessart. - Z. geol. Wiss. 24,141-174, Berlin.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
Stadt Aschaffenburg & NAGEL, W. A. [Hrsg.] (1957):
Aschaffenburg Mittelpunkt des fränkischen Untermaingebietes.-
Deutschland baut auf. Eine Folge deutscher Städte- und
Landschaftbilder von gestern und heute, 196 S., 268 SW-Abb. (davon
100 als Photos), 5 Farbtafeln (davon 1 ausklappbar), [Kuwe-Verlag]
Hanau.
SIEBEL, W., ERGOLU, S., SHANG, C. K. & ROHRMÜLLER, J. (2012):
Zircon geochronology, elemental and Sr-Nd-isotope geochemistry of
two Variscan granitoids from the Odenwald-Spessart crystalline
complex (mid-German crystalline rise).- Miner. Petrol., 105,
187 - 200, Berlin.
WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:25000, Blatt 6021 – Haibach, 246 S., München (Bayer.
Geol. Landesamt).
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite