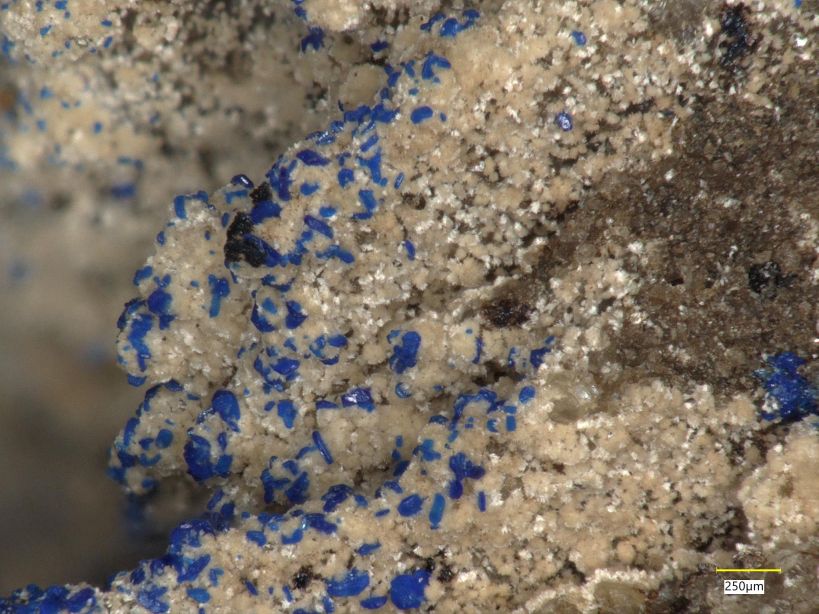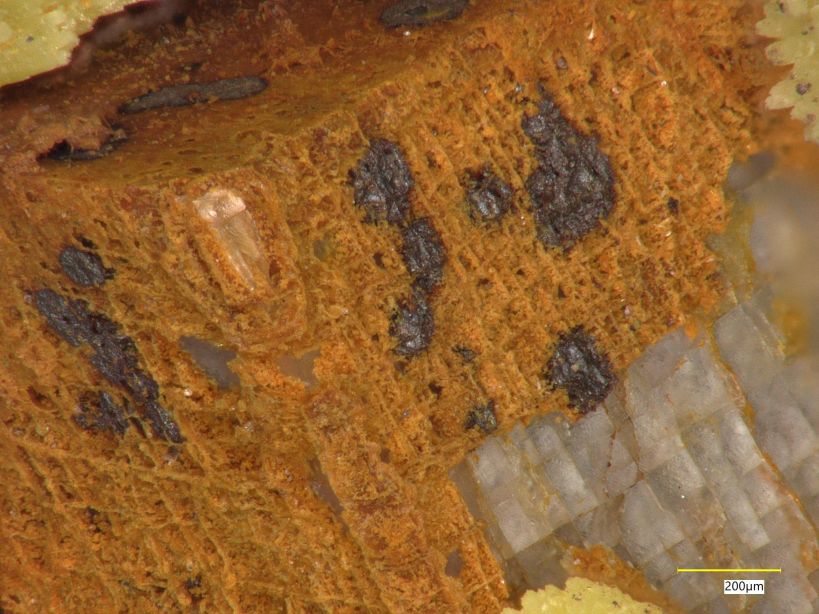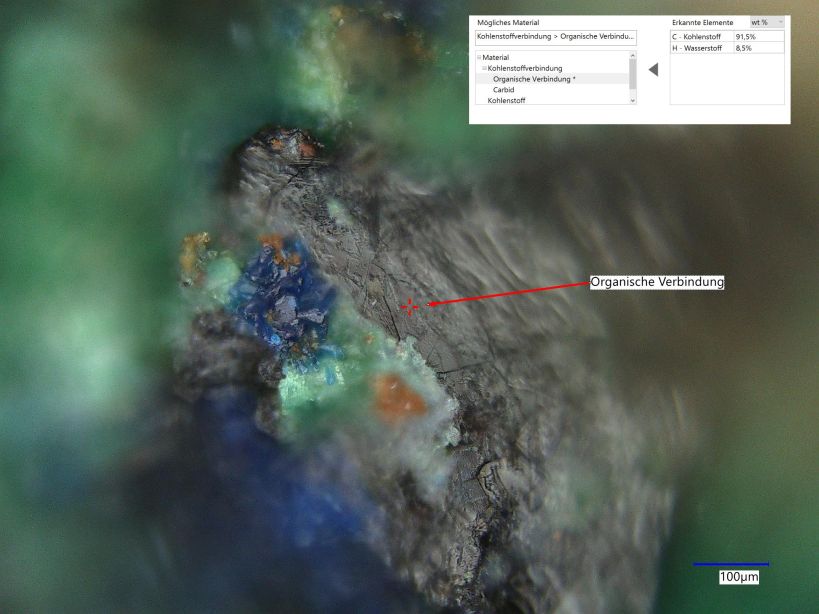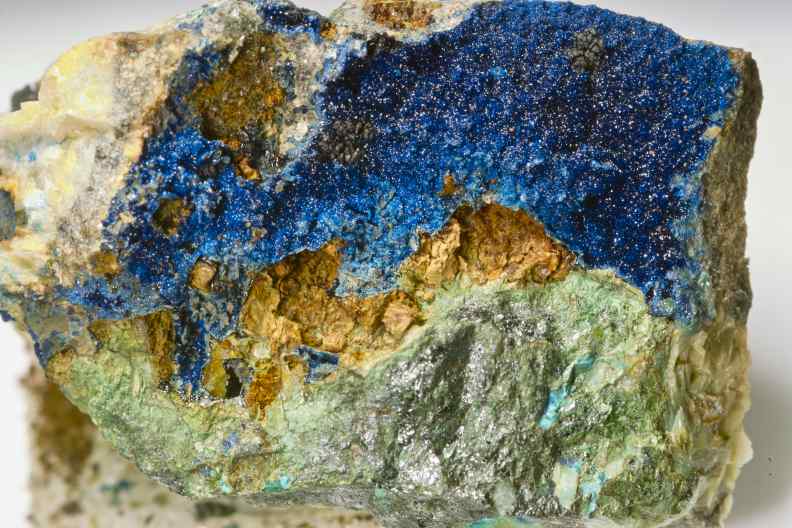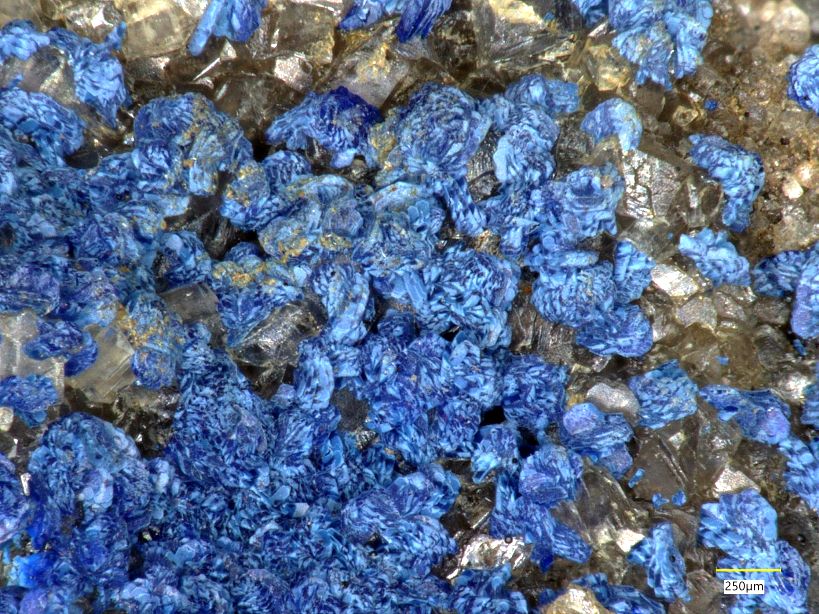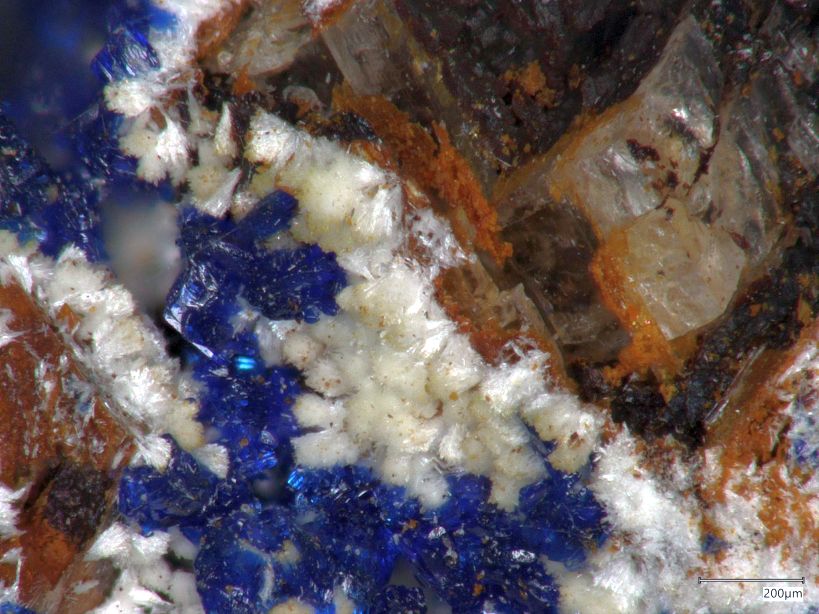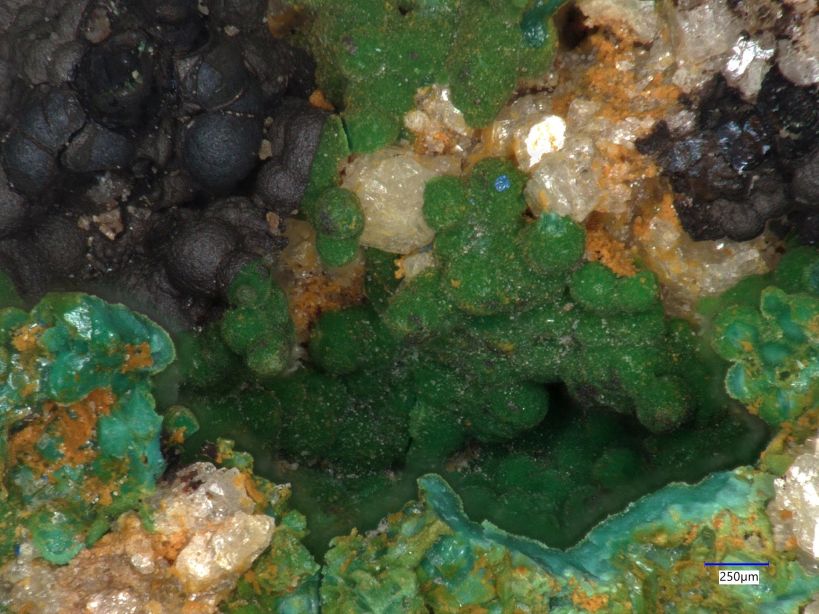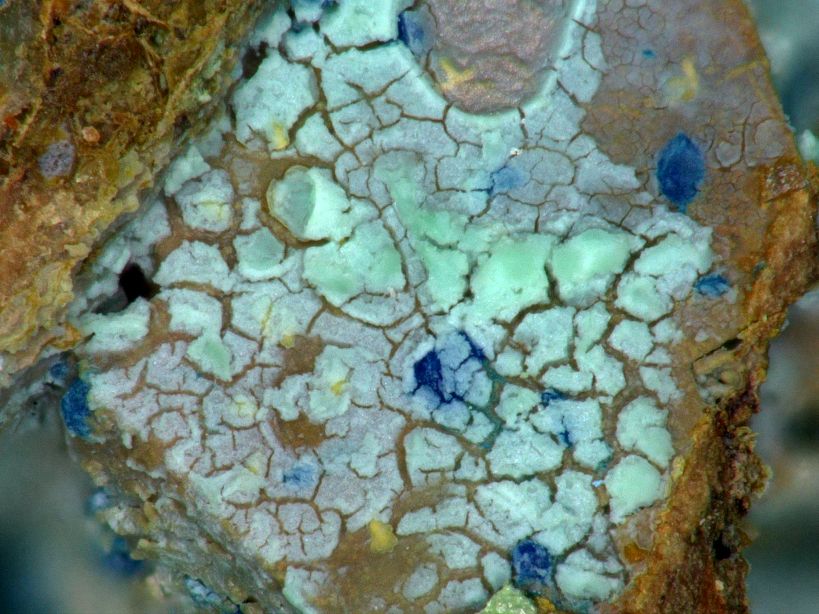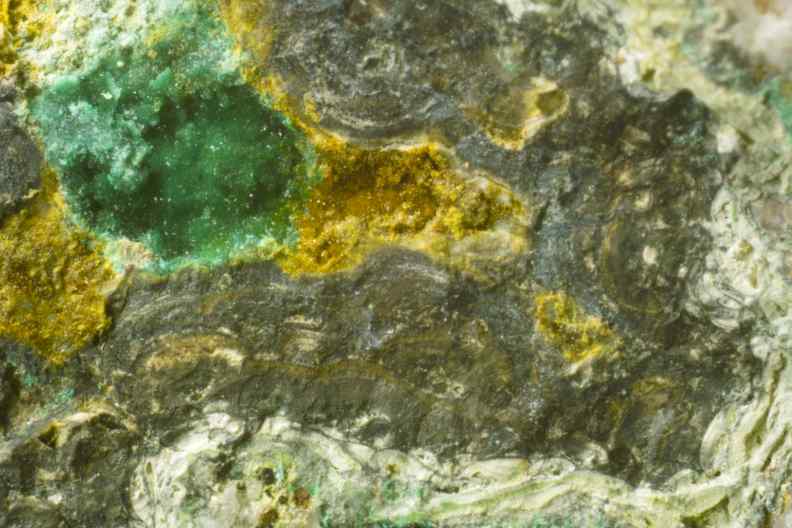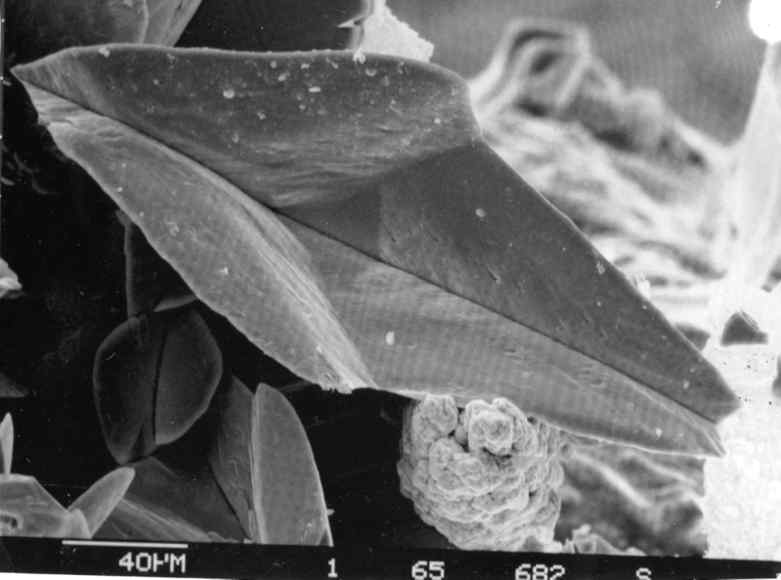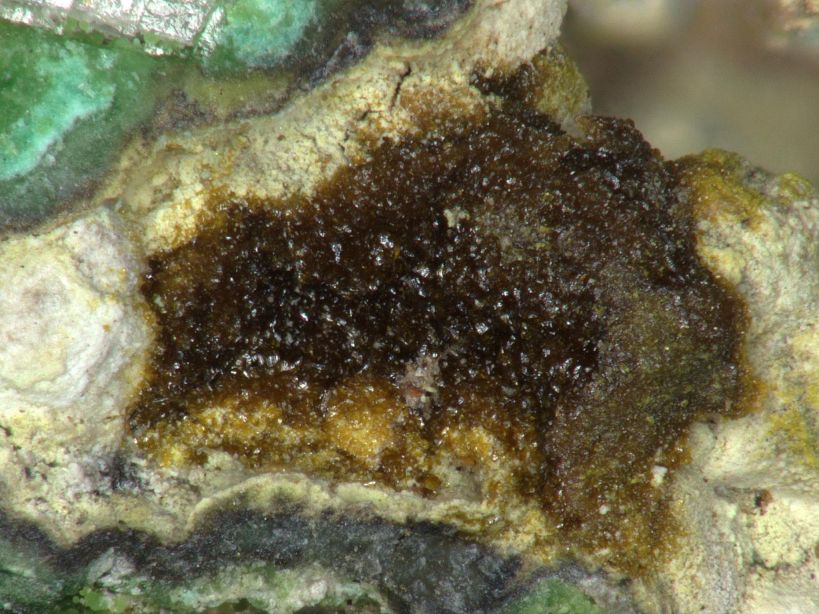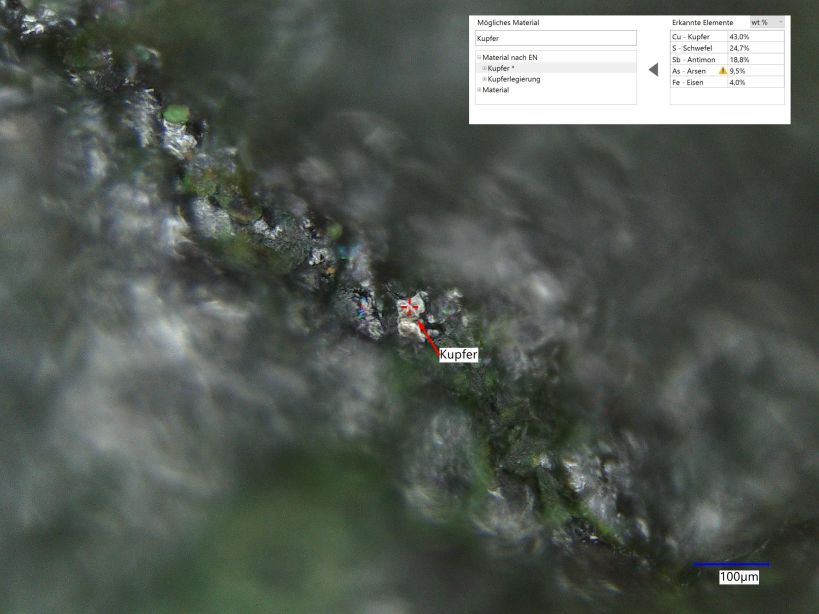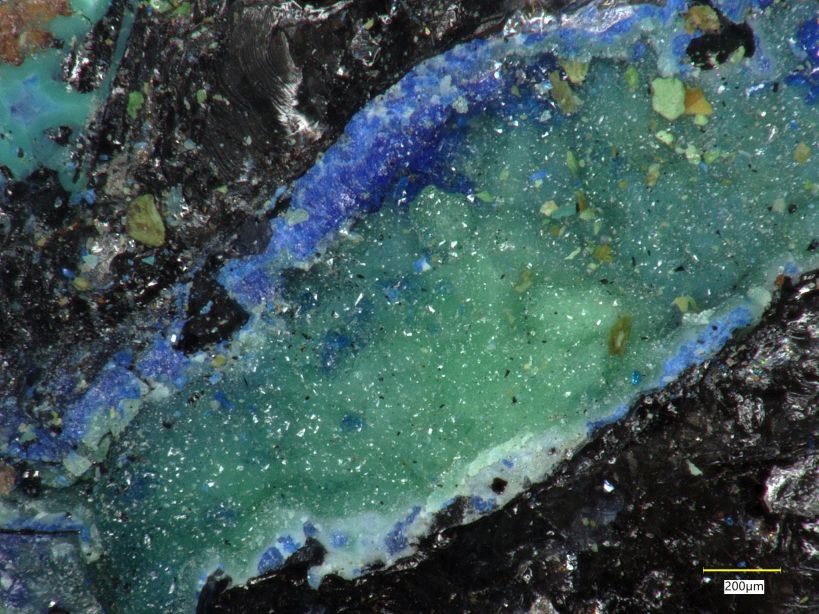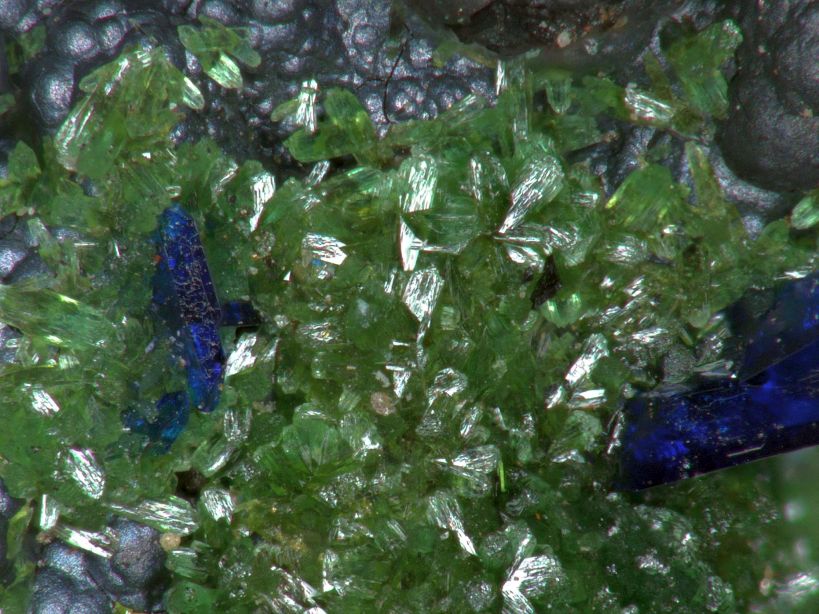Mineralien
aus Altenmittlau -
bunt und formenreich
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Links: Aus dem Steinbruch in Altenmittlau
stammen sicher die schönsten Azurit-Kristalle in Deutschland:
Hier ein ca. 2 cm großes Aggregat aus blauem Azurit, partiell
in
grünem Malachit umgewandelt (Pseudomorphose). Das
Kristallaggregat hing an der Decke einer flachen Druse!
Rechts: Meißelförmige, tielblaue und hochglänzende
Azurit-Kristalle auf einem Dolomit, der von grünem Konichalcit
überkrustet ist,
Bildbreite 7 mm.
Die farbenfrohen Mineralien sind unter Mineraliensammlern berühmt
und so war der Steinbruch oft das Exkursionsziel. Das häufigste
Mineral auf den Carbonaten ist Azurit und dann Malachit; Azurit
kommt in großer Vielfalt vor. Die Gesamtzahl der Mineralien dürfte
indes nur bei etwa 25 liegen. Die Bestimmung insbesondere der
grünen, gelbgrünen und gelben Phasen erweist sich als sehr
schwierig, da Mischkristallbildungen verbreitet sind. So können
die Farbe und die Form nur beschränkte Hinweise geben. Auch bei
den Carbonaten ist das schwer, denn neben Dolomit kommt auch
Ankerit und selten Calcit vor. Besonders schwierig sind die
krustenförmigen, grünen Mineralien zu bestimmen. Die Bilder sollen
hier nur einen Hinweis geben. Die meisten der abgebildeten Stücke
sind einwandfrei bestimmt worden.
Anglesit
Pb[SO]4
Das Sulfat soll in kleinen Kristallen neben Galenit
gefunden worden sein (BOSSE & BLEUEL 1988). Das Mineral wurde
von SCHMITT (1991) als fraglich bewertet. Infolge des hohen
Carbonatdargebotes aus dem ungebenden Gestein mit Ankerit-Dolomit
erschien es auch sehr unwahrscheinlich, dass hier ein Sulfat
gebildet wurde. Eigene Nachweise lagen bisher nicht vor. Aber
inzwischen konnten weiße Nadelbüschel als Anglesit identifiziert
werden, so dass das Vorkommen als gesichert gilt, aber der
Anglesit ist sicher im Umfeld von zersetzten Galenit-Kristallen
häufiger als bisher vermutet.

Weiße, nadelige Anglesit-Büschel auf Dolomit und
neben Tenorit,
Bildbreite 1,5 mm.
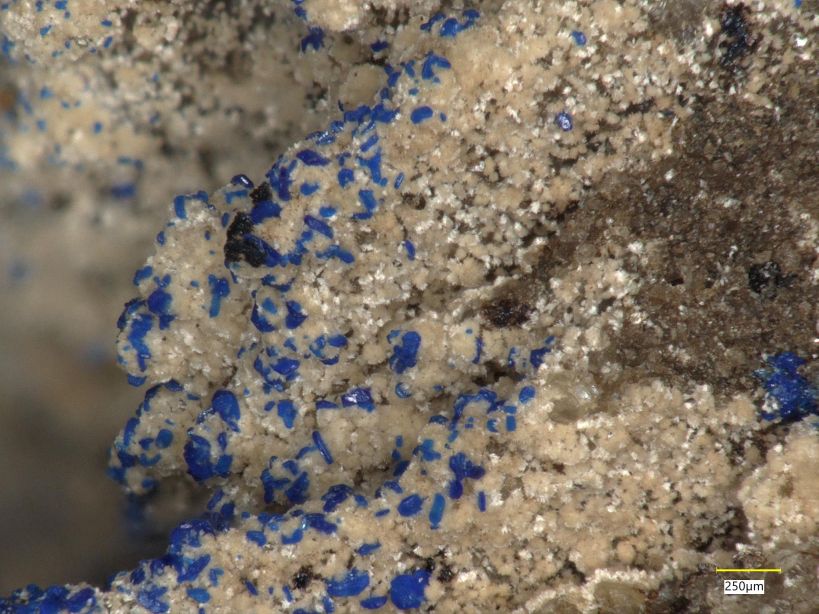
Feinnadeliger Anglesit, überwachsen von einzelnen
Azurit-Kristallen. Slg. ZELLMANN;
Bildbreite 3 mm.
Es ist wohl so, dass die grauen Massen im direkten Kontakt zum
noch frischen Galenit aus Anglesit bestehen, während die äußeren
Hüllen dann Cerrusit sind. Das ist damit erklärbar, dass der
Schwefel aus dem Galenit zunächst ein Sulfat bildet, wärend die
Übermacht des Calciums aus dem umgebenden Dolomit zur Bildung von
Cerrusit führt. Visuell ist das nicht erkennbar.
Ankerit
Ca(Fe2+,Mg,Mn)[CO3]2
Die Mehrzahl der Drusen innerhalb des Dolomits ist mit einem
Mischkristall der Carbonat-Reihe ausgekleidet. Die Mehrzahl der
dunklen, oft angewitterten, spaltrhomboedrischen Kristalle
erreicht kaum 3 mm an Größe.

Sattelförmig verkrümmte, hellbraune
Ankerit-Kristalle mit einem Überzug aus Azurit
und Manganoxiden,
Bildbreite 12 cm
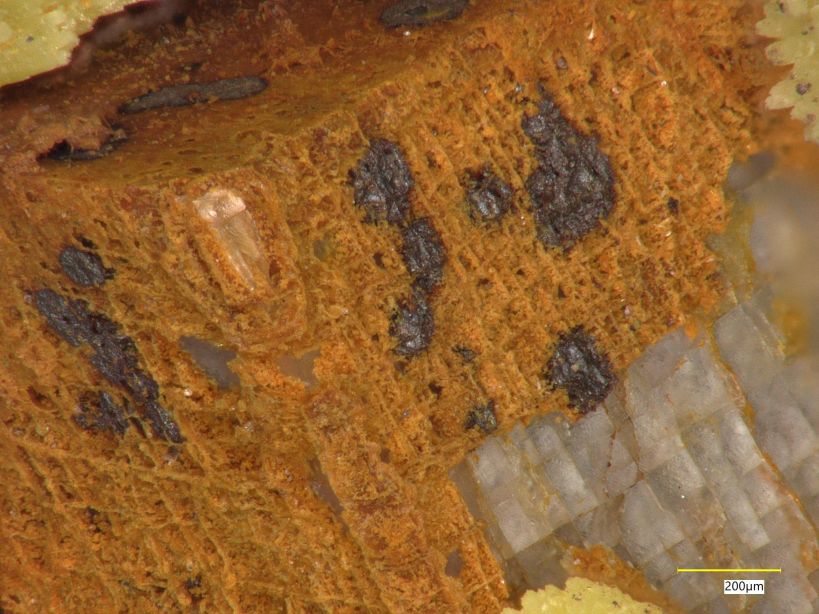
Angewitterter Ankerit, bei dem das ausgewitterte Eisenhydroxid
gitterförmig auf den
Spaltrissen auskistallisiert;
Bildbreite 1,5 mm.
Aragonit
Ca[CO3]
Als rezente, tropfsteinartigen Bildungen innerhalb des Dolomits
aus den oberen Teilen konnte Aragonit nachgewiesen werden. Auch 3
mm große Kristalle konnten von BOSSE & BLEUEL (1988)
nachgewiesen werden. Es handelt sich um farblose Nadeln, die auf
einem Mischkristall zwischen Ankerit und Dolomit aufgewachsen
sind. Es sind sicher sehr junge Kristalle. Der Unterschied zum
Calcit kann bei hoher Vergrößerung in der fehlenden Spaltbarbeit
und der chemischen Zusammensetzung (Unterscheidung gegenüber den
Sulfaten) erkannt werden.
Eigene Bestätigungen liegen inzwischen vor, so dass meine Skepsis
verflogen ist.

Farblose Aragonit-Nadeln in einer dünnen Kluft im
sehr porösen Ankerit-Dolomit mit
schwarzem Mangan-Oxid aus der Sammlung von Reinhold FRANZ(†),
Obernau;
Bildbreite 3 mm.
Asphalt als Kohlenwasserstoff
Auch wenn es nach heutiger Auffassung kein Mineral im eigentlichen
Sinne ist, wird es hier beschrieben, denn man kann den schwarzen
Asphalt sehr leicht mit den ebenfalls schwarzen Manganomelanen
verwechseln. Asphalt war bisher nicht aus Altenmittlau beschrieben
worden. Der Asphalt ist rissig und bricht muschelig. Dies derben,
muschelig brechenden und rissigen Massen werden bis zu 5 mm groß.
Man kann sich die Bildung so vorstellen, dass die Fluide, die die
Metalle aus dem Kupferschiefer mobilisierten, auch
Kohlenwasserstoff gelöst und in die Hohlräume transportiert haben.
Ähnliches kennt man beispielweise von den Drusen im Steinbruch
Juchem bei Niederwörresbach.
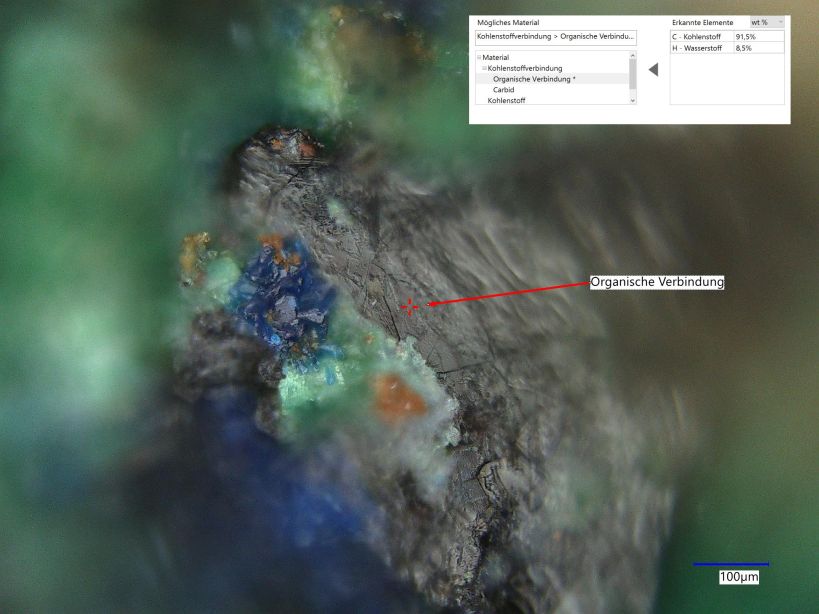
Schwarzer, muschelig brechender und rissiger
Asphalt neben Azurit,
Bildbreite 1 mm.
Azurit Cu3[OH|CO3]2
Das auffallenste und berühmteste Mineral kommt hier innerhalb von
Klüften als dünner kristalliner wie auch erdiger Beläge vor. In
Drusen können einzelne Kristalle bis zu 1 cm Größe, kugelige
Aggregate aus einzelnen Kristallen auch 4 cm Größe erreichen.
Aggregate aus oft wirr angeordneten Kristallen erreichen bis zu
6,5 cm.
Die Farbe der kleinen Kristalle ist oft hellblau, größere
Kristalle sind meist viel dunkler und können bei kugeligen
Aggregaten auch fast schwarz erscheinen. Der Azurit wird oft von
weiteren Mineralien wie Konichalcit
begleitet. Pseudomorphosen durch Malachit
sind stellenweise verbreitet.
|

Nadelige Azurit-Kristalle, dazu ein schwarzes Manganoxid
auf Dolomit; gefunden 1974;
Bildbreite ca. 2 cm.
|

Meißelförmige Azurit-Kristalle mit einem schwarzen
Manganomelanen;
Bildbreite ca. 1 cm.
|

Kugeliges, schwarzblauen Azurit-Aggregat auf rissigem
Dolomit; an der glänzenden Oberfläche erkennt man den
rhomboedrischen Querschnitt der am Aufbau beteiligten
Kristalle;
Bildbreite 2 cm.
|
|

Hellbrauner Ankerit mit weißem Quarz als "Kern" für ein
größeres Azurit-Aggregat;
Bildbreite 2 cm.
|

Ein Rasen aus kleinen, blauen Azurit-Kristallen auf
rhomboedrischen Dolomit-Kristallen;
Bildbreite ca. 1 cm. |
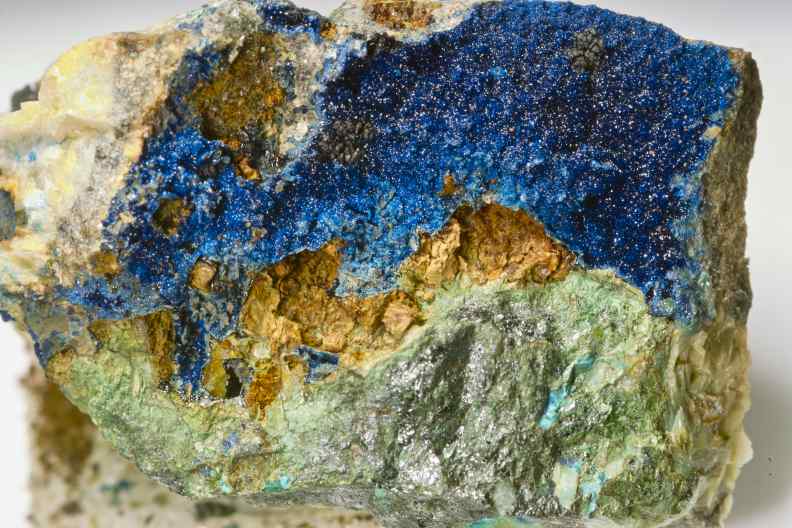
Azurit als blaue Kruste neben und auf Malachit, aus
Tennantit hervorgegangen. Der silbrige Tennantit ist
rechts der Bildmitte unten sichtbar;
Bildbreite 2 cm.
|

Schwarzblauer, stark glänzender Azurit als keilförmige
Kristalle mit sehr hellem Dolomit;
Bildbreite 3 cm.
|

Hellblaue Azurit-Ringe auf einer Schichtfläche im Dolomit,
gefunden 1996;
Bildbreite 3 cm. |

Kleiner Azurit-Kristall in einer Druse im Dolomit, gefunden
1977;
Bildbreite 5 mm.
|

Dünne Kruste aus hellblauen Azurit-Kristallen auf
alterierten Dolomit- bzw. Ankerit-Kristallen, Slg. HAPPEL,
Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm.
|

Typisch für Altenmittlau: Kavernöse Azurit-Kristalle, bei
denen bei der Kristallisation noch glaskopfartige
Manganoxide vorhanden waren, die später abfielen, so dass
der Eindruck der rundlichnegativen Formen entsteht, gefunden
1985;
Bildbreite 3,5 cm. |

Hell- bis dunkelblaue Azurit-Kristallaggregat mit
radialstrahligem Aufbau mit einem helleren Kern, Slg. Heinz
HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm.
|

Meißelförmige, tiefblaue und längsgeriefte Azurit-Kristalle,
Slg. HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 3 cm.
|

Leicht stumpfe, blaue Azurit-Kristalle mit Dolomit als
Zersetzungsprodukt von Chalkopyrit, Slg. HAPPEL,
Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm. |

Tiefblaue Azurit-Kristalle als radial angeordnete
Kristallgruppen auf hellbraunem Dolomit, Slg. HAPPEL,
Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm.
|

Kugelig-rundliche, blauschwarze Azurit-Gebilde auf Dolomit,
Slg. HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 4 cm.
|

Hohlraum einer ehemaligen Muschel (oder eines Brachiopoden),
ausgekleidet von Dolomit und darauf die
Azurit-Kristallaggregate, Slg. HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 5 cm. |

Malachit- und Azurit-Kristalle, teils überkrustet von weißem
Calcit auf derbem Chalkopyrit mit angewittertem Ankerit,
Slg. HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 4 cm.
|
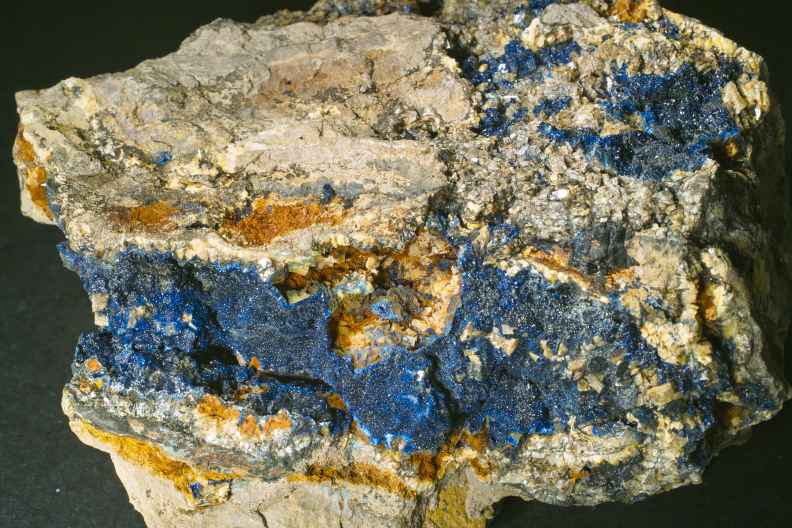
Kleine, tiefblaue Azurit-Kristalle als dichter Kristallrasen
auf Dolomit. Das Stück stammt wegen der rissigen
Verwitterung aus den oberen Bereichen des Steinbruchs;
Bildbreite 10 cm.
|
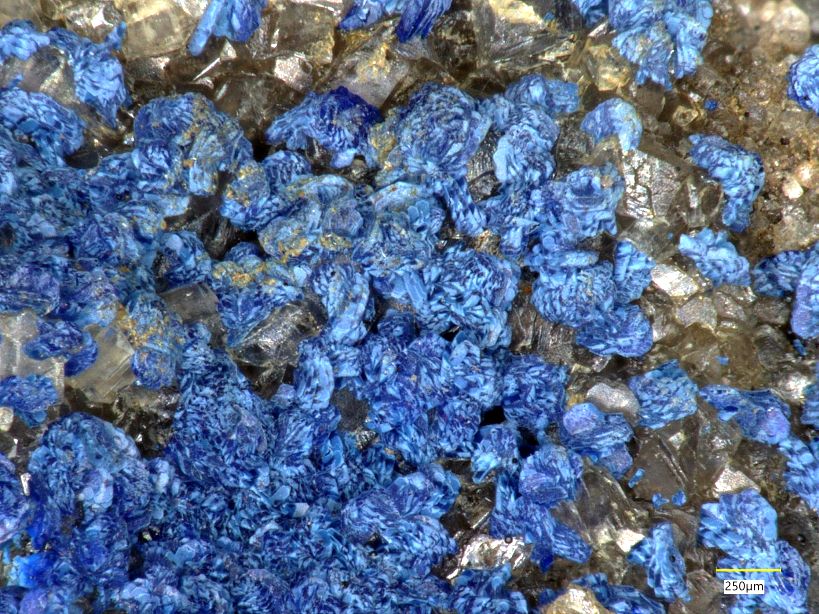
An der Oberfläche hellblauer Azurit in kleinen
Kristallaggregaten auf Dolomit aus der Sammlung ZELLMANN;
Bildbreite 3 mm. |

Tiefblaue Azurit-Kristalle auf einer grünen,
kleinkistallinen Kruste aus Bayldonit. Ehemals Sammlung
Werner STROBEL (*09.03.1946 †22.03.2021), Wörth;
Bildbreite 1,5 mm.
|

Dünne, blaue Azurit-Kristallrasen auf einem leicht
oxidierten Ankerit. Der Azurit stammt aus den vielen,
kleinen Tennantit-Kristallen, die völlig zu einem braunen
Mulm verwittert sind. Das außergewöhnlich große, abgesägte
Stück stammt aus der ehemaligen Sammlung von Familie
BRENNER;
Bildbreite 18 cm.
|
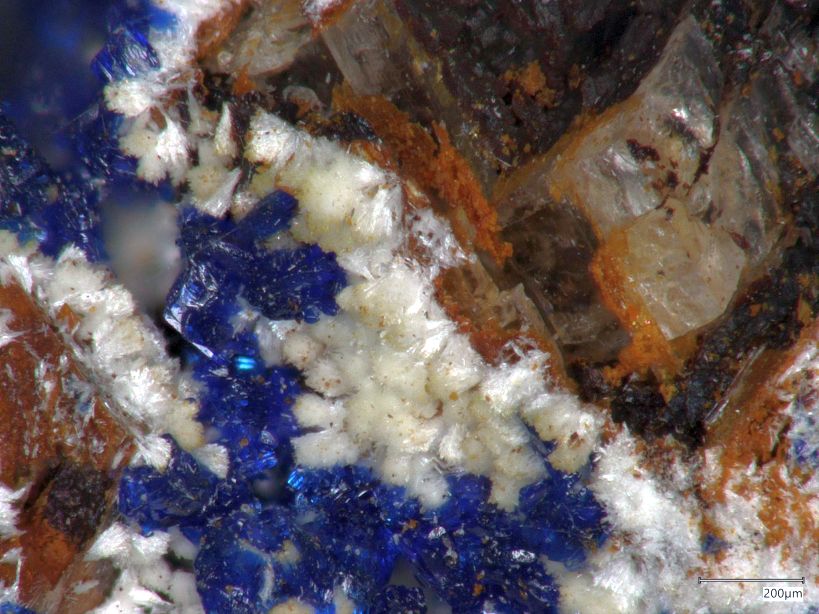
Grünlich-weiße Olivenit-Nadelbüschel mit tiefblauem Azurit
auf hellbraunen Dolomit-Kristallen aus der Sammlung von
Werner STROBEL;
Bildbreite 1,5 mm.
|

Azurit, partiell in Malachit pseudomorphisiert. Das
Kristallaggregat hing einst an der Decke einer Druse, so
dass sich ein Wassertropfen hier bilden konnte, der die
Umwandlung förderte. Ehemals Sammlung von Jürgen
BREITENBACH(†);
Bildbreite 10 mm.
|
Baryt Ba[SO4]
Das sonst sehr verbreitete Mineral im Spessart ist hier sehr
selten. Wie jedoch die Spuren in den Drusen zeigen, war es einst
in vielen Drusen als dünne Tafeln vorhanden. In wenigen Fällen
konnte weißer Baryt als Relikte gefunden werden.

In den Zwischenräumen ehemaliger Baryt-Tafeln
kristallisierten tiefblaue Azurit-
Kristalle,
Bildbreite 2 cm
Bayldonit PbCu3[OH|AsO4]2
Bayldonit wurde von Gunther ZIMMERMANN nachgewiesen; eigene
Bestimmungen oder Nachweise waren bisher nicht vorhanden. Die
Ansprache der vielen grünen Krusten ist ohne weitergehende
Untersuchungen nicht sicher möglich. Das hier ist das typische
Beispiel, denn ohne chemische Analyse würde man nicht zu dem
Mineral Bayldonit gelangen.
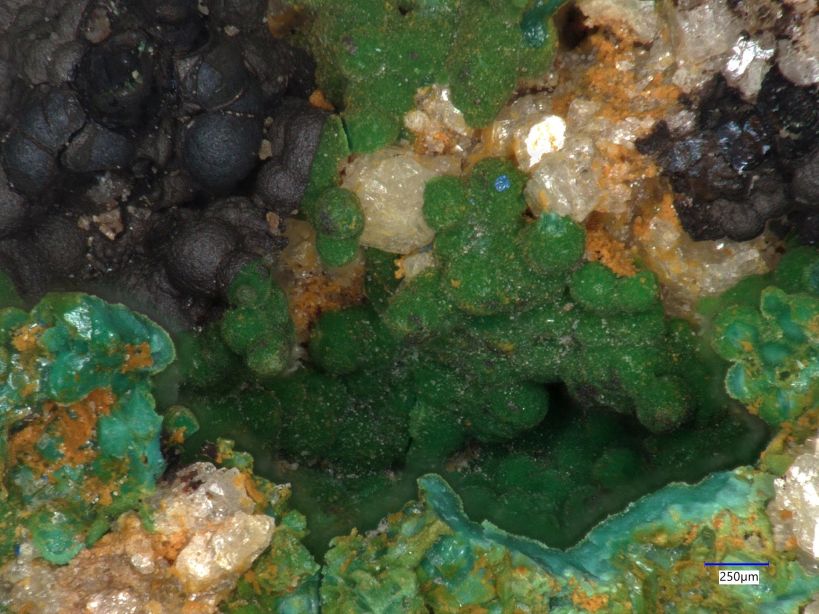
Grüne Bayldonit-Krusten auf Dolomit; daneben
schwarze Aggergate eines
Manganomelans;
Bildbreite 3 mm.
Brochantit Cu4[(OH)6|SO4]
Brochantit soll nachgeweisen worden sein; eigene Bestimmungen oder
Nachweise sind nicht vorhanden. Das Vorkommen eines Sulfates wäre
sehr ungewöhnlich.
Beudantit PbFe33+[(OH)6|SO4|AsO4]
Beudantit sollte nachgeweisen sein (LORENZ 2010:389 mit dem Bezug
auf SCHMITT); eigene Bestimmungen oder Nachweise waren bisher
nicht vorhanden. Nun konnten tatsächlich Beudantit sicher
nachgewiesen werden:

Grüne Beudantit-Pusteln neben blauem Azurit und
schwarzes Manganoxid,
Bildbreite 3 mm.
Bornit Cu5FeS4
Bei der Analyse von Chalkopyrit konnt auch Bornit nachgewiesen
werden.
Calcit Ca[CO3]
Farblose, skalenoedrische und glänzende Calcit-Kristalle sind sehr
selten in den tiefen Dolomiten. Undeutliche spaltrhomboederförmige
Calcit-Kristalle finden sich stellenweise reichlich als
Auskleidung der Drusen in den höheren Dolomit-Schichten. Die
Kristalle können angelöst und nicht glänzend 1,5 cm erreichen.
Drusen wurden in einer Größe bis zu 25 cm gefunden. Der Boden der
Drusen ist deutlich anders und immer dunkler ausgebildet.

Weißer Calcit mit den Hohlräumen von ehemaligen
Manganoxiden als Hohlraumfüllung
im Dolomit, gefunden 1975.
Bildbreite 12 cm

Schmutzigweiße, skalenoedrische Calcit-Kristalle
im Dolomit, gefunden 1980
Bildbreite 11 cm

Schneeweißer Calcit in einer Druse mit Ankerit im
Dolomit,
Bildbreite 5 cm
Cerrusit
Pb[CO3]
Farbloser Cerrusit findet sich weit verbreitet in der Nähe von Galenit als bis zu 10 mm große Kristalle.
Zahlreiche Pseudomorphosen von Cerrusit nach Galenit wurden in den
Drusen gefunden. Zwillinge und sehr selten auch Drillinge werden
beobachtet. Die Kristallformen sind sehr vielfältig.


Cerrusit nach Galenit, teils als farblose
Kristalle
Bildbreiten 1,5 cm und 1 cm

Schwertförmiger Cerrusit-Kristall,
Bildbreite 10 mm

Radialstrahlieg Cerrusit-Aggregate ("Sonnen") mit
etwas blauem Azurit und braunem
Goethit auf Dolomit, gefunden 1977.
Bildbreite 2 cm

Verzwillingter Cerrusit-Kristall auf Dolomit,
Bildbreite 5 mm

Cerrusit-Kristalle auf Dolomit, rechts der große
Kristall ist ein Drilling (Achtung: diese
Form kann leicht mit Quarz versechselt werden!). Die Drillinge
haben keine Spitze auf
der Pyramide, sondern eine kleine Basis, Slg. HAPPEL,
Mainaschaff,
Bildbreite 3 cm
Chalkopyrit
CuFeS2
Verwitterte Kristalle von Chalkopyrit konnten in bis zu 1 cm Größe
gefunden werden. Sie enthalten teilweise noch einen unzersetzten
Kern.

Goldgelbe Einschlüsse von Chalkopryit und
silbrigem Galenit in grauem Tennantit auf
Dolomit,
Bildbreite 5 mm

Das größte mir bekannte, wenn auch stark
alterierte, Stück Chalkopyrit, z. T. mit Azurit
und Malachit überwachsen,
Bildbreite 4 cm
Chrysokoll
(Cu,Al)2H2[(OH)4/Si2O5]·nH2O
Das amorphe Mineral wurde selten als Verwitterungsbildung auf Dolomit gefunden.
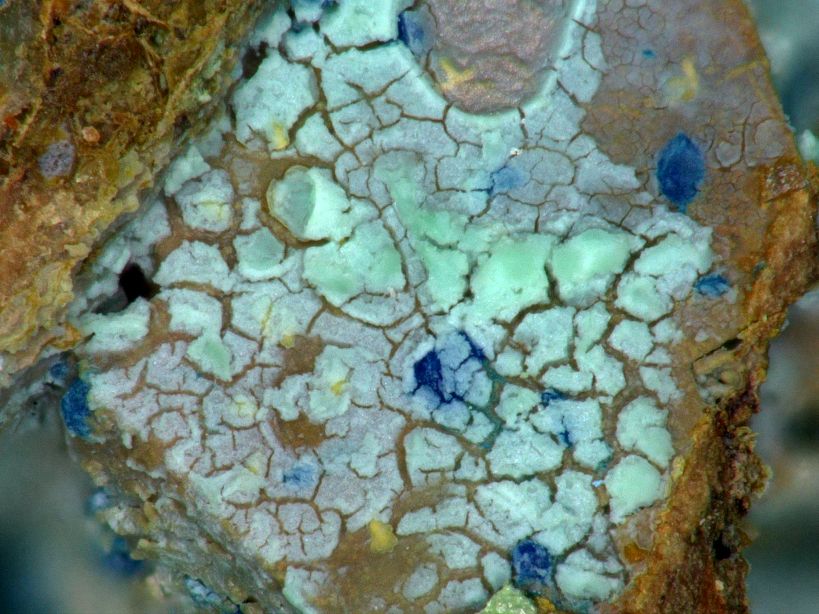
Rissiger Chrysokoll mit blauem Azurit als dünne,
rissige Schicht auf zersetzem Tetrahedrit;
Bildbreite 1,5 mm.
Crednerit Cu(Mn,Fe)3+O2
In den Zechstein-Gesteinen von Altenmittlau treten in allen
Horizonten verbreitet tiefschwarze Manganoxide auf. Sie sind
sowohl auf Klüften als auch in den Drusenhohlräumen weit
verbreitet und bei den Mineraliensammlern nicht beliebt. Chemische
Analysen weisen in einzelnen Fällen örtlich sehr hohe
Konzentrationen aus Kupfer aus, die der chemischen Zusammensetzung
des Crednerits entsprechen, so dass man begründet vermuten kann,
dass es das Mineral hier gibt; dazu noch Spuren von Co. Dies auch
deshalb, weil sich auch unter dem Mikroskop keine eigenständigen
Kupfermineralien erkennen lassen. Eine röntgenographische
Bestätigung liegt bisher nicht vor.

Schwarzer Crednerit neben grünem Malachit;
Bildbreite 3 mm.
Cuprit Cu2O
Kleine Pseudomorphosen von Malachit, aber
auch Chrysokoll und Goethit nach oktaedrischen Cuprit-Kristallen
konnten in den Dolomit-Drusen beobachtet werden. Auch frischer
Cuprit wurde selten im Dolomit gefunden (BLEUEL 1985). Cuprit
bildet sich aus den Sulfiden und kommt zusammen mit Malachit und
Azurit vor.


Links: Metallisch rot metallisch glänzende
Einschlüsse von Cuprit in Malachit,
Bildbreite 2 cm.
Rechts: Metallisch glänzender Cuprit,
Bildbreite 3 mm.
Cuproadamin
(Cu,Zn)2[OH|AsO4]
KOHORST (1999) berichtet über den Nachweis von Cuproadamin aus dem
Steinbruch. Die bis zu 1 mm großen, kugeligen Aggregate sitzen
neben Tennantit und Malachit in einer Druse im Dolomit. Dabei ließ
sich nicht klären, ob wirklich ein Zn-haltiger Cuproadamin oder
ein Zn-Olivenit vorliegt, da die Menge des Materials nicht für
eine Röntgendiffraktometrie ausreichte. Nach weiteren Analysen -
siehe Zinkolivenit.
Dolomit
CaMg[CO3]2
Es handelt sich sicher um das häufigste Mineral innerhalb des
Bruches. Fast alle Klüfte und Drusen sind damit ausgefüllt. Die
Abgrenzung zum Ankerit ist im Handstück problematisch. Die
Dolomit-Kristalle sind meist stark glänzend und erreichen bis zu 5
mm Größe. Sie sind selten fast farblos, meist jedoch gelblich bis
braun gefärbt. Besonders die größeren Kristalle sind sattelförmig
gekrümmt.


Links: Sattelförmig gekrümmte, hellbraune
Dolomit-Kristalle, gefunden 1984,
Bildbreite 5 cm
Rechts: Dolomit-Rhomboeder, der oberflächlich angelöst ist;
Bildbreite 2 mm.

Der überaus größte Teil des Dolomit tritt in
körniger Form
gesteinsbildend auf.
aufgenommen am 24.04.1977
Duftit PbCu2+[OH|AsO4]
Duftit kommt als dünne Krusten auf Dolomit vor. Das grüne Mineral
bildet dünne Krusten oder kleine Kristalle die immer in Verbindung
mit Manganomelanen vorkommen (BOSSE & BLEUEL 1988). Die
grünen Massen auf Dolomit sind schwer von den anderen grünen
Mineralien zu unterscheiden.

Duftit-Rasen auf Dolomit
Bildbreite 7 mm
Duftit-beta PbCu2+[OH|AsO4]
Beta-Duftit (oder auch Beta-Duftit) kommt als dünne, glünzende
Krusten auf Dolomit/Ankerit vor. Das grüne Mineral wurde von
Gunther ZIMMERMANN bestimmt. Eigenfunde liegen nicht vor.

Beta-Duftit-Rasen mit Manganomelan auf Dolomit
Bildbreite 3 mm

Beta-Duftit als kleinkristalliner Rasen auf
rhomboedrischen Dolomit-Kristallen aus der
ehemaligen Sammlung von Jürgen BREITENBACH(†);
Bildbreite 3 mm.
Fornacit (Pb,Cu2+)3[(Cr,As)O4]2(OH)
Fornacit wurde nach einer EDX von Gunter Zimmermann aus Frankfurt
bestimmt. Eine eigene Bestätigung inzwischen an 3 Proben erbracht
werden, auch wenn das Vorkommen wegen des zur Bildung notwendigen
Chroms sehr merkwürdig ist. Es handelt sich um um braune, stark
glänzende Kristalle.
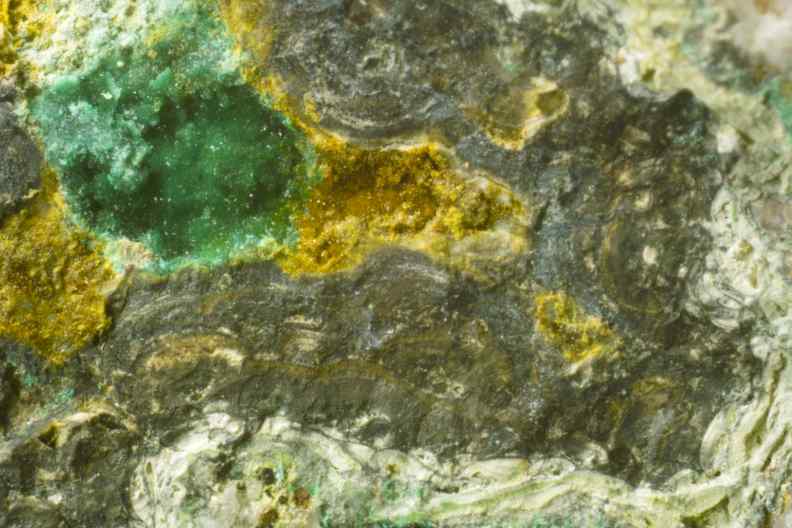
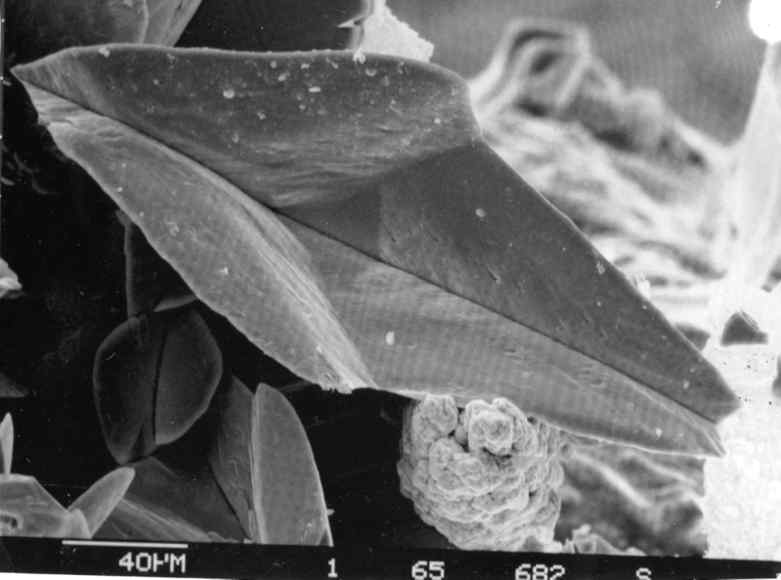
Links: Visuell bestimmte Fornacit-Krusten im
gebänderten Cerrusit,
Bildbreite 5 mm (ex Sammlung G. Zimmermann)
Rechts ein REM-Foto mit einem verzwillingten Kristall,
Bildbreite 0,25 mm (Foto G. Zimmermann, Frankfurt).
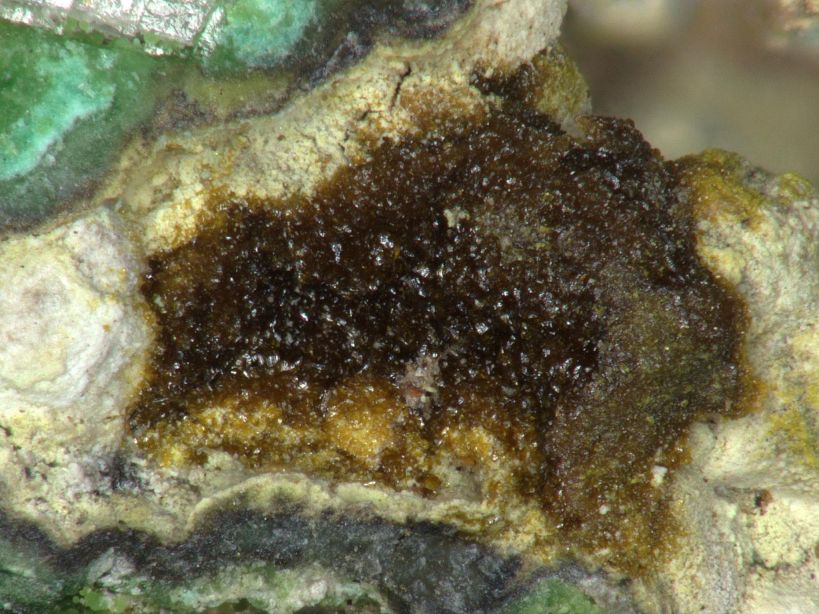
Braune, hochglänzende Fornacit-Kristalle neben
einem zersetzen Galenit,
Bildbreite 1,5 mm
Galenit PbS
Bis zu 3 cm große, oberflächlich angewitterte Würfel kommen in den
Drusen des Dolomits, insbesondere in den dünn gebankten Lagen vor.
Die oberflächlich immer in Cerrusit umgewandelten Kristalle zeigen
deshalb einen grauen Schimmer. Kombinationen mit dem Oktaeder sind
selten. Komplette Pseudomorphosen mit Cerrusit
und Mimetesit sind sehr häufig. Auch sitzen an den Stellen, wo
sich Galenit-Kristalle fanden, oft ganze Gruppen von Cerrusit.


Links: In einer dünnen Kluft wurden die
Zwischenräume um die Dolomit-Kristalle mit Galenit gefüllt, Fund
von 1974;
Bildbreite ca. 7 cm.
Rechts:
Frische Spaltfläche eines Galenits;
Bildbreite 3 mm.

Würfelige Galenit-Kristalle mit einem dünnen
Überzug aus Cerrusit, gefunden 1994.
Bildbreite 2 cm

Zwei verwachsene kuboktaedrisch kristallisierte
Galenit-Kristalle auf Dolomit,
überkrustet von Cerrusit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff,
Bildbreite 6 cm.

Dünne Kluftfüllung aus Galenit im Dolomit ohne
weitere Mineralien, aus der Slg.
F. BEISSLER, Glattbach,
Bildbreite 5 cm
Der Galenit enthält einige Gew.-% Silber. Dies war einst das Ziel
eines Bergbaues auf den Kupferschiefer, aus dem besonders in
Bieber, wo neben dem Kupfer, das Blei und auch die Spuren von
Silber gewonnen wurden. Das ebenfalls vorhandene Zink war nicht
bekannt und wurde auch nicht gewonnen.
Gartrellit PbCuFe[H2O|OH|(AsO4)2]
Bei der Untersuchung von grünen Krusten wurde diese Kruste (siehe
Foto unten) als Gartrellit erkannt. Sie sind bei hoher
Vergrößerung als "wurmförmige" Massen auflösbar. Diese überkrusten
die rhomboedrischen Dolomit-Kristalle und sie werden von
einzelnen, kleinen
Azurit-Kristallen überwachsen. In den Kristallen ließ sich
kein Zn nachweisen.
Die zeigt einmal mehr, dass eine visuelle Ansprache der
vielfältigen grünen Krusten in der Lagerstätte im
Zechstein-Dolomit von Altenmittlau ohne analytische Stützung nicht
zu einer Bestimmung führen kann. Es ist sogar noch komplexer, denn
manche dieser Krusten sind noch zoniert, so dass man mehrere
Analysen ausführen muss. Und wenn man ganz sicher gehen will, dann
ist die visuell-chemische Bestimmung noch durch eine
Röntgendiffraktion zu bestätigen.

Dunkelgrüner Gartellit als dünner, kristalliner
Belag auf rhomboedrischen Dolomit-
Kristallen aus der ehemaligen Sammlung von Jürgen BREITENBACH(†);
Bildbreite 3 mm.
Hedyphan Pb3Ca2[Cl|(AsO4)3]
Gelbe Kristallaggregate und gelbe Beläge in der Umgebung von
Galenit erwiesen sich auch als Hedyphan. Das Mineral ist visuell
kaum vom sehr ähnlich aussehenden Mimetesit zu unterscheiden.

Gelber Hedyphan als Zwickelfüllung in der Druse im
Dolomit,
Bildbreite 3 cm
ged.
Kupfer Cu
Wurden als kleine Bäumchen, teils in Malachit
umgewandelt, im Kupferletten gefunden (BLEUEL 1985). Solche
"Bäumchen" konnten bisher nicht bestätigt werden.
Kupfer-Arsenat (röntgtenamorph)
Die wenigen und zerstreuten Tennanatit-Kristalle sind teilweise
oder ganz in ein grünliches röntgenamorphes Cu-Arsenat
umgewandelt. Es ist rissig und relativ weich, so dass man oft nur
noch Hüllen der einstigen Kristalle.

Röntgenamorphes, grünes Cu-Arsenat mit Resten von
silbrig glänzendem Tennantit
mit blauem Azurit;
Bildbreite 3 mm.
Goethit α-FeO(OH)
Lepidokrokit γ-FeO(OH)
Erdiger Goethit ist weit verbreitet als pulverige Drusenfüllung
wie auch als färbender Bestandteil zahlreicher Drusenuntergründe.
Pseudomorphosen nach Chalkopyrit sind
selten.
Wie an anderen Vorkommen der Zechstein-Sedimente konnten sehr
selten in den oberen Bereichen auch die typischen Konkretionen aus
Goethit gefunden werden, die in den schalig aufgebauten Innern
auch die dünnen Krusten aus hochglänzendem Lepidokrokit führen
(LORENZ 2010:295).

Erdiger bis dichter Goethit als hohle Konkretion
mit Lepidokrokit,
Bildbreite 2 cm
Kaolinit Al4[(OH)8/Si4O10]
Das Mineral wurde in Drusen als erdige und feinschuppigen, weiße
bis gelbliche Massen gefunden und ist wohl nicht so selten, wurde
aber kaum gesammelt. Die Genese ist etwas schwieriger zu erklären.
Der Kaolinit stammt aus den Tongehalten des Kupferschiefers, wo
die Fluide das Aluminium gelöst und dann wieder ausgeschieden
haben.

Feinschuppiger Kaolinit als finale Drusenfüllung
aus einer Druse mit Carbonaten,
Bildbreite 3 mm.


Links: Gelbliche Kaolinit-Kristallbüschel als finale Bildung in
einem Hohlraum auf Azurit und Dolomit. Slg. ZELLMANN;
Bildbreite 3 mm.
Rechts: Gelbliche Kaolinit-Kristalle bzw. -Kristallaggregate auf
Azurit. Ehemals Sammlung Jürgen BREITENBACH(†);
Bildbreite 1,5 mm.
Konichalcit
CaCu[OH/AsO4]
Das grüne, oft runde Kügelchen bildende Mineral unterscheidet sich
vom Malachit durch seinen glasigen Glanz mit glatten Oberflächen.
Es ist sicher häufiger als Malachit und
wird oft mit ihm verwechselt.

Glasiger Konichalcit auf Malachit,
Bildbreite 5 mm.

Glaskopfartiger Konichalcit auf Dolomit neben
Galenit (außerhalb des Bildes)
Bildbreite 5 mm.

Konichalcit als dünne Kruste und Kügelchen,
Bildbreite 3 mm
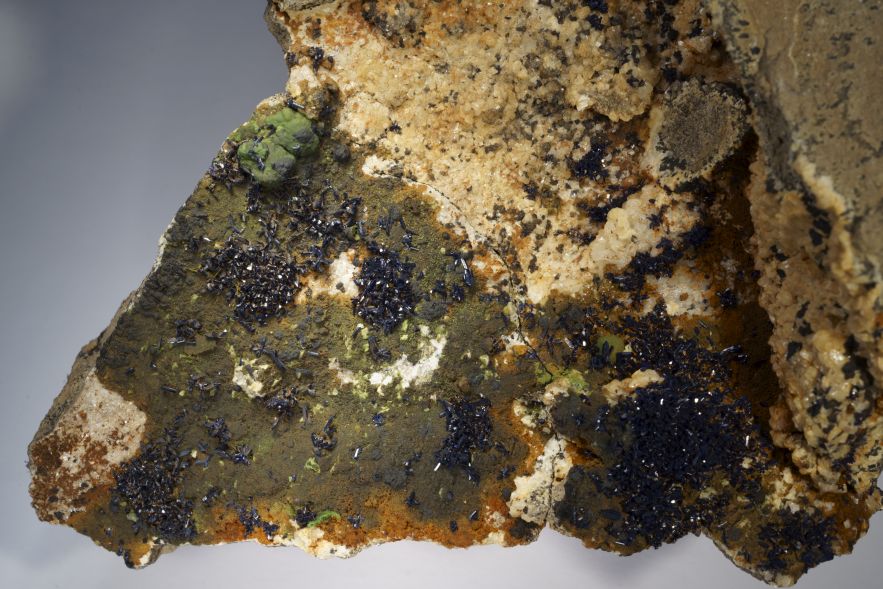

Großer Teil einer Druse im Dolomit, überkrustet mit
Konichalcit und einzelne Azurit-Kristalle (geklebt). Der dunkle
Konichalcit ist durch Manganoxid gefärbt,
ehemals Sammlung Albrecht VORBECK(†);
Bildbreite links 9 cm und rechts im Ausschnitt 3 mm.
Libethenit Cu2[OH|PO4]
Dunkelgrüne, bis zu 1 mm große, stark glänzende Kristalle auf
Konichalcit erwiesen sich nach diversen Analysen als das
Kupferphosphat Libethenit.

Libethenit-Kristalle auf Konichalcit;
Bildbreite 3 mm.
Malachit Cu2[(OH)2|CO3]
Glaskopfartige Massen von gebändertem Malachit findet sich selten
in den Drusen. Die Massen erreichen Größen von bis zu 3 cm.

Partielle Pseudomorphose von grünem Malachit nach blauem
Azurit auf hellbraunem Dolomit aus der ehemaligen Sammlung
von Jürgen BREITENBACH(†);
Bildbreite 10 mm.
|

Malachit als Pseudomorphose nach Azurit-Kristallen auf
Dolomit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm. |

Kristallbüschel aus Malachit, pseudomorph nach Azurit, Slg.
HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm.
|

Grüner Malachit als Pseudomorphose nach blauem Azurit;
Bildbreite 2 cm.
|

Kugeliger, hellgrüner Malachit mit farblosem Calcit, Slg.
HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 2 cm. |

Malachit-Kristallbüschel mit Azurit auf zersetztem
Chalkopyrit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff;
Bildbreite 3 cm.
|

Grüner Malachit, dünn von farblosem Calcit, überkrustet;
Bildbreite 2 cm.
|

Glaskopfartiger Malachit auf Dolomit;
Bildbreite 1,5 cm.
|

Weiter verbreitet sind sind bis zu 2 cm große
Teilpseudomorphosen und Pseudomorphosen von Malachit nach Azurit,
besonders an den Decken von Drusen.
|

Kugeliges Malachit-Aggregat auf dem Dolomit mit einem
Überzug aus dem röntgenamorphen Manganomelan;
Bildbreite 3 mm
|

Schalenförmiger und kugeliger, hellgrüner Malachit mit einem
"feinfaserigem" Aufbau, aufgewachsen auf kleinen
Dolomit-Kristallen, die partiell von einer dünnen Kruste aus
einem Manganoxid überkrustet ist;
Bildbreite 3 mm. |

Rundliches, stumpfes Malachit-Aggregat (innen vermutlich
radialstrahlig) auf dem Dolomit einer Druse;
Bildbreite 2 mm
|
Manganomelane
Nicht näher bestimmbare Manganomelane überziehen oft die Dolomit-Kristalle als dünner, rissiger und
glaskopfartiger Belag. Bei der Untersuchung mittels
Pulver-Röntgendiffraktion erwiesen sie sich als völlig
amorph.
Verbreitet treten auch auf den Kluftflächen hübsche Dendriten auf.
Sie erreichen Größen von bis zu einigen dm². Selten sind sie auch
direkt auf den Kristallen zu beobachten.

Breite, schwarze Dendriten auf einer Kluftfläche
im dünn gebankten Dolomit,
zusammen mit hellbraunem Goethit und etwas Azurit, gefunden
1975,
Bildbreite 9 cm
Mennige Pb22+Pb4+O4
Das Mineral wurde als pulverige Unterlage unter Cerrusit von BOSSE
& BLEUEL (1988) beschrieben. Eigene Nachweise oder Belegstücke
liegen nicht vor.
Mimetesit
Pb5[Cl|(AsO4)3]
Gelber, stahliger Mimetesit ist verbreitet in den Galenit-führenden Partien. Die
schwefelgelben bis bräunlichen, oft durchsichtigen Kristalle und
Nadelbüschel erreichen 5 cm, Beläge auch einige cm² an Größe.
Pseudomorphosen von Mimetesit nach Galenit sind weit verbreitet;
oft weist nur ein rechteckiger oder quadratischer Fleck aus Cerrusit und Mimetesit auf den ehemaligen
Galenit hin. Die Mimetesit-Büschel sitzen oft nur lose auf.

Gelber Mimetesit als Kristallgarben mit
Manganoxiden,
Bildbreite 14 mm

Pseudomorphose von gelbem Mimetesit mit einerm
Kern aus Cerrusit nach einem einst
würfeligen Galenit-Kristall,
Bildbreite 2 cm

Igeliges Mimetesit-Aggregat,
Bildbreite 1,5 mm

Grüne Mimetesit-Kristalle auf Dolomit,
Bildbreite 6 mm

Sechsseitige Mimetesit-Kristalle aus der Sammlung von Jürgen
BREITENBACH(†);
Bildbreite 3 mm.
Molybdänit MoS2
Das Mineral kommt in winzigen Spuren im Dolomit vor - eigene
Nachweise oder Analysenergebnisse liegen inzwischen vor. Das
Molybdän kann man aus dem Kupferschiefer ableiten und einmal
gebildet, ist es relativ stabil und wird von den oberflächennahen
Wässern kaum angegriffen.

Zwischen den Dolomit-Kristallen finden sich
Flecken mit metallisch gläzendem,
feinschuppigem Molybdänit;
Bildbreite 6 mm.
"Muskovit"
Das für einen Dolomit als Neubildung sicher bemerkenswerte Mineral
wurde von BOSSE & BLEUEL (1988) beschrieben. Dabei handelt es
sich sicher um den Kaolinit wie dies an anderen Fundorten im
Dolomit auch als sekundäre Bildung der Fall ist.
Olivenit Cu2[OH|AsO4]
Das ebenfalls grüne Mineral findet sich als grüne Kriställchen mit
ausgefaserten Spitzen und Beläge (BOSSE & BLEUEL 1988).
Es wurde auch die Zn-haltige Variante des Olivenits über
chemische Analysen bestätigt.

Grüner Olivenit mit tiefblauem Azurit,
Bildbreite 5 mm

Feinstfaseriger Olivenit mit Überkrustungen aus
Manganoxiden und etwas Azurit,
Bildbreite 5 mm
Pyrit FeS2
Es ein Mineral, welches nahezu überall vorkommt. Aber in
Altenmittlau ist es ganz selten und nur in einem Fall bekannt.
Hier sind idiomorphe Kristalle im Galenit eingeschlossen und damit
erhalten.

Gelbe Pyrit-Kristalle im Galenit,
Bildbreite 6 mm.
Pyromorphit
Pb5[Cl|(PO4)3]
Das Mineral wurde von BOSSE & BLEUEL (1988) beschrieben. Es
handelt sich hellgrünlichgelbe Kristalle einschließlich von
Mischkristallen zu Mimetesit, die
röntgenografisch nachgewiesen wurden.
Quarz SiO2
Kleine, farblose Dihexaeder finden sich reichlich in den
schichtgebundenen, schmalen Hohlräumen der dünn gebankten Partien.
Die gar nicht so seltenen Kristalle, auf Dolomit aufgewachsen und
auch von Eisenoxiden überkrustet erreichen bis zu 5 mm Größe. Sie
sind wenn farblos nur schwer zu erkennen und werden deshalb wohl
oft übersehen.
Achtung: Es besteht Verwechselungsgefahr mit Cerrusit-Drillingen!

Farbloser Quarz-Kristall auf rhomboedrischen
Ankerit,
Bildbreite 7 mm
Jahre zurück (vermutlich um 1973) liegt ein einmaliger Fund
von großen Quarzkristallen aus den oberen Dolomiten. An einem
regenreichen Tag war eine unbedarfte Familie aus Miltenberg im
Bruch. Eine damals ca. 40jährige Frau bückte sich nach einem
weißen Stein und zog einen ca. 3 cm große Quarzspitze aus dem
Schlamm. Beim Nachsuchen konnte ich ein Stück Dolomit finden,
welcher offensichtlich aus den oberen Bereichen stammte und noch
Reste des Quarzes trug, so dass sicher war, dass das Stück auch
von hier stammte. Ich hebe nie mehr ein solches Stück gesehen.

Von Manganoxiden überkrusteter Quarzkristall
("Artischockenquarz") auf Dolomit,
Bildbreite 3 mm.
Sphalerit ZnS
Infolge der zahlreichen Zinknachweise in den Mineralien ist die
Vermutung naheliegend, dass es auch Zinksulfid in der Form von
Sphalerit gegeben müsste. In einem Galenit konnten rote
Sphalerit-Körnchen bestätigt werden. Diese haben die tertiäre
Verwitterung dadurch überlebt, weil sie im Galenit "geschützt"
waren und sind somit heute noch vorhanden sind.


Links: Grünliche Sphalerit-Kristalle zwischen
angelösten, weißen Dolomit-Körnchen;
Bildbreite 6 mm.
Rechts: Neubildung von halbkugligem Sphalerit in einer Druse auf
weißem Dolomit. Sammlung W. HAHN;
Bildbreite 1,5 mm.
Zwischen den Dolomit-Kristallen findet sich auch Sphalerit.
Die grünlichen Kristalle müssten häufiger sein, denn man findet in
den Blei- und Kupfermineralien immer wieder Zink, so dass man von
einer weiten Verbreitung ausgehen muss, auch wenn das Mineral kaum
visuell in Erscheinung tritt. Der Sphalerit ist schwer erkennbar
und unscheinbar, wie das Foto oben zeigt.
Tangdanit
Ca2Cu9[(OH)9|(SO4)0,5(AsO4)9]·9H2O
Die Untersuchung eines "Tirolits" mittels Röntgendiffraktion
erbrachte einen "Klinotirolit", der seit 2014 als Tangdanit
benannt wird.

Blaugrünes, blättriges Tangdanit-Aggregat (links
der Bildmitte) im Malachit und Azurit,
entstanden aus einem großen Tennantit-Erzstück,
Bildbreite 2 cm.
Tennantit
(Cu,Fe)12As4S13
Fand sich als kleine Erzbröckchen im Dolomit;
frisch sind sie sehr selten (BLEUEL 1985). Locker verbreitet sind
tetraedrische Kristalle von ehemaligen und teilalterierten, im
Kern metallisch glänzenden Tennantit-Kristallen, oft außen
überzogen von blauem Azurit. Als Zersetzungsprodukt wurde ein
rissiges, röntgenamorphes Kupfer-Arsenat gebildet. Der Tennantit
enthält meist etwas Zn und Ag.


Links: metallisch glänzender Tennantit mit
Malachit zwischen DolomitKristallen;
Bildbreite 3 cm.
Rechts: Tennantit-Kristalle, die randlich in ein röntgenamorphes
Cu-Arsenat alteriert sind und im Innern ist noch silbrig
glänzender Tennantit erhalten;
Bildbreite 6 mm.

Tetraedrischer Tennantit-Kristall mit Azurit
überwachsen, im Innern von Goethit
durchsetzt, auf Dolomit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff,
Bildbreite 3 cm
Tetrahedrit Cu12[S|(SbS3)4]
Bei der Analyse von kleinen Erzbröckchen im Dolomit wurde eine
chemische Zusammensetzung nachgewiesen, die zu einem Tetrahedrit
gehört. Dies ist erstaunlich, denn sonst wurde Antimon kaum
nachgewiesen. Damit ist es auch möglich, dass man bei der
Zersetzung im Umfeld Sb-Phasen nchweisen können müsste.
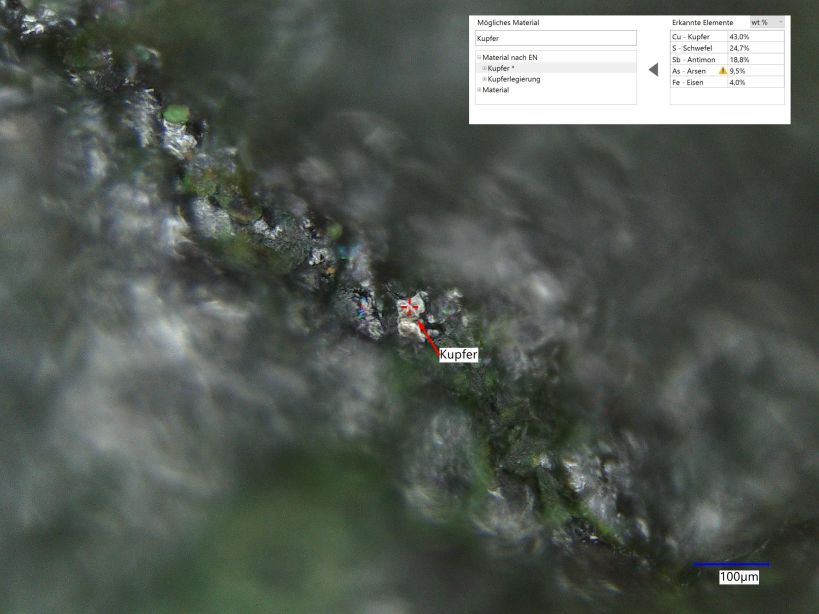
Silbrig glänzender Tetrahedrit,
Bildbreite 1 mm
Tenorit CuO
Das Vorkommen des Kupferoxids war lange Zeit als sehr fraglich
bewertet worden. Nun wurde eine Probe vorgelegt, bei dem durch
Analysen festgestellt wurde, dass es sich um eine Pseudomorphose
von Tenorit nach Azurit handelt. Als Begleitmineral ist Anglesit
gefunden worden.
Dies kann man so erklären, dass die Schwefelsäure aus der
Verwitterung von Sulfiden das Carbonat aus dem Azurit löste, so
dass das schwarze Kupferoxid übrig blieb.

Pseudomorphose von Tenorit nach Azurit,
Bildbreite 6 mm.
Tirolit Ca2Cu9[(OH)5|(AsO4)2]2·10H2O
Das bläuliche Mineral bildet selten strahlige Massen neben Azurit auf dem Dolomit als
Verwitterungsbildung von Fahlerz (BOSSE & BLEUEL 1988).
Möglicherweise handelt es sich ebenfalls um Tangdanit, der sicher
nachgewiesen ist.
Tsumebit Pb2Cu[OH/SO4|PO4]
Das sicher sehr seltene Mineral wurde als leicht Zn-haltige von
BOSSE & BLEUEL (1988) beschrieben. Es handelt sich um
hellbraunolive Krusten. Nach den Ausführungen von ZIMMERMANN
(mündl. Mitteilung 1995) handelt es sich um eine Fehlbestimmung!
Wulfenit
Pb[MoO4]
Das rote, tafelig ausgebildete, sehr seltene Mineral wurde
mehrfach gefunden. Es bildet bis zu 5 mm große, stark glänzende
und teils transparente Kristalle, welche aus den tiefen Lagen
geborgen wurden.

Tafeliger Wulfenit-Kristall mit einem igeligen
Mimetesit,
Bildbreite 7 mm
In kleinen, tafeligen bis säuligen Kristallen von rötlicher Farbe
konnte das sicher seltene Mineral auf zersetztem Galenit gefunden werden. Die bis zu 1 mm
großen Kristalle sitzen mit Azurit und Cerrusit auf Galenit aus
den dünngebankten Schichten des Zechstein-Dolomites.

Nadeliger, brauner Wulfenit neben Azurit und
Galenit auf Dolomit,
Bildbreite 5 mm
Zinkolivenit (Cu,Zn)2[OH|AsO4]
Das ebenfalls weißlich-grüne Mineral findet sich als grüne
Krusten, kleine Kristalle und dünne Fasern, die ähnlich wie beim
Olivenit beim Kontakt mit Wasser verfilzen können. Das Arsenat
wurde durch zahlreiche Analysen bestätigt.
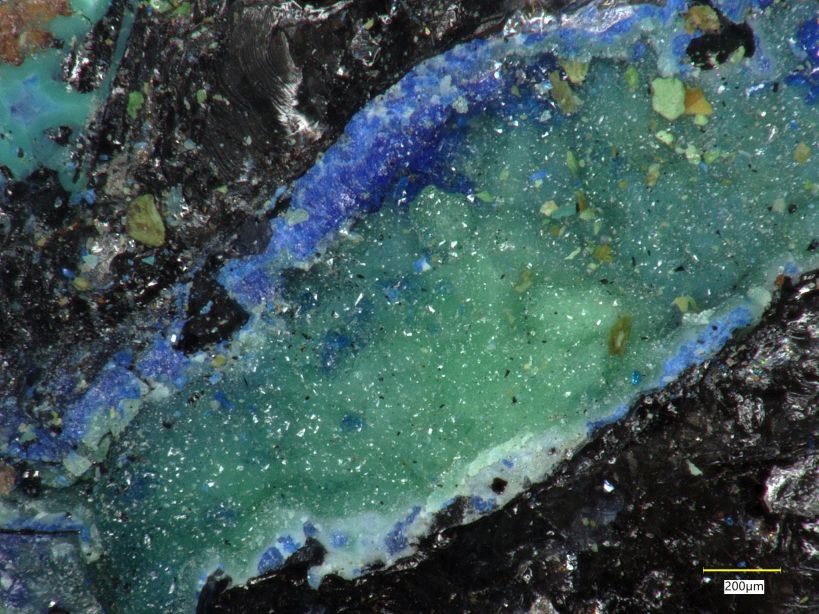
Grüne, kristalline Kruste mit Azurit und schwarzem Quarz in der
Umgebung
von ehemaligem Tennantit aus der Sammlung von G. ZELLMANN;
Bildbreite 2 mm.
Zinkgartrellit Pb(Zn,Fe,Cu)2(AsO4)2(H2O,OH)2
Stark glänzende, grüne, der Länge nach gestreifte Kristalle
erwiesen sich nach der chemischen Zusammensetzung als
Zinkgartrellit. Begleitmineralien sind Manganoxide und Azurit.
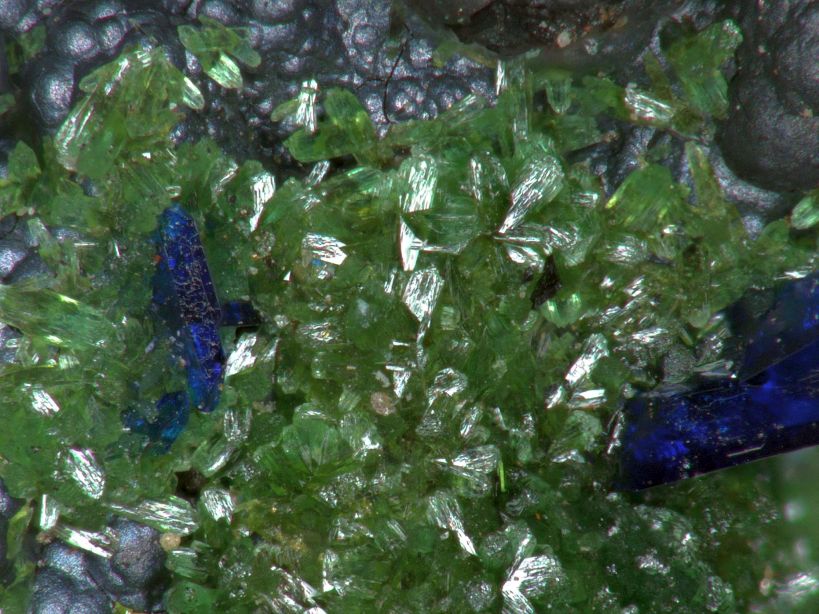
Grüne, glänzende Kristalle von Zinkgartrellit auf
einem Manganoxid und mit blauem
Azurit,
Bildbreite 1,5 mm
Entstehung der bunten Mineralisation -
(einfach beschrieben):
In Altenmittlau hat eine besondere Situation zu der üppigen und
farbenfrohen Mineralisation geführt:
- der Kupferschiefer im Liegenden der carbonatischen Sedimente,
- die hydrothermalen Lösungen, die im übrigen Spessart den Baryt
brachten
- eine tiefgreifende Verwitterung in einem feuchtwarmen
Paläoklima bis ins Pliozän.
Zum einen wurde hier vor etwa 255 Millionen Jahren über dem
Zechstein-Konglomerat der kohlenstoffreiche Kupferschiefer in den
Senken abgelagert, der reich an Schwermetallen wie Kupfer, Blei,
Zink, Eisen und Arsen; hinzu kommen Spuren des halben
Periodensystems wie Mo, Cr, Se, Co, U, Bi, S, Ni, Ag, Hg, Sb,
usw, ist. Darüber befinden sich die wenig verfestigten
dolomitischen Gesteine aus der Zechstein-Zeit. Diese bestehen aus
Calcium- und Magnesium-Carbonaten, mit etwas Eisen und Mangan,
aber auch Tonmineralien. Infolge eines nicht ganz verstanden
Prozesses kam es zu einer Mg-Anreicherung, was mit einer
Volumenreduzierung verbunden ist. Vermutlich waren auch noch
Anhydrite als leicht lösliche Komponente in der Form von
Konkretionen eingelagert. Das Auflösen führte dann zur Bildung der
primären Hohlformen, die lagenweise angereichert sind, während
manche Bänke im Dolomit kaum Hohlräume enthalten. Gleichzeitig
wurde dem Gestein Eisen- und Mangan zugeführt, was zu der dunklen
Farbe des Gesteins führt; dies ist nicht überall der Fall gewesen,
wie z. B. in Rodenbach, wo die Dolomite viel heller sind.
Im Zechstein-Meer wurde beim Eindampfen auch in großen
Mengen Kalk ausgefällt (im Beckeninneren auch der Gips (teils als
Anhydrit) und das (Koch-)Salz Halit, wie z. B. im nördlich gelegen
Neuhof-Ellers bei Fulda), der auf den Grund des nicht sehr tiefen
Meeres sank. Dieser Prozess wurde zyklisch unterbrochen, in dem
zusätzlich eine Tontrübe eingespült wurde, die heute die einzelnen
Bänke trennen. Noch im marinen Umfeld wurde aus dem Kalk durch
Zufuhr von Magnesium-Ionen eine dolomitischer Kalk und Dolomit.
Das Meer war für die meisten höheren Lebensformen zu reich an
Salz, so dass nur Krebse und Cyanobakterien leben konnten. In den
Phasen, in denen der Salzgehalt reduziert wurden, konnten
salztolerante Lebewesen, wie z. B. Brachiopoden, leben, die in
seltenen Fällen fossil überliefert sind (es sind immer nur
Steinkerne vorhanden, die einstigen Schalen aus Aragonit wurden
aufgelöst). Ganz selten schafften es auch Fische, die sehr selten
fossil erhalten sind.
Mit dem Eindringen der hydrothermalen Lösungen vor ca. 160
Millionen Jahren wurde zuerst der Baryt abgeschieden, aber auch
ein Teil der Carbonate mobilisiert und anschließend in veränderter
Form wieder ausgeschieden. Hierher gehören die (Fe) Ankerit- und
(Mn) Kutnahorit-Komponenten in den neu gebildeten Carbonaten, die
den größten Teil der Hohlraumauskleidungen ausmachen und dem
Gestein partienweise ein zuckerkörniges Gefüge verleihen.
Gleichzeitig waren die lagenweise angereicherten Hohlräume eine
willkommene Wegsamkeit für große Mengen an Fluiden. Mit den
Lösungen wurde auch der Kupferschiefer teilweise ausgelaugt und
die Schwermetalle wurden umgelagert, so dass über dem
Kupferschiefer zur Bildung von Tenanntit, Chalkopyrit, Pyrit und
Galenit kam; und in ganz seltenen Fällen auch Molybdänit.
Merkwürdig ist das Fehlen von Arsenopyrit, der im Raum Bieber und
Huckelheim sehr verbreitet auftritt. Da im Kupferschiefer auch
organische Substanzen enthalten sind, lösten sich auch
Kohlenwasserstoffe und diese wurden in den Hohlräumen zwischen den
Carbonaten wieder konzentriert, so dass durch Reifung
pechschwarzer Asphalt entstand, den man nur schwer von nahezu
allgegenwärtigen Manganoxiden unterscheiden kann. Dabei sind auch
größere Kristalle und derbe Massen der Sulfide gebildet worden.
Die einst nach der Diagenese vorhandenen Hohlformen wurden dabei
überprägt, so dass die wahre Natur der Drusen nur schwer
nachvollzogen werden kann. Örtlich kam es zur Bildung von Quarz.
Im feuchtwarmen Tertiär (eine genaue Zeitspanne lässt sich nicht
angeben, weil man nicht weiß, wie alt die Mineralien sind)
erreichte die tiefgründige Verwitterung diese Sulfide und laugte
ein Teil der Sulfate weg; so verschwand der allergrößte Teil des
Baryts. Die Sulfide wurden ganz oder teilweise gelöst. Die
Kupferionen wurden in dem Azurit und Malachit fixiert. Das Blei
ging in der unmittelbaren Nähe in Anglesit und Cerrusit und mit
dem Arsen in den Mimetesit. Infolge der hohen Ca-Gehalte wurde in
größerer Distanz kein Anglesit gebildet werden. Wegen der hohen
Vormacht als As-Ionen kam es nicht zur Bildung von Pyromorphit.
Dort wo die As-Gehalte bei gleichzeitigem Vorhandensein von Cu
vorhanden waren, bildete sich der Olivenit, lokal auch mit
deutlichen Zn-Gehalten als Zinkolivenit. Zementativ konnte
innerhalb der Cu-Karbonate auch selten Cuprit gebildet werden. In
seltenen Fällen kristallisierten kleine Quarz-Kristalle, meist
fast ohne Prisma, so dass sie wie Dipyramiden aussehen.
Örtlich war auch der Gehalt an Si aus den Tonmineralien so hoch,
dass es selten Ausscheidung von Kaolinit kam. In einzelnen
Hohlräumen waren weitere Elemente in so hoher Konzentration
gelöst, dass weitere Phasen in mg-Mengen kristallisierten. So ist
es überraschend, dass es auch Phosphate gibt. Bemerkenswert ist
das Fehlen von Bariopharmakosiderit im Bereich der Massivsulfide,
der sonst in ähnlichen Vorkommen verbreitet nachweisbar ist. Durch
Änderung der Zusammensetzung der Lösungen kam es auch zur
Umsetzungen, die die Form der Mineralien erhält, aber nur die
Substanz verändert; diese Gebilde nennt man Pseudomorphosen. Diese
Phase hält bis in in die heutige Zeit an. So wurde verbreitet
blauer Azurit in grünen Malachit, silbriger Galenit in weißen und
grauen Cerrusit und fahlgrauer Tennantit in braunen Goethit
umgewandelt. Aber auch Azurit in Tenorit.
Die Eisen- und Mangangehalte der verwitterten Carbonate führt
zur Bildung von Goethit und den "hässlichen" amorphen
Manganoxiden.
Zu den ganz jungen, wahrscheinlich teils bis rezenten, Bildungen
gehören die weißen Calcite als Überkrustungen in den Drusen - der
oft zitierte Aragonit ließ bisher nicht bestätigen.
Zurück, zum
Anfang der Seite oder weiter