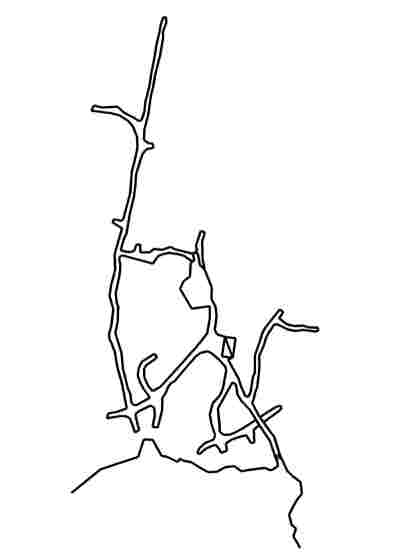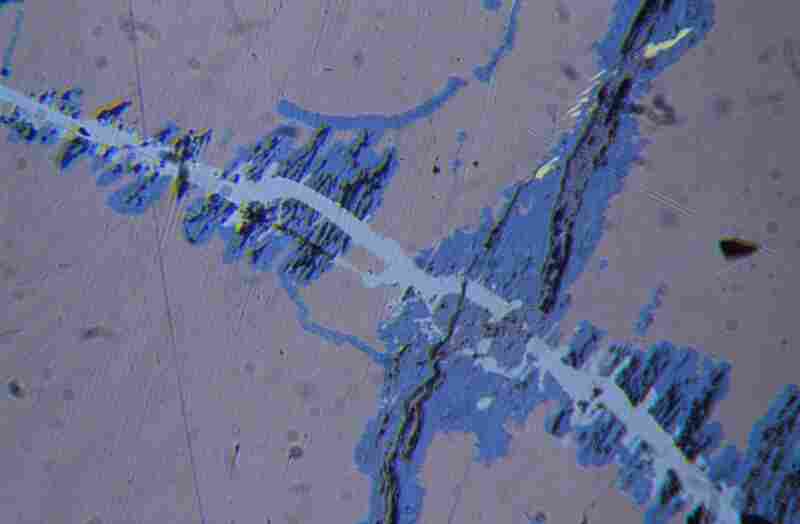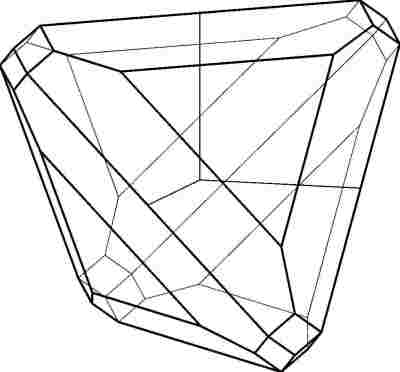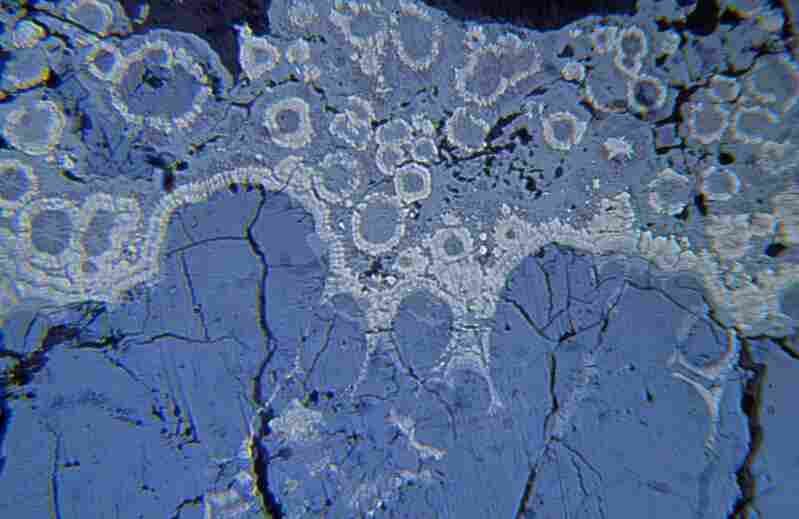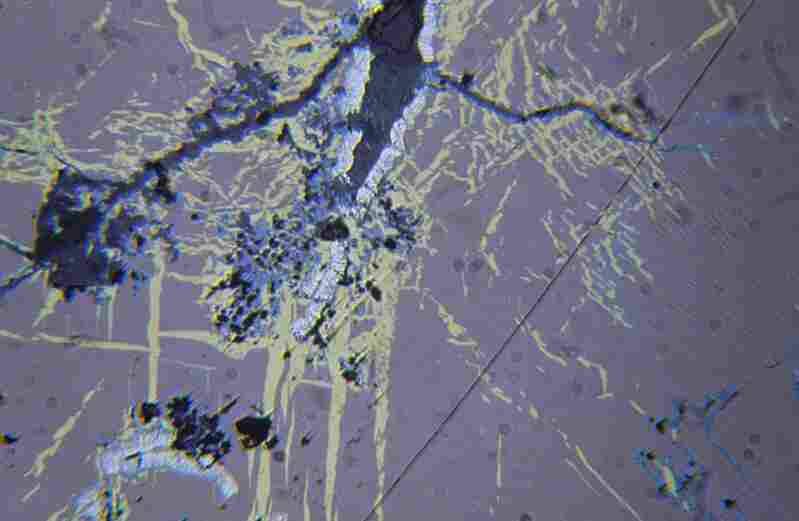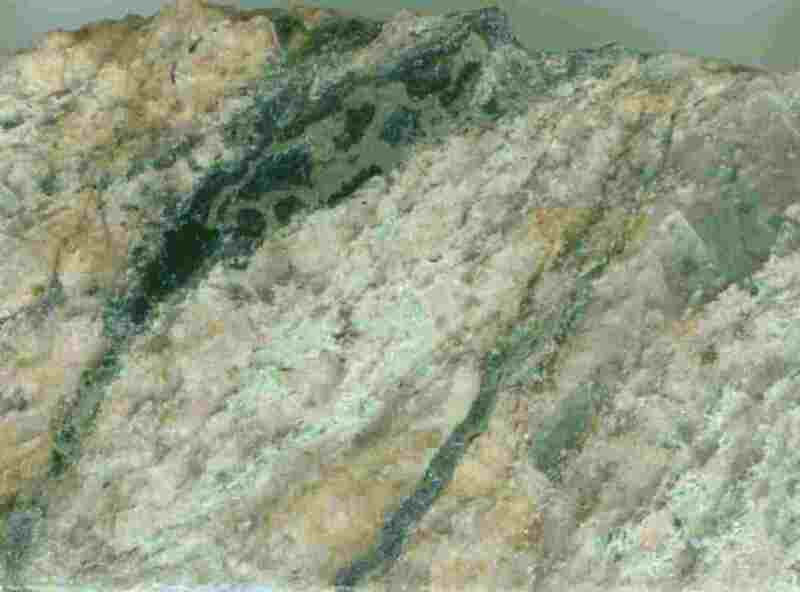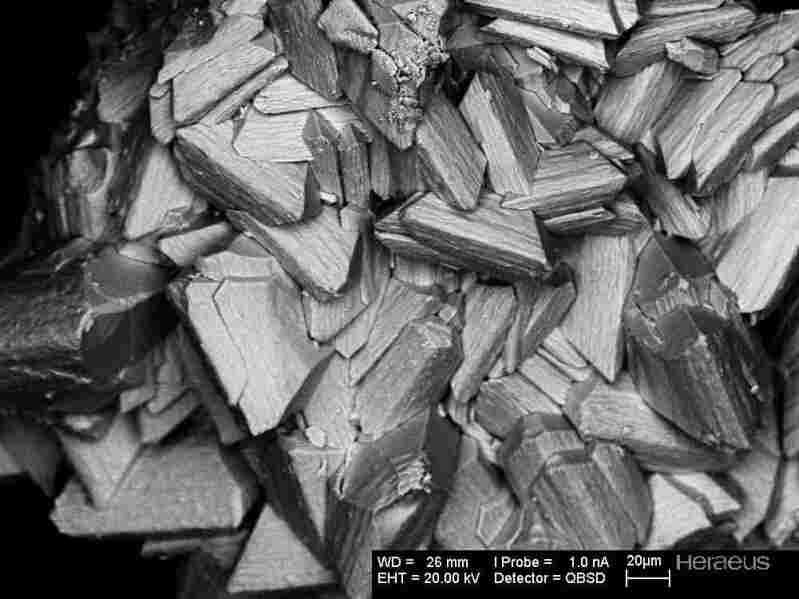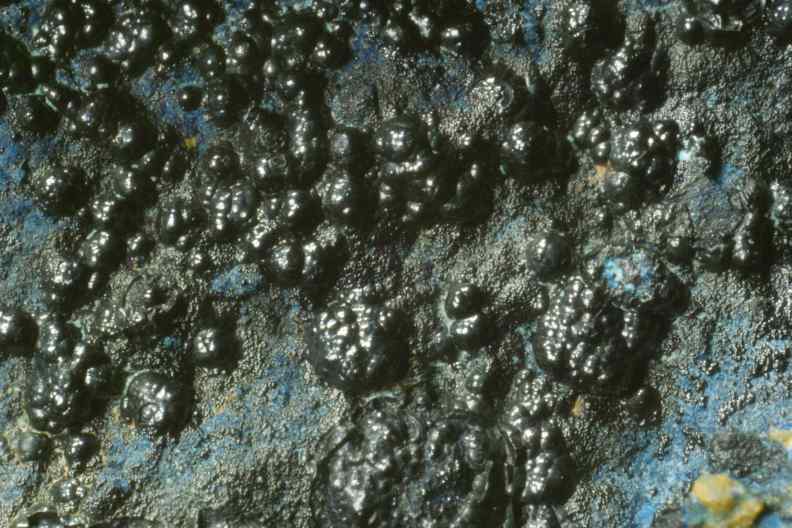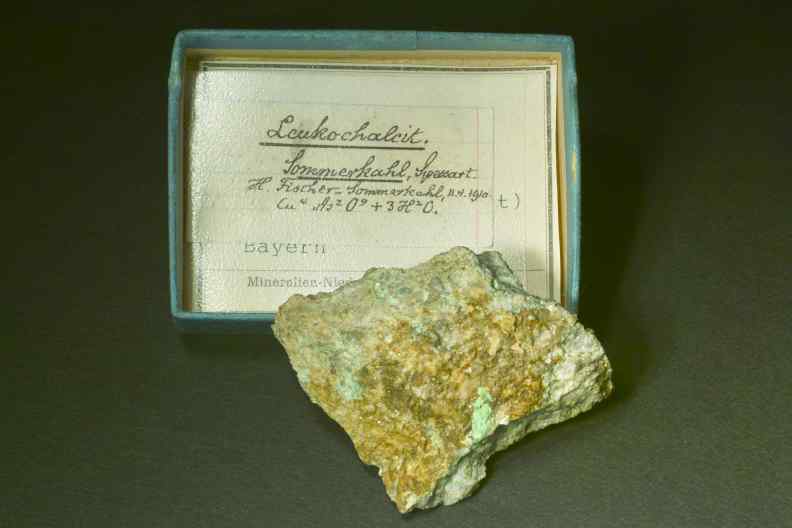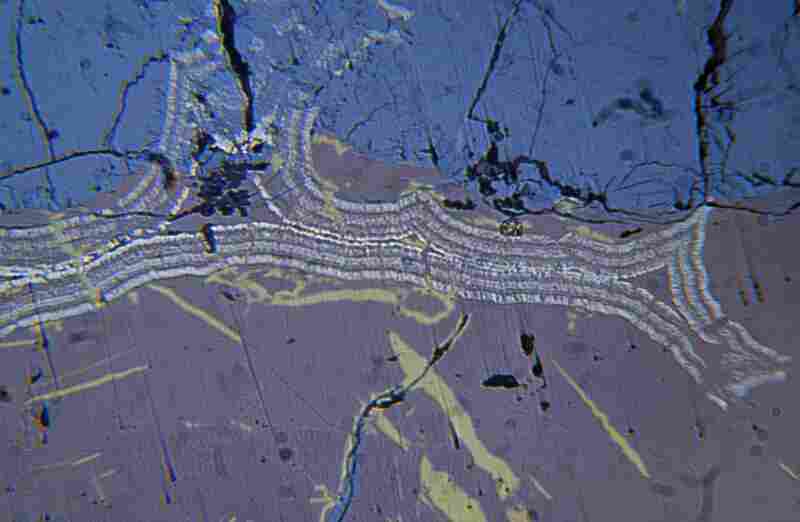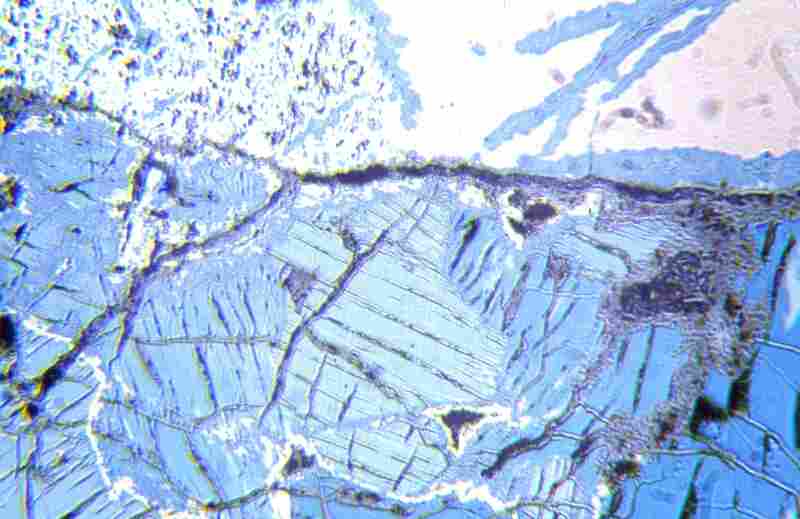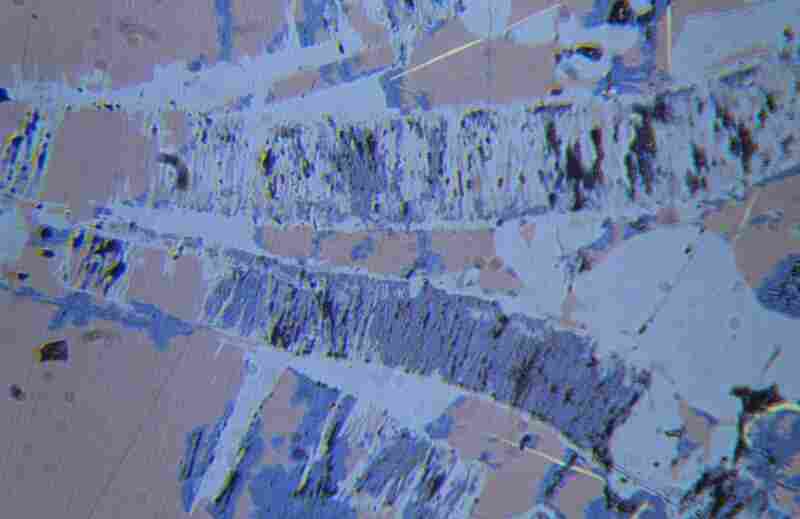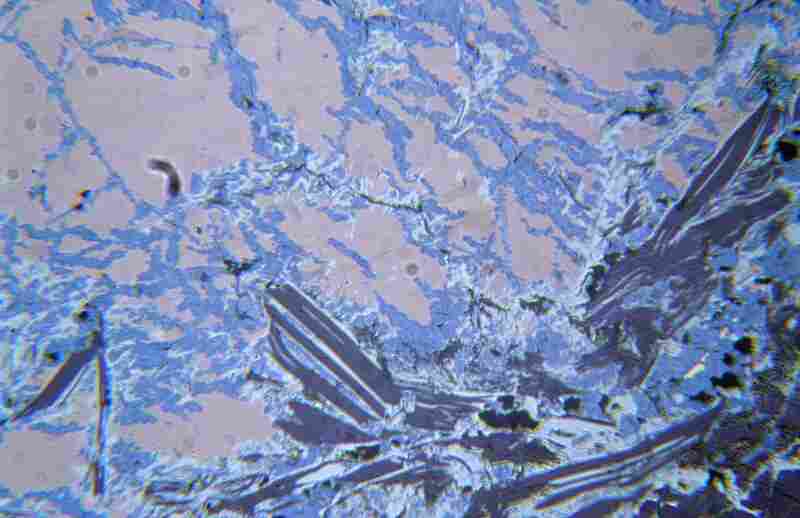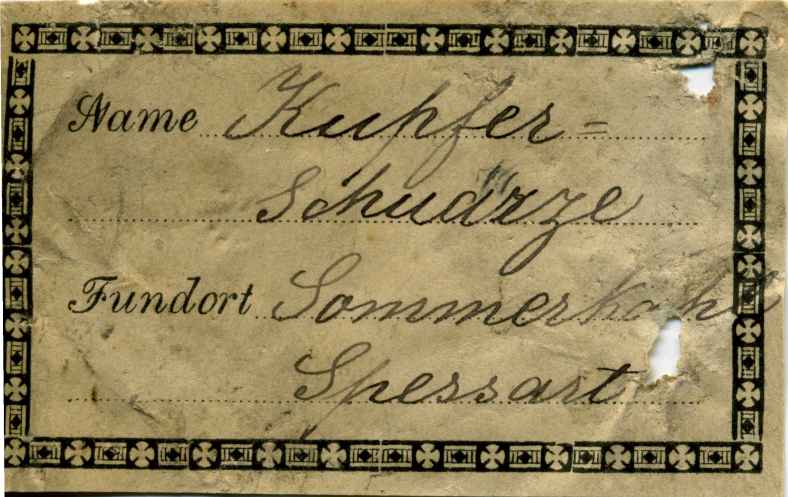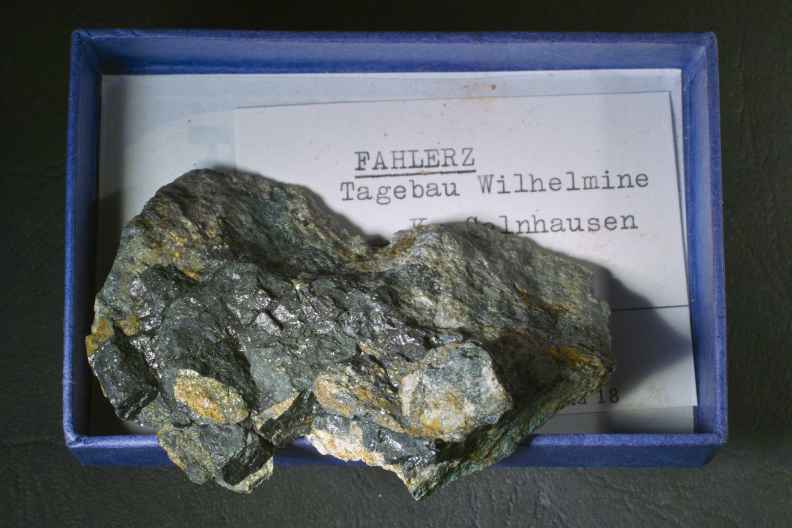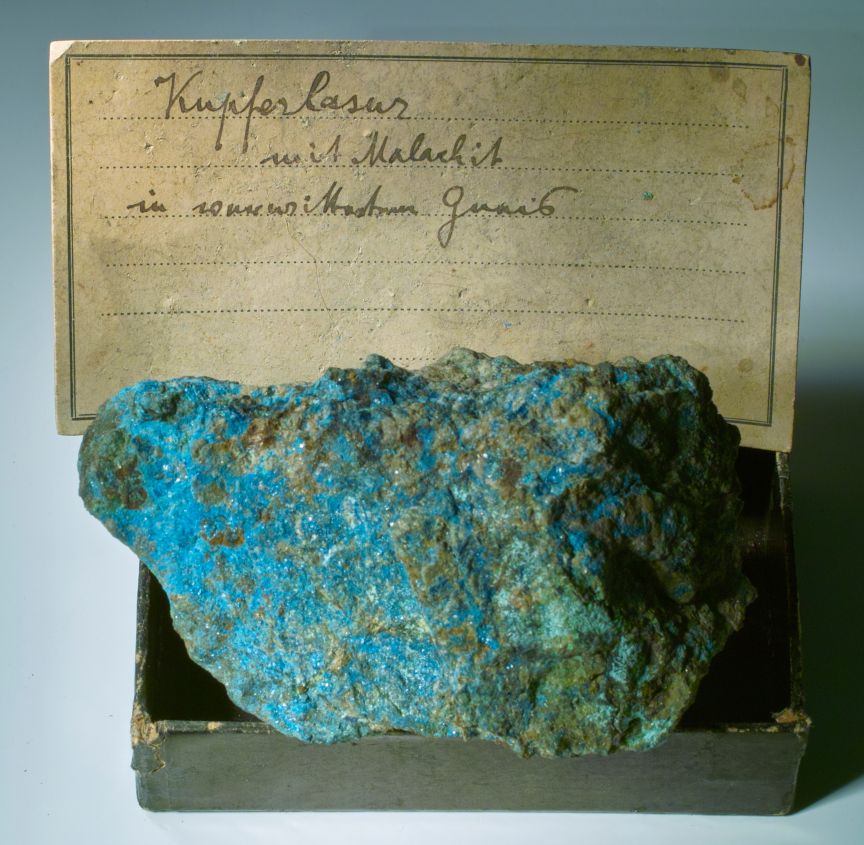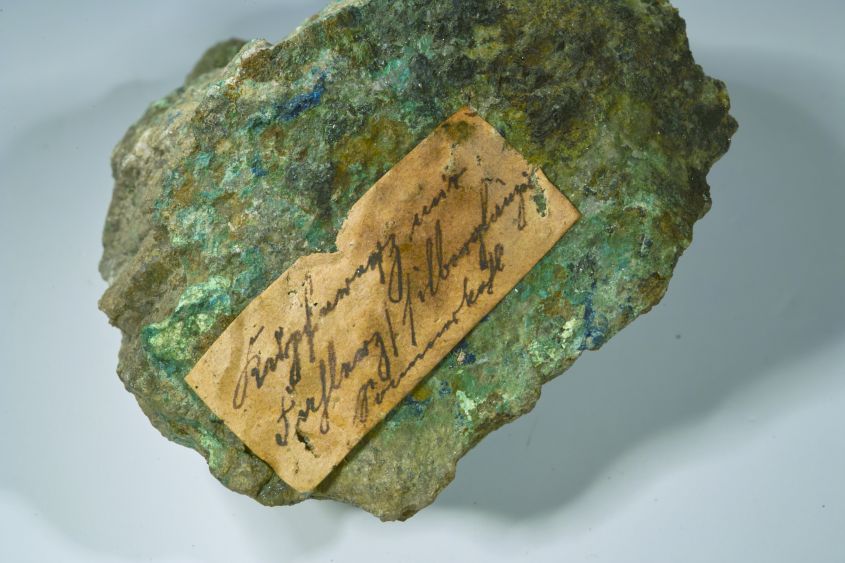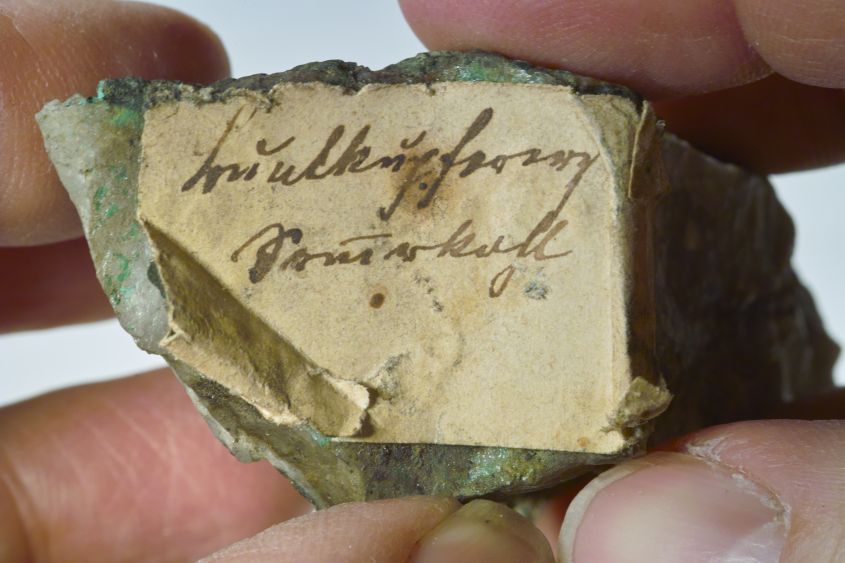Das ehemalige Kupferbergwerk der
Grube Wilhelmine in
Sommerkahl
im Spessart -
jetzt Besucherbergwerk
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Zum Erinnern:
2022
100 Jahre Wiedereröffnung der Grube Wilhelmine & 20
Jahre Bergwerksverein
Wichtiger Hinweis:
Es sind zur Zeit und ohne Führung nur die Tagesanlagen zugänglich.
Ein am 27.05.2000 gegründete Verein
mit Sitz in Sommerkahl hat es sich zum Ziel gemacht, die
untertägigen Anlagen der 23-m-Sohle auch für Besucher wieder
zugänglich zu machen. Dies wird erst nach umfangreichen Änderungen
und Bauarbeiten in einigen Jahren möglich sein. Auch werden zur
Bereitstellung einer Infrastruktur (Strom, Wasser, Licht,
Toiletten usw.) weitere Finanzmittel benötigt, die in kurzer Zeit
nicht aufzubringen sind.


Das obige Bild zeigt den westlichen Teil der Wand des ehemaligen
Tagebaues mit den farbigen Sekundärmineralien und dem Ansatz zu
einem
verstürzten Stollenmundloch; aufgenommen am 17.10.1999, rechts
eine frühere Aufnahme nach der Sicherung des Hanges am
04.06.2006.
Das sehr standfeste und überaus harte Gestein (Gneis)
ermöglichte es Stollen vorzutreiben, die keinen Sicherungsausbau
aus Holz benötigt.
Gleichzeitig war es beim Abbau ein Hemmnis. Infolge des hohen
Quarzanteiles bestand die Gefahr für die Bergleute, an Silikose
zu erkranken,
weil man trocken bohrte.
Im Winter, bei langanhaltendem, strengem Frost bildet sich an den
Felsen eines der bedeutendsten Minerale der Welt, das Eis.
An den Wänden und in den Stolleneingängen kann man den
Formenschaft der eisenen Tropfsteine studieren. Leider ist es ohne
großen Aufwand kaum zu sammeln und die Schönheit ist nur im Foto
zu erhalten:



Dort wo das aussickernde Wasser auch Metalle gelöst hat, sind die
Eisbildungen grün und/oder blau gefärbt;
aufgenommen am 04.01.2002
Zusammenfassung
Die heute sichtbaren Anlagen stammen aus dem Beginn des 20.
Jahrhunderts, wo das Bergwerk für nur wenige Jahre auf Kupfersulfide
bebaut wurde. 1922 wurde der Betrieb aufgrund von zu geringen
Erzvorkommen und Wassermangel im Winter eingestellt. Der bunt
mineralisierte Tagebau war ein bekannter Fundort für zahlreiche,
meist farbige, sekundär gebildete Mineralien wie Azurit und
Malachit.
Lage
Das Bergwerk liegt am östlichen Ende von Obersommerkahl bei
Schöllkrippen im Spessart (siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 167ff,
Aufschluss Nr. 48, LORENZ & SCHMITT 2005). Ummittelbar nach
den letzen Häusern ist der ehemalige Tagebau auf der Nordseite des
Tales zu sehen, von dem die Stollenmundlöcher zu den erhaltenen
Strecken der 23m-Sohle ausgehen; weitere Sohlen sind
teilweise verschüttet oder stehen unter Wasser. Von den
Betriebsgebäuden ist der allergrößte Teil im Lauf der Jahre
abgerissen worden und es sind nur noch Reste erhalten. Gleiches
gilt für die einst reichlich vorhandenen Halden im Bereich des
heutigen Sportplatzes.
Etwas weiter östlich sind an der Hangschulter die schwer
auffindbaren Reste der Erzaufbereitung, fast gänzlich zugewachsen,
zu erkennen. Es handelt sich um die massiven Fundamente der
Aufbereitungsanlagen aus Kugelmühlen, LINKENBACH-Rundherde
und Absetzbecken.Von den eigentlichen Förderanlagen hat nichts
überlebt.
Der dazu gehörende Förderschacht ist an der Oberfläche dauerhaft
mit Beton verschlossen worden und liegt nördlich des Tagebaues.
Der darin einst verkeilt hängende Förderkorb wurde im Jahr 2002
aus dem Schacht geborgen und wird zur Zeit konserviert.

Einer der beiden Rundherde nach dem System LINCKENBACH der
ehemaligen Aufbereitung östlich des Bergwerkes;
aufgenommen am 26.05.2016
Geologie
Das Bergwerk befindet sich im kristallinen Grundgebirge innerhalb
eines ca. 335 Millionen Jahre alten Muskovit-Gneises
(Schöllkrippener Gneis). Dieser Gneis entstand durch Metamorphose
(Umwandlung durch Hitze und Druck tief im Erdinnern) während der
variskischen Gebirgsauffaltung aus einem ehemaligen Granit. Der
einst hier auflagernde Kupferschiefer der carbonatischen
Zechsteinsedimente ist der Erosion zum Opfer gefallen, ist aber
beiderseits des Tales unter dem Buntsandstein anstehend. Die
Störungen streichen - soweit erkennbar - in etwa in der üblichen
Richtung von Nordwest nach Südost mit einer gewissen Abweichung
nach Nord.
Die zahlreichen, nur dünnmächtigen und sehr absätzigen Erzgänge
auf den Spaltenzügen von bis zu ca. 2 cm Mächtigkeit treten in
kaum veränderten und sehr standfesten Muskovit-Gneisen auf
(deshalb ist innerhalb des Berges auch keine Auszimmerung oder
Abstützung nötig).
Im Bereich des Tagebaues (oder auch Steinbruch) sind die primären
Erze oft zu den bunten und damit auffälligen Sekundärmineralien
umgesetzt.
Die hier gebildeten Erze wurden wohl durch die im Jura
hydrothermal aufgedrungenen, barytführenden Lösungen aus dem
früher den Gneis überlagerten Kupferschiefer gelöst und im Gneis
wieder ausgeschieden. Dies ist der Grund, warum die tiefen
Gangspalten nahezu erzleer angetroffen wurden.

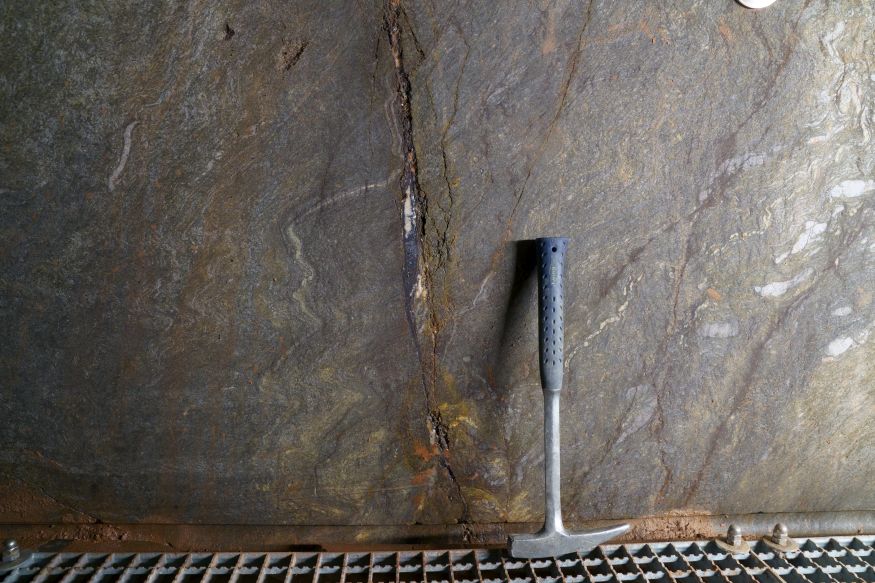
Um zwei Strecken zu verbinden, wurde der Fels durchgesägt, so dass
man die sehr enge Klüftung sehr gut sehen kann. Neben den
zahlreichen
Klüften (aber ohne die einst willkommenen Kupfererze) im Gneis
fallen die weißen Quarze ins Auge. Diese wittern an der Oberfläche
frei und
bilden die harten, hellen Lesesteine auf den Äckern.
Beim Betrachten beachte man auch die schönen Falten in dem Gneis.
Der cm-breite Gang im rechten Bild führt neben weißem Baryt nur
noch
schuppiger Hämatit. Solche Gänge sind im Spessart sehr verbreitet
und eine Folge der hydrothermalen Baryt-Mineralisation.
Bildbreite etwa 1,2 m
aufgenommen am 26.08.2018 und 03.09.2022
In den östlichen Teilen des Bergwerks steht eine weichere
Gesteinsart an, die auffällig kleinstückig zerbricht. Die
Schieferungsflächen sind nicht glatt, sondern wellig und im
Querbruch sieht man reichlich kleine Falten. Dabei handelt es sich
um einen Glimmerschiefer (auch
Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis), der darüber hinaus auch noch
heftig zerschert und tektonisch beansprucht wurde. Die Feldspäte
sind in Tonmineralien zersetzt. In den Zwickeln wurde reichlich
Eisenoxid als Hämatit abgeschieden, so dass man in der Regel
rotbraune Hände bekommt, wenn man die Steine anfasst.

Schieferungsfläche eines Glimmerschiefers aus der Grube,
Bildbreite 10 cm
Historie
Der Abbau von Kupfererzen um Sommerkahl/Schöllkrippen begann im
späten Mittelalter und ist für 1542 dokumentiert; damals wurde
jedoch der leichter gewinnbare, aber schwer verhüttbare
Kupferschiefer im Bereich des Schabernack von
Vormwald/Schöllkrippen (?) abgebaut oder eine Gewinnung versucht.
Ob dies im Bereich des heutigen Sportplatzes zwischen Vormwald und
Sommerkahl war, müssen zukünftige Gelände-Forschungen belegen.
Archivalien darüber sind nicht vorhanden.
Beim Anlegen des Sportplatzes 1986 wurden alte Stollen und ein
Kalkofen freigelegt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Ort
als "Bergloch" bezeichnet. Für das Jahr 1704 ist ein Abbau in
Sommerkahl urkundlich belegt. Aber erst Ende des 19. Jahrhunderts
begann man im Bereich der "Wilhelmine" in größerem Umfang
untertägig Kupfererze zu gewinnen. Damals bestand eine
Vitriollaugerei.
Nach dem 1. Weltkrieg führte der allgemeine Rohstoffmangel zu
einem Wiederaufleben dieser Aktivitäten. Es wurden 10 Millionen
Mark verbaut und das Bergwerk innen über die 60m-Sohle
ausgeweitet. Man ließ sich jedoch von den großflächig
auftretenden, bunten Sekundärmineralien im wahrsten Sinne des
Wortes "blenden" und musste bereits 1922 den Betrieb wieder
einstellen. Später wurde das Bergwerk ausgebaut und als
Anlagebetrug von Eugen ABRESCH an den den Flugzeugkonstrukteur
Anthony FOKKER verkauft. Der gewinnbare Gehalt an Erzen in dem
sehr harten Gestein war zu gering. Die Aufbereitung gestaltete
sich insbesondere im Winter als problematisch, das das Wasser für
die LINKENBACH-Rundherde für die Trennung von Erz und Nebengestein
fehlte. Eine Flotation für 24 Millionen Mark hätte geringere
Verluste an Erzen erbracht und wurde hier nicht mehr realisiert.
Auch enthalten die Erze große Mengen an Arsen, die bei der
Verhüttung unerwünscht sind.
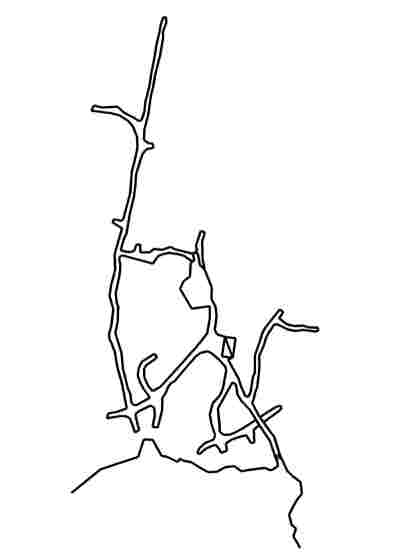

Der Grubenriss und ein Blick ins Bergwerk aus der Frühzeit der
Aufwältigung, hier im Bild mit Werner SCHAUPERT
(*19.12.1939 †10.05.2025),
der in einen der vielen Blindstrecken blickt;
aufgenommen am 02.03.2002
Das Stollensystem (oben die heute noch begehbare 23-Sohle) wurde
dann während des 2. Weltkrieges als Luftschutzeinrichtung genutzt.
Später wurde versucht, darin Pilze (Champignons) zu züchten. Durch
Schottergewinnung in den 50er Jahren wurde der Tagebaues auf die
heutigen Verhältnisse erweitert und dann größtenteils mit Haus-
und Sperrmüll bis in die 60er Jahre vergeschüttet.
Dann wurde der Zugang dauerhaft verschlossen und über Jahre hatten
nur die Fledermäuse einen ständigen Zugang. Mineraliensammler und
Geologen nutzen die Gelegeheit, die Cu-Mineralisation an den
Wänden des steinbruchartigen Areals zu studieren und auch
mitzunehmen.
Mit der Gründung des Bergwerkvereins im Jahr 2000 kam es zu einer
Wiederaufwältigung und der Einrichtung eines Besucherbergwerks,
welches heute jährlich einige tausend Besucher fasziniert.
Die gesamte Ausdehnung des Bergwerks ist infolge der wechselhaften
Betriebsgeschichte und der verschiedenen Ansatzpunkte nur
teilweise bekannt. Es gibt eine 6-m-Sohle (nicht zugänglich), eine
12- und 18-Meter-Sohle, die 23,5-m-Sohle, die für die Führungen
ausgebaut wurde und eine 30-m-Sohle, die aber teils unter Wasser
steht. Weitere Sohlen sind unter Wasser, die durch einen Schacht
auf 60 m erschlossen sind. Ein Schrägschacht erschießt auch noch
eine 80-m-Sohle, wie man aus Archivalien weiß. Stand Sommer 2022:
alle bekannten Stollen und Schächte haben zusammen genommen eine
Länge von ~1.900 m (HACKEL 2022:211).
Mineralien


Das linke Bild zeigt einen blauen Azurit mit den strahligen,
blaugrünen Aggregaten eines Olivenit.
Im rechten Bild erkennen Sie im Zentrum einen aus großen,
grünbraunen Kristallen bestehenden
Olivenit mit randlich der typischen, feinstnadeligen Ausbildung
des gleichen Minerals;
(Bildbreiten ca. 3 mm).
Die bunten Mineralien des Tagebaues sind seit langem das Ziel von
Mineraliensammlern. Bereits der berühmte straßburger
Mineralogieprofessor Hugo BÜCKING (1851-1932) suchte hier nach
Kupfererzen. Die primären Erze sind Verwachsungen aus den Mineralien
(Sulfide):
Mit Ausnahme des Tennantit und Pyrit kommen die Erze nur derb
vor. Idiomorphe Kristalle werden kaum und selten einige mm groß.
Diese metallhaltigen Mineralien waren das Ziel des Bergbaues. Die
Erze sind inning miteinander verwachsen, weshalb die Aufbereitung
des Erzes sehr schwierig war. Dabei ist der Tennantit und Bornit
vor dem Pyrit und Chalkopyrit gebildet worden. Der in der
Literatur erwähnte Idait konnte noch nicht nachgewiesen werden.
Der Tennantit enthält geringe Mengen an Silber.
Die Mineralisation weist auf eine recht niedrige
Bildungstemperatur hin (OKRUSCH et al. 2007). Die entlang der
Störungen aufdringenden, bariumhaltigen Hydrothermen mit den
gelösten Metallen schieden die Erze aufgrund der höheren C-Gehalte
im Grenzbereich zwischen Kupferschiefer und Gneis wieder aus. Der
Kupferschiefer ist inzwischen wegerodiert worden, steht aber in
der Umgebung noch flächig an und war in füheren Zeiten der Grund
für zumindest einen Versuchsbergbau.
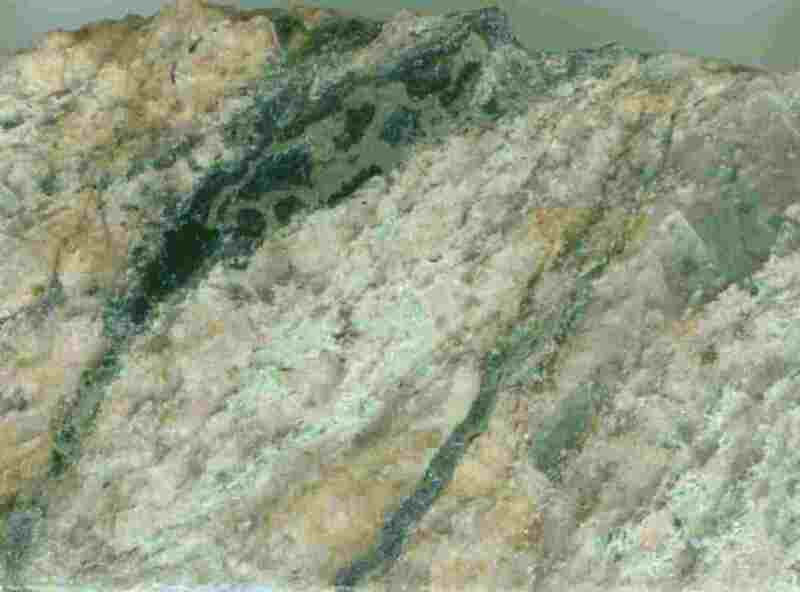
Bläulicher Tennantit und gelber Pyrit als Spaltenfüllung
im Gneis,
Bildbreite 5 cm
Im obigen Bild erkennt man einen cm-breiten Erzgang aus Bornit (ganz
dunkel), Tennantit (etwas heller) und Pyrit (gelb). In der unteren
Hälfte bestehen die dünnen Erzschnüre und metallischen
Imprägnationen um den Quarz (grau) meist aus Pyrit, nur links ist
ebenfalls Bornit erkennbar. Das Stück des typischen Gneises wurde
angeschliffen und poliert. Der Gneis selbst besteht aus Quarz,
Feldspat und wenig Glimmer (Muskovit).
In Spuren dabei finden sich neben den Erzmineralien die
Gangarrten aus weißem Baryt, hellbraunem Dolomit, weißem Calcit
und am meisten verbreitet, farblosem Quarz. An vielen Stellen sind
die stark absätzigen Erze löchrig angewittert. In diesen
Hohlräumen, oft begleitet von primären, angelösten Quarzkristallen
wurde eine Vielzahl von grünen und blauen Mineralien der
Oxidationszone gebildet:
Die Abbildung zeigt auf dem im frischen Zustand
silbrig
metallisch glänzenden Tennantit den blättrigen, grünen
Chalkophyllit (nahezu sechseitig und grün) neben
blauem Azurit,
Bildbreite ca. 3 mm.
Bildergalerie der bunten
Mineralien der Grube Wilhelmine in Sommerkahl:
Azurit

Azurit als blaue, tafelige Kristalle - das häufigste blaue
Mineral der Grube;
Bildbreite 5 mm
|
Malachit

Strahliger Malachit. Solche Kristalle sind selten, denn
meist sind es nur erdige Krusten;
Bildbreite ca. 7 mm
|
Caledonit

Caledonit als kleine, blaue Kristalle neben zersetzten
Sulfiden;
Bildbreite 5 mm
|
Erythrin - Babánekit

Ein Mischkristall zwischen Erythrin (Cobaltarsenat) und
Babánekit (Kupferarsenat) als rote Kristalle und Krusten
auf dem Gneis, gefunden von Hans GRÄSSEL(†);
Bildbreite 5 mm
|
Illit und Malachit

Feinschuppiger Illit mit grünem Malachit;
Bildbreite 5 mm
|
Olivenit

Olivenit in der typisch feinnadeligen Ausbildung;
Bildbreite 5 mm
|
Azurit

Azurit als winzige Kristalle auf Quarz-Kristallen;
Bildbreite 2 cm
|
Azurit

Fahlblauer Azurit als Hof um erdigen Malachit;
Bildbreite 2 cm
|
Chalkanthit

Chalkanthit, das natürliche Kupfersulfat bildet sich an
den Wänden in dem Bergwerk, je nach Jahreszeit recht
schwankend;
Bildbreite 5 mm
|
Chrysokoll

Typisch rissiger Chrysokoll als Neubildung auf dem Gneis;
Bildbreite 5 mm
|
Quarz

Farblose, leicht angelöst Quarzkristalle auf Gneis;
Bildbreite 2 cm
|
Langit

Plattige Langit-Kristalle als Neubildung in einer internen
Versatzmasse;
Bildbreite 5 mm
|
Parnauit

Dünnplattige Parnauit-Kristalle als Drusenauskleidung;
Bildbreite 5 mm
|
Tennantit

Reliktischer Tennantit-Kristall, eingeschlossen von weißem
Baryt;
Bildbreite 2 cm
|
Wroewolfeit

Wroewolfeit als bläuliche Kristalle neben schuppigem
Serpierit;
Bildbreite 5 mm
|
Serpierit

Türkisfarbener Serpierit als dünne Kruste auf dem Gneis;
Bildbreite 5 mm
|
Olivenit
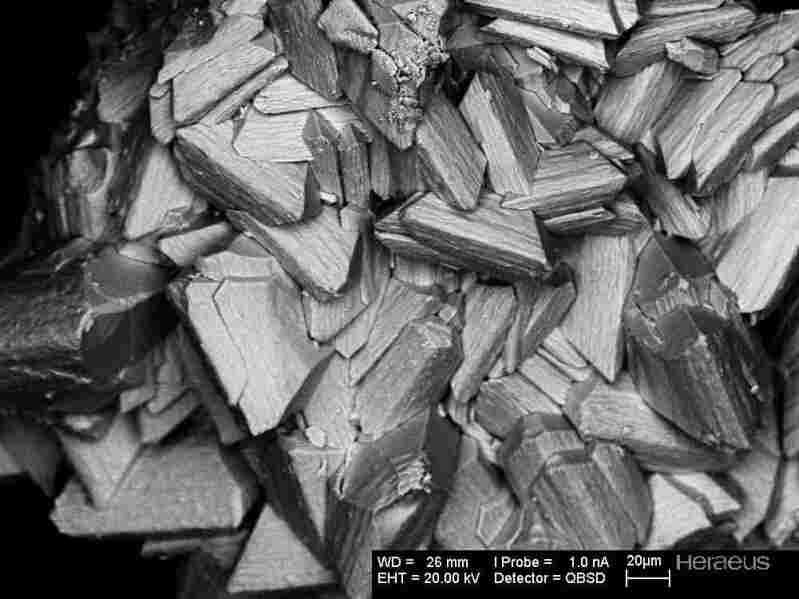
Ungewöhnliche, grüne Olivenit-Kristalle, REM-Foto,
Sammlung Thomas WEIS, Schneppenbach;
Bildbreite ca. 0,5 mm
|
Bariopharmakosiderit

Grünlicher Bariopharmakosierit auf zersetztem Fahlerz
mit Goethit;
Bildbreite 5 mm
|
Chalkophyllit

Strahliger Chalkophyllit mit etwas blauem Azurit und
Quarz;
Bildbreite 5 mm
|
Posnjakit

Blauer Posnjakit als erdige Beläge auf Gneis;
Bildbreite ca. 7 mm
|
Clarait

Hellblauer Clarait als Pusteln auf Gneis;
Bildbreite 5 mm
|
Cornwallit

Grüne Cornwallit-Krusten auf Malachit mit Azurit und
Resten von Tennantit;
Bildbreite 5 mm
|
Hämatit

Schuppiger Hämatit auf Quarz-Kristallen;
Bildbreite 5 mm
|
Malachit

Erdiger Malachit als zelliges Verwitterungsprodukt aus
Tennantit, daneben blauer Azurit;
Bildbreite 5 mm
|
Manganomelans
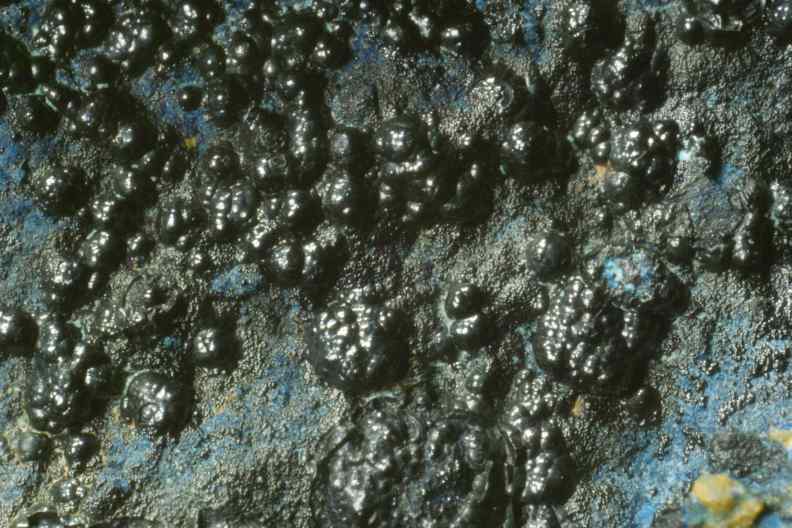
Schwarze, hochglänzende glaskopfartige Aggregate eines
Manganomelans. Diese kalt entstandenen Manganoxide
erwiesen sich als röntgenamorph;
Bildbreite 5 mm
|
Olivenit

Hellgrüne, rundliche Olivenit-Aggregate auf blauem Azurit
neben grünem Malachit;
Bildbreite 5 mm
|
Aragonit

Radialstrahliger, weißer, nadeliger Aragonit mit
terminalen mit Serpierit-Schüppchen;
Bildbreite 5 mm
|
Baryt

Weißer, dünntafeliger Baryt auf Gneis in einer Kluft;
Bildbreite 2 cm
|
Tennantit

Metallisch glänzender Erzgang aus gelbem Chalkopyrit und
grauem Tennantit im Gneis, angeschliffen und poliert;
Bildbreite 3 cm
|
Olivenit
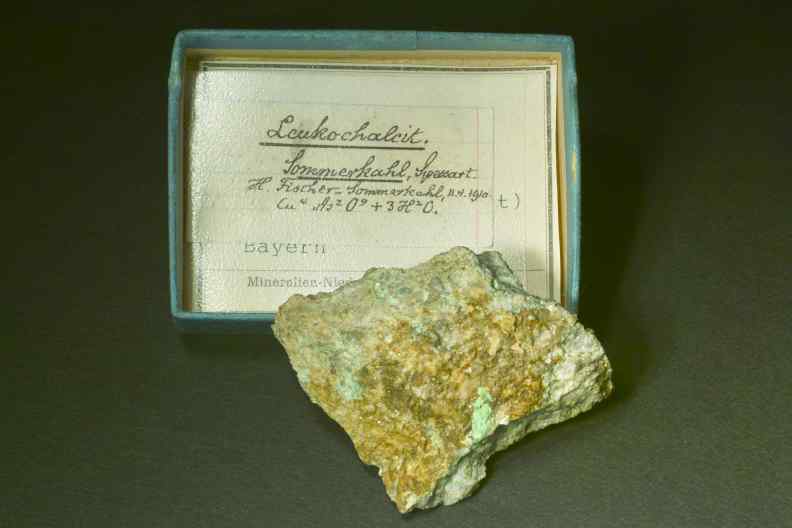
Sammlungsstück eines Olivenit (alt "Leukochalcit" ), etwa
aus dem Jahr 1910, mit alter Schachtel und dem Zettel der
Mineralien-Niederlage Freiberg in Sachsen;
Bildbreite 12 cm
|
Ankerit

Brauner, leicht angewitterter Ankerit mit weißen Baryt als
Kluftfüllung;
Bildbreite 2 cm
|
Dolomit

Hellbraune, rhomboedrische Dolomit-Kristalle aus einem
Erzgang;
Bildbreite 2 cm
|
Hämatit

Metallisch glänzender Hämatit als tafelige Kristalle in
einem Gang im Gneis, angeschliffen und poliert;
Bilbreite 3 cm
|
Calcit

Höhlenperlen aus Calcit. Sie stammen aus dem
"Perlenstollen", einer Blindstrecke im nördlichen Teil des
Bergwerkes;
Bildbreite 5 cm
|
Tangdanit

Grünlicher Tangdanit (früher "Klinotirolit") in blättigen
Aggregaten neben Quarz und Azurit in einer Kluft;
Bildbreite 5 mm
|
Jarosit

Brauner, erdiger Jarosit als dünner Belag mit Goethit aus
dem östichen Teil des Bergwerks;
Bildbreite 2 cm
|
Eis

Eis (besonders im Winter und stellenweise mit Cu-Sulfaten
gefärbt), aufgenommen am 04.01.2002;
Bildbreite ca. 45 cm
|
Calcit

Calcit als meist weiße bis braune, aktive Sinterbildungen
von einigen cm Größe in den Strecken, aufgenommen am
24.07.2004;
Bildbreite ca. 7 cm |
Bornit
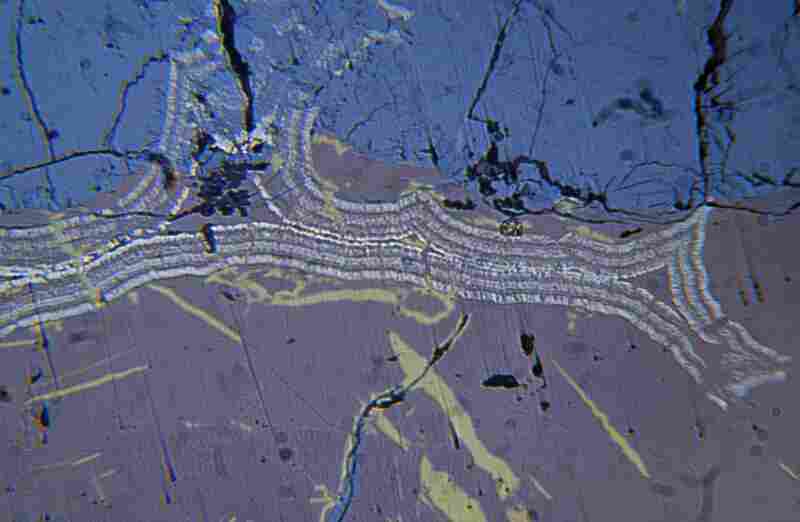
Bläulicher Tennantit, grauer Bornit, weißgelber Pyrit und
gelber Chalkopyrit als Verdrängung, (Erzanschliff);
Bildbreite ca. 2 mm
|
Diegenit
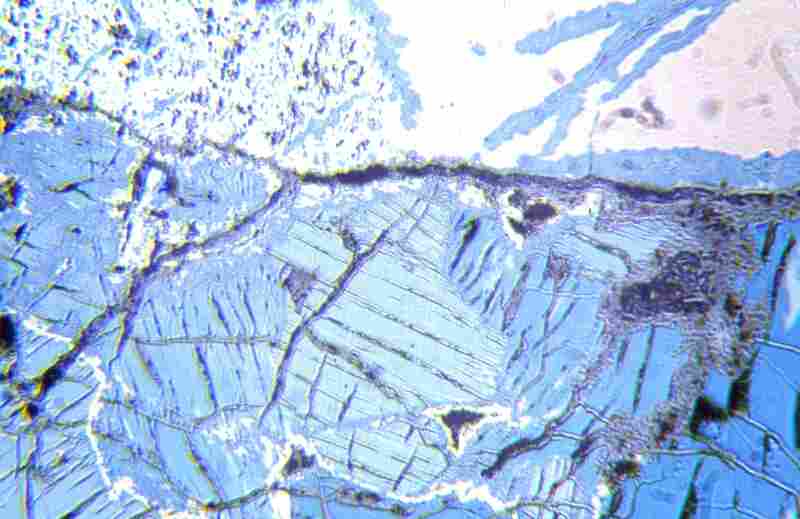
Bläulicher Diegenit mit dünnen Schrumpfrissen,
Erzanschliff;
Bildbreite ca. 2 mm
|
Bornit
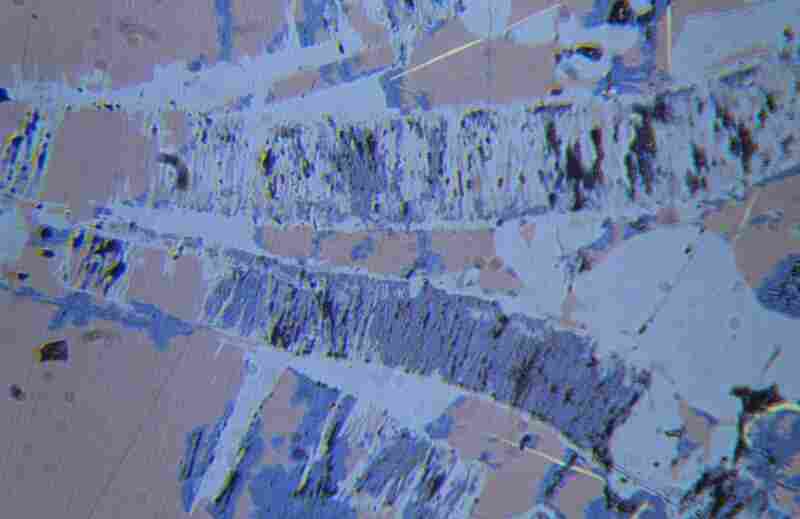
Verschiedene Kupfersulfide als Relikte im Borit. Das Foto
zeigt die Komplexität der kleinen Lagerstätte,
Erzanschliff;
Bildbreite ca. 2 mm
|
Covellin
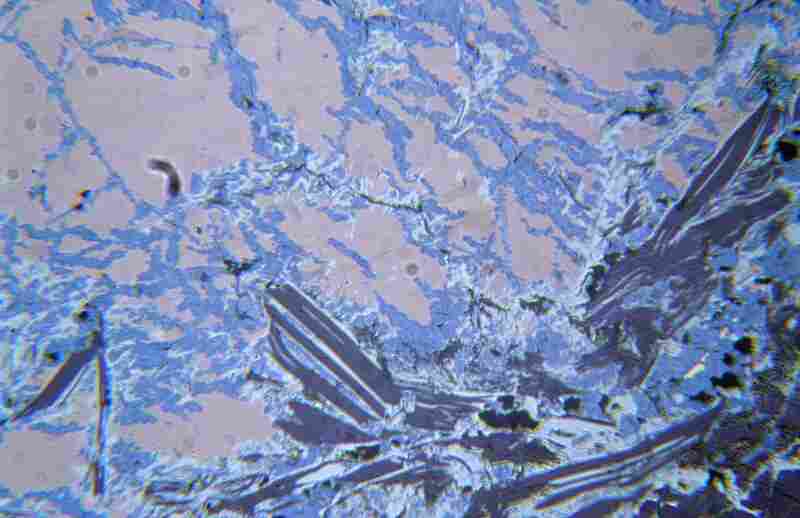
Bläulicher Covellin im Bornit mit aufgeblätterten
Glimmeraggregaten aus dem Gneis, in dem die Erzgänge
auftreten, Erzanschliff;
Bildbreite ca. 2 mm
|
Tenorit
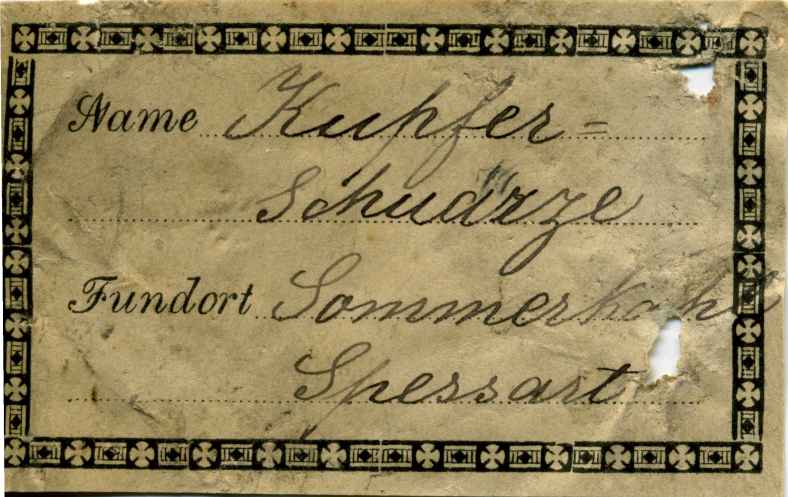
Sammlungszettel aus Papier mit der Aufschrift
"Kupferschwärze" (vermutlich Tenorit) aus Sommerkahl.
Leider ist das zugehörige Stück verschollen;
Bildbreite 6 cm
|
Tennantit
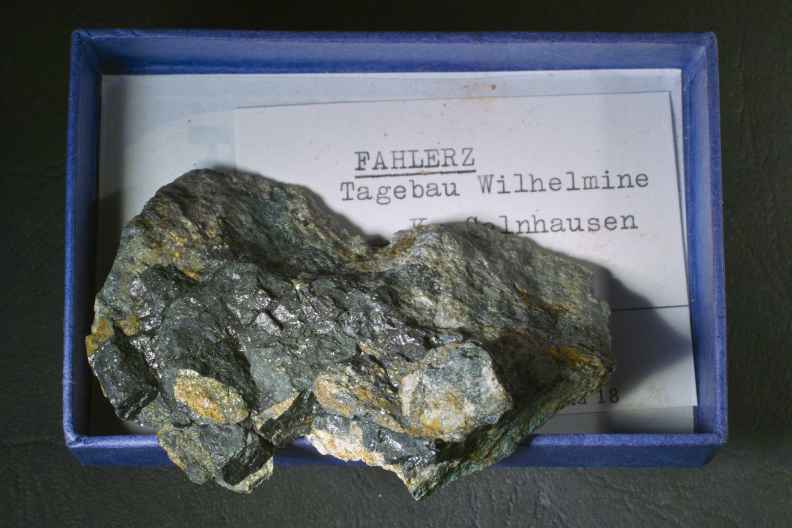
Stück Gneis mit einem Teil eines cm-mächtigen
Fahlerzganges (Tennantit) ohne nennenswerte
Mineralneubildungen aus einer Sammlung, die vor 1970
beendet wurde;
Bildbreite 10 cm
|
Azurit

Blaue, dünne Schicht aus Azurit zusammen mit grau und
glänzendem Manganoxid als Neubildung in den
Ausbruchsmassen, die im Bergwerk während der letzten
Betriebsperiode deponiert worden sind;
Bildbreite 10 cm
|
Azurit
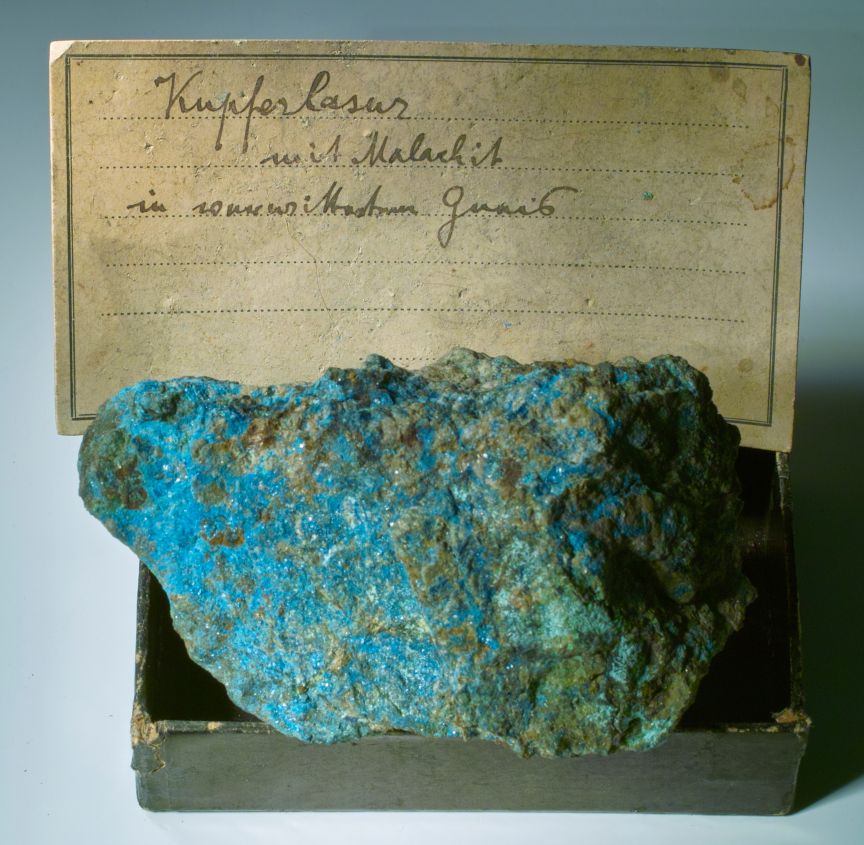
Altes Stück mit einem Zettel: "Kupferlasur mit Malachit in
verwittertem Gneis" in einer schwarzen Pappschachtel;
Bildbreite 11 cm
|
Tennantit
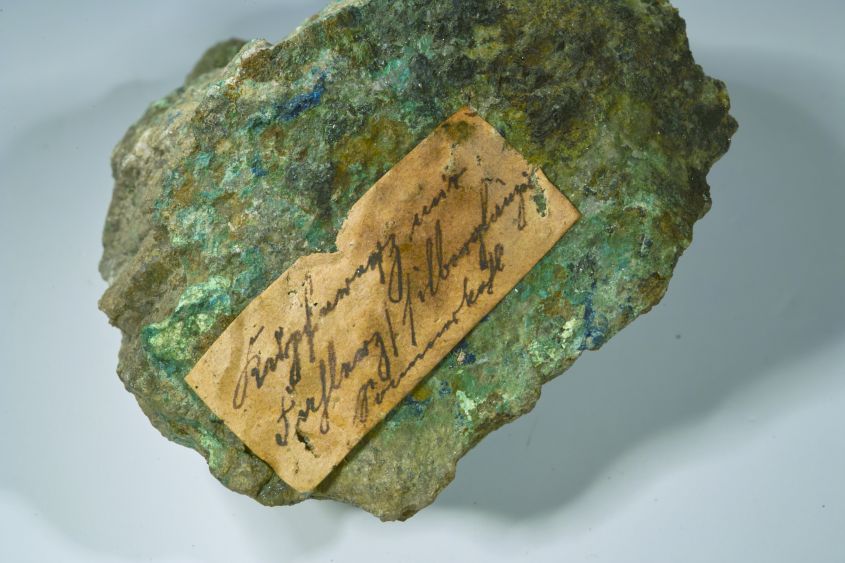
Stück Gneis mit Fahlerz und sekundären Kupfermineralien,
darauf ein aufgeklebter Zettel mit der
Aufschrift: "Kupfererz mit Fahlerz / Silberglanz
Sommerkahl". Der Silberglanz ist sicher nicht enthalten -
vermutlich ist das ganz frischer silbrig glänzender
Tennantit gewesen;
Bildbreite 7 cm
|
Chalkopyrit
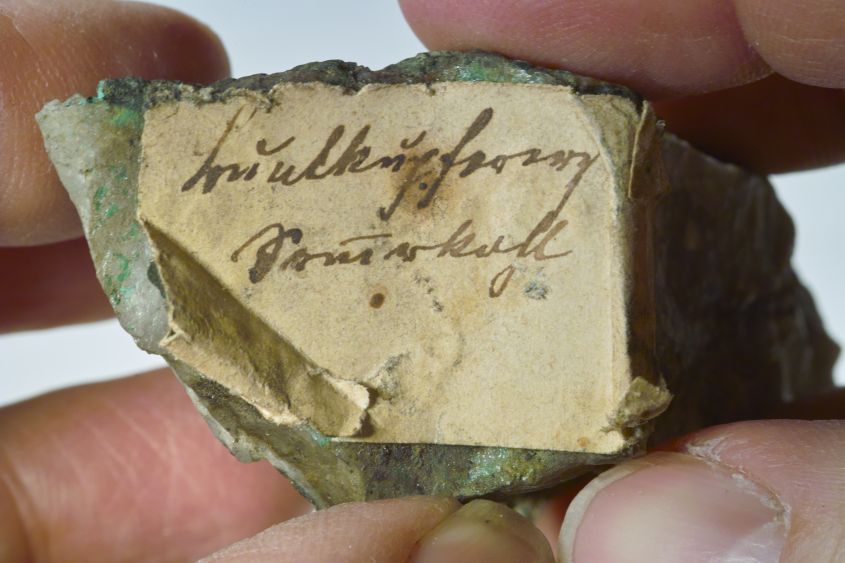
Stück Quarz mit darin kleinen Fahlerz- und Bornit-Gängchen
und einem aufgeklebten Zettel mit der handschriftlichen
Aufschrift: "Buntkupfererz Sommerkahl". Das Stück stammt
aus einer alten Lehrsammlung eines
Gymansiums und zeigt, dass bereits um 1900 solche Stücke
zu Ausbildungszwecken genutzt wurden;
Bildbreite 5 cm
|
Weitere Fotos finden Sie hier. Alle
Mineralien wurden bereits beschrieben und veröffentlicht (LORENZ
& SCHMITT 2005, LORENZ 2010, LORENZ 2021).
Die Mineralneubildung und Mineralumbildung findet stellenweise
heute noch statt. Die wahrscheinlich im Jura gebildeten Sulfide
(siehe oben) werden von den auf den Gesteinsklüften zirkulierenden
Wässern unter dem Sauerstoff der Atmosphäre oxidiert. Dabei bilden
sich saure Lösungen die reich an Schwermetallen wie Cu und As
sind. Diese reagieren mit den löslichen Gesteinsbestandteilen zu
Sulfaten wie z. B. den verbreiteten Gips (der meist nur lose
aufsitzt und schnell abfällt). In Gegenwart von Arsen und/oder
Kupfer entstehen die nahezu allgegenwärtigen blaunen und grünen
Krusten.
Hinzu kommen sicher noch weitere Phasen, wenn die komplexen
Untersuchungen (mittels Röntgendiffraktometrie, Mikrosonde,
Erzanschliffen usw.) fortgeführt werden. Wenn Sie - d. h.
der Leser dieser Zeilen - Mineralien kennen oder gar haben, die
hier nicht aufgeführt sind, dann bitte ich um Mitteilung oder noch
besser um ein Belegstück zur sicheren Analyse.
Besucherberkwerk
Mit der Gründung des Födervereines wurde im Jahr 2000 der Beginn
zu einem Besucherbergwerk gestartet. Erschlossen wurde zunächst
die 23-m-Sohle mit einer Ausdehnung der Strecken von ca. 400 m für
Besucher. Inzwischen wurde mit den Aufwältigungsarbeiten begonnen
und ein neuer Eingang geschaffen:

Unter tatkräftiger Hilfe von Franz HÖRANDL (*1936
†2020) und
weiterer Mitglieder des Bergwerksvereins
wurde der größete Teil der innen liegenden
Gesteinsmassen aus dem Berg gefahren. Der größte
Teil aber mit der Schubkarre,
aufgenommen am 02.03.2002
Infolge der Nässe sind die Erze weitgehend korrodiert und
stellenweise von rezenten und schlecht kristallinen Bildungen
überkrustet. Die frischen Massen sind durch einen roten Ton so
verschmutzt, dass man innen auch infolge der schlechten
Beleuchtung nur an einer Stelle etwas von den Erzen erkennen kann.
Im April 2005 wurde ein weiterer Stollen der tieferen Sohle
freigelegt und das Wasser in den Stollen bzw. Schächten gesümpft.
Dabei konnten weitere, bisher nicht bekannte Stollen und Gänge wie
auch Schächte gefunden werden. Dazu musste der darüber stehende
Container umgestellt werden. Langfristig soll hier der Eingang zum
Bergwerk über ein größeres Bauwerk erschlossen werden.
Nahebei kam es zu einem kleinen Tagebruch neben der
Wilhelminenstraße, der wieder verfüllt wurde.
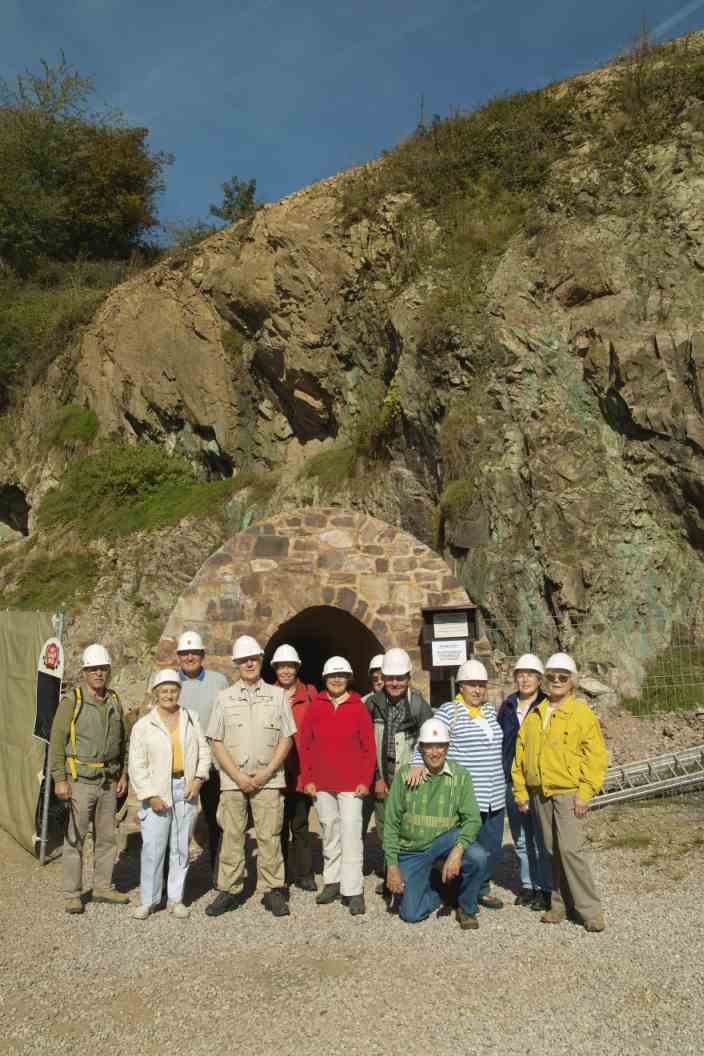
Gruppe des Seniorenbüros Hanau vor der
Besichtigung des Bergwerkes am 22.09.2007
unter Leitung von Otto F. KRONEISEN (*1939
†2018) nach
einer geologisch-bergbaukundlichen
Wanderung von Schöllkrippen, welches man
mit dem Zug erreichte.
2006 und 2007 wurden Pläne geschmiedet, über den heute als offene
Wasserstelle vorhandenen, früheren Eingang ein Info-Gebäude zu
errichten, welches den Zugang zum Bergwerk als auch
Ausstellungsräume in Verbindung mit dem Naturpark Spessart
schaffen würde. Die Kosten dafür sind entsprechend hoch und kaum
vom Verein alleine zu erbringen.
2011 durchliefen das Bergwerk etwa 4.000 zahlende Besucher. Der
Bergwerksverein hat 190 Mitglieder, die die Basis für einen
stabilen Fortbestand sind. Inzwischen ist das Infocenter weit
fortgeschritten und der Verein investierte im Jahre 2011 knapp
50.000 € in das markante Bauwerk.
2012 (November) wurde der 5. Barabaramarkt an und im Bergwerk
veranstaltet, bei dem Kunsthandwerker und andere an über 50
Marktständen in einer einzigartigen Atmosphäre ihre Waren und
Dienstleistungen feil boten.
2013 wurde das Infogebäude so weit als möglich fertig gestellt.
2015 konnte das Info-Centers bezogen werden.
2017 wurde die ständige Ausstellung zum Bergwerk eingerichtet, in
dessen Rahmen auch die Mineralien und Gesteine neu aufgestellt
wurden, so dass der Besucher sehen kann, wie ein Erz
aussieht.
2018 musste eine umfangreiche Beraubung in der östlichen Weitung
vorgenommen werden.
2019 wurden die Änderungen aus dem Hauptbetriebsplan
umgesetzt.
2020 war der Bergwerksverein 20 Jahre alt, konnte aber wegen der
CORONA-Restriktionen nicht feiern, was 2021 nachgeholt werden
sollte.
2021 infolge der CORONA-Restriktionen kein Besucher- und
Vereinsbetrieb
2022 finden wieder Befahrungen mit Besuchern statt. Der sonst
jährliche Barbara-Markt wurde wegen der immer noch vorhandenen
Angst um die schwer planbaren CORONA-Einschränkungen abgesagt.
2023 läuft der Normalbetrieb. Es werden weitere Erkundungen im
Bergwerk vorgenommen und der Barbara-Markt wird vom 25.-26.11.2023
veranstaltet.
Kupferbergwerk
Grube Wilhelmine 2000 e. V.
Wilhelminenstr. 67
63825 Sommerkahl
Tel.: 0 60 24/63 56 60 (nur
während der Öffnungszeiten bzw. Führungen)
http://www.Bergwerk-im-Spessart.de

Das Foto stammt von 17.04.2004 und zeigt noch das ursprüngliche
Aussehen der Felswand an der Wilhelmine.
Im Winter 2005/2006 wurde begonnen, die westliche Seite des
Bergwerkes zu sichern. Die dorthin führende Strecke wurde
ausgemauert. Seit März 2006 wurde begonnen, die hier eingefüllte
Versatzmassen auszuräumen. Das dabei zu Tage geförderte,
grobstückige Gestein soll zum Mauern weiterer Bauwerke verwandt
werden. Dabei wird auch wieder eine Weitung freigeräumt.
Im Außenbereich ist der Bewuchs über der Wand des Tagebaues von
den Büschen und Bäumen befreit worden, so dass das ursprüngliche,
kahle Aussehen wieder hergestellt wird. 2007 wurde ein überdachter
"Tunnel" als Eingang erbaut, so dass ein sicherer Zugang zu den
Stollen gegeben ist.

Das Foto vom Tagebau mit der "gesicherten" Wand und dem neuen
Eingang stammt vom 01.05.2007.
Es wird noch ein weiterer tunnelartiger Zugang gebaut. Für die
nächsten Jahre wurd geplant, ein größeres Infocenter des
Naturparkes Spessart hier zu bauen. Darin soll auch eine
Ausstellung über die Region eingerichtet werden.
Im Winter 2007/2008 wurde im Bergwerk und außerhalb weiter
gearbeitet. Man trug weitere Teile der Felswand ab und wird das
dabei gewonnene Material zur Sicherung der Wand verwenden.

Blick auf die abgebaggerte Wand am 18.01.2008
Das Material wurde nach Mauersteinen für den 2. Tunnel durchsucht
und dann als Auffüllmaterial im Bereich der Grube verwandt. Leider
führte das oberflächennah gewonnene Gestein nur sehr dünne Tapeten
aus Azurit, die nach dem Trocknen dann nur ganz hellblau leuchten.
Primäre Erze konnten so gut wie nicht aufgesammelt werden. Die
Arbeiten hätten bis zum 1.4. 2008 beendet sein sollen, da hier die
ersten Führungen stattfinden.

So präsentiert sich die Grube Wilhelmine nach den Umbau- und
Sicherungsarbeiten am 11.10.2008.
2010 wurde der Bau des zweistöckigen Hauses mit den Maßen von ca.
12 x 12 und einer Anbindung an den Tagebau begonnen. Darin sollte
es ursprünglich auch eine Ausstellung des Naturparkes Spessart
geben. Der Bergwerkverein hat inzwischen 190 Mitglieder und das
Bergwerk wird jährlich von ca. 5.500 Besuchern besichtigt.


Der wachsende Rohbau des Infocenters am 23.07.2011 und rechts
bereits mit Dach am 10.12.2011

Das fast fertige Besucherzentrum am 30.12.2012

Am 30.05.2014 fand in dem neuen Besucherzentrum die
Jahreshauptversammlung des Vereins statt.


Das weitgehend fertige Infocenter mit dem offenen, im Wasser
stehenden Stollen und darüber das Logo in Stahl,
aufgenommen am 05.12.2015

Ausbruchsmassen aus einem Vortrieb, der 2 Blindstrecken im
östlichen
Teil des Bergwerkes miteinander verbunden hat (Norbert Braun GmbH
2016),
aufgenommen am 10.04.2016

Der Tagebau bei -14°C am 23.01.2017. Da es in den Wochen vor dem
Frost kaum Regen gab, sickert kein Wasser aus und so wachsen nur
sehr wenige Eiszapfen. Der lange Jahre als Provisorium genutzte
Holzbau wurde entfernt und die Ausstellung mit den Mineralien,
Werkzeugen usw. wurde in das neu Haus gebracht.


Am Samstag, den 11. März 2017 wurde im Beisein der politischen
Prominenz die Dauerausstellung im EG des Infocenters eröffnet und
der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Links im Bild erläutert der unermüdlich wirkende Walter HACKEL den
Ehrengästen das Konzept und auch die didiaktischen Finessen des
Infocenters bis zur Lore für die Spenden.
Im rechten Bild spricht Frau Ministerialrätin Christina von
SECKENDORF vom Bayerischen Umweltministerium aus München zu den
Gästen:
Bürgermeister Albins Schäfer, Mitglied des Landtags Peter WINTER,
Landrat Dr. Ulrich REUTER, ex MdL Henning KAUL, Sponsoren aus
Handwerk und Bankenwirtschaft und im Hintergrund die Mitglieder
des Berwerkvereins.


Am Samstag, den 02.02.2019 erfolgte im Rahmen einer kleinen
Feierstunde bei trübem und nasskaltem Wetter die Grundsteinlegung
zum
Besucherbergwerk. Der Bürgermeister Albin SCHÄFER und der der 1.
Vorsitzende Oilver PFAFF fanden sich am Tunnel vor dem Stollen ein
und legten den Grundstein. Die Zeitkapsel wird von einem Sandstein
verschlossen, der mit der Jahreszahl 2000, dem Wappen der Gemeinde
und dem Loge des Vereins verziert ist. Zahlreiche
Vereinsmitglieder wohnten der Grundsteinlegung bei.


Samstag, der 09.03.2019: Ein nicht alltäglicher Anblick vor dem
Bergwerk, denn ein Saugwagen (praktisch ein sehr großer
Staubsauger mit
einem 10-m³-Behälter und hohem Vakuum von der Fa. Umtec in
Alzenau) fördert bis zu faustgroße Steine. Der lange, formstabile
Schlauch
reicht bis zur Weitung (Oberbruch), wo noch einge m³ Versatz aus
der letzten Betriebsperiode (erkennbar an den darin
eingeschlossenen
Hölzern) entfernt werden mussten. Leider fand sich in dem Material
kein Erz, sondern nur dünne Tapeten mit kleinen farblose bis
bräunliche
Gips-Kristallen, daneben etwas rosa Serpierit, schwarzes
Manganoxid, grüner Malachit und ganz selten blauer Azurit. Die
größeren Brocken
wurden mit Schubkarren in eine Mulde gefahren. So konnten unter
der Leitung von Walter HACKEL und mit der Hilfe von 9 Mann in ein
paar
Stunden etwa 4 m³ Versatz aus dem Bergwerk transportiert werden.

Der ganz neue, originalgetreue Nachbau der Schachteinrichtungen
aus der Grube
Wilhelmine zeigt die in Sommerkahl verwandte Technik. Auch im
Schacht im
Bergwerk waren die Einbauten aus Holz, welches aber in den 100
Jahren nicht
erhaltungsfähig war. Nur die beiden, jetzt verrosteten Fahrkörbe
sind erhalten.
Sie wurden am Seil hängend gegenläufig (wie ein Aufzug) betrieben.
Daneben
war ein Teil abgetrennt, in dem sich die Fahrten (Leitern)
befanden, wenn der
Förderkorb nicht betrieben war; so etwas wie ein Notausstieg. Und
im rechten
Teil befand sich die Installation für Strom, Wasser und Druckluft
nochmals
abgeteilt. Über dem Schacht befand sich ein Fördergerüst aus
Stahl, über das
mit Rollen die Seilführung der Förderkörbe erfolgte.
Aufgenommen am 27.09.2020

Winterliche Stille am Besucher-Bergwerk. Der Regen im Januar
sorgte
für das Wasser und der Frost im Februar machte daraus dann die
langen
Eiszapfen, leider ohne Besucher, denn wegen der politischen
CORONA-
Beschränkungen war das Bergwerk seit Monaten geschlossen.
Aufgenommen am 12.02.2021
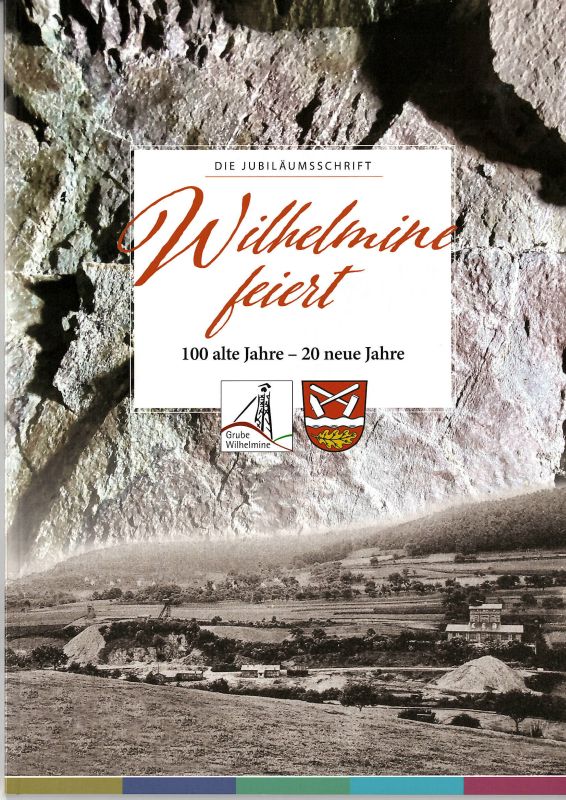
Im Septemberg 2021 erschien wegen den CORONA-
Beschränkungen verspätet die Jubiläumsschrift des
Bergwerksvereins:
Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000 e. V. [Hrsg.]
(2021): Die Jubiläumsschrift Wilhelmine feiert 100 alte Jahre – 20
neue Jahre, 110 S., zahlreiche farb. Abb. [Eigenverlag]
Sommerkahl.
Sie kostet beim Bergwerk 8 €.

Studenten der Universität Heidelberg vom Institute of Earth
Sciences
mit Prof. Dr. Ulrich GLASMACHER bei der Einfahrt in das bunte
Bergwerk der Grube Wilhelmine. Bei der Führung wurde der
Schwerpunkt auf die Geologie und Mineralogie gelegt, wie auch
die komplexe Erzgenese erläutert;
aufgenommen am 29.09.2021.
Seit dem Jahr 2022 veranstaltet der Bergwerkverein auch eine
Reihe von Vorträgen an der Grube. Den Auftakt leistete Walter
HACKEL mit der privaten Raumfahrt.
Am 21.10.2022 war Klaus FREYMANN aus Augsburg zu Gast und
erzählte mit plastischen Bildern in einem modernen Märchen, was
gewesen wäre, wenn man die Grube nicht geschlossen, sondern den
darüber liegenden Kupferschiefer erschlossen und abgebaut hätte.
Am Ende zeigte er, dass tatsächlich große Massen an Metallen wie
Kupfer, Blei und Zink in den permischen Sedimenten unter dem
Sandstein des Buntsandsteins liegen, die man profitabel gewinnen
könnte, wenn der weltweite Preis für diese Metalle einen
bestimmten Wert überschreiten würde.
Am 25.11.2022 hat Joachim LORENZ aus Karlstein über die
Geschichte der Geologie vortragen und dabei beim Neandertaler
anfangen und in der Grube Wilhelmine schließen. Dabei wurde
erläutert, welchen Weg der Erkenntnis man nehmen musste, um das
viel geprüfte, weitgehend schlüssige, aber sehr komplexe
Denkgebäude der heutigen Geo-Wissenschaften zu erreichen.


Links: Der Eingang zum InfoCenter an der Grube mit dem Zugang und
den
Pollern für das ordentliche Parken;
aufgenommen am 31.05.2025.
Rechts: Zum 25jährigen Bestehen des Bergwerkvereins wurde ein
Rückblick in der Form von Tafeln erstellt, bei dem jedes Jahr mit
einer Tafel vorgestellt wird. Die Reihe wird fortgesetzt;
aufgenommen am 29.06.2025.
Hinweis zum Wappen von Sommerkahl.
Das Wappen von Sommerkahl stammt aus dem Jahr 1972 und zeigt u. a.
gekreuzte Schägel und Eisen als typische Bergmannswerkzeuge; es
sind "die" Symbole für den Bergbau schlechthin. Als Begründung
werden die zahlreichen Bergwerke seit 1542 angeführt. In der
Erläuterung von GRIBEL (1972:10f) wird aber von einem "Hammer und
Schlägel" geschrieben. Dies sind keine Werkzeuge der Bergleute,
denn man verwandte den Begriff des Schlägels synonym für den
Hammer. Das Werkzeug mit der Spitze ist ein (Berg-)Eisen, in das
der Bergmann einen Holzstiel steckte. Das war der Meißel des
Bergmanns. Man kann sich gut vorstellen, dass die heutige
Anwendung eines Meißels bei der schlechten Beleuchtung eines
Abbauortes zur Verletzung der Hand geführt hätte. Deshalb
verwandte man kleine Meißel (Eisen) mit einer Bohrung, die den
Holzstiel aufnahm und so waren die Finger vor dem Schwung des
Hammers (Schlägel) geschüzt. In der Regel wurden die Eisen an
einem Ring getragen und wenn alle Eisen stumpf waren, war die
Schicht beendet. Der Bergschmied schärfte dann die Eisen wieder.
Es gibt auch Hämmer in Wappen, aber dies sind dann Hämmer von
Orten mit Steinhauern oder Hammerwerken zum Schmieden von Eisen;
dies gab es in Sommerkahl nicht. Die Verwendung von Schlägel und
Eisen auf Wappen in Bergbauorten ist weit verbreitet, denn in
Deutschland gibt es 318 Wappen mit diesen Symbolen (GAPPA 1999:9).

Ein Beispiel für einen Schägel (oben) und das gestielte
Bergeisen darunter. Man erkennt an dem Bart des
Eisensdass es lange benutzt wurde. Sammlung Peter (†)
& Ruth SCHILLING, Schriesheim,
aufgenommen am 29.11.2022
Literatur
Autorenkollektiv (1984): Sommerkahl einst und jetzt - 800 Jahre
Dorfgeschichte -.- Hrsg. von der Gemeinde Sommerkahl, 540 S.,
zahlreiche, auch farbige Abb., [Herbert Bauer] Goldbach.
BRUNSWICK, J. (2023): Sommerkahl: Grube Wilhelmine Ansichtskarten
aus dem Kahlgrund – Teil 33.- Unser Kahlgrund 2024 Heimatjahrbuch
für den ehemaligen Landkreis Alzenau, 69. Jahrgang, S.
128-129, 4 Abb., Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für
Heimatforschung und Heimatpflege Kahlgrund e. V., Alzenau.
BUSCH, R. [Hrsg.] (1999): Kupfer für Europa. Bergbau und Handel
auf Zypern.- 183 S., zahlreiche, teils farb. Abb., 1 ausklappbare
geol. Karte, [Wachholz Verlag] Neumünster.
FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag
zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des
Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,
zahlreiche Abb. im Anhang, Aschaffenburg.
FRIEDRICH, G. H., GENKIN, A. D., NALDRETT, A. J., RIDGE, J. D.,
SILLTOE, R. H. & VOKES, F. M. [eds.] (1984): Geology and
Metallogeny of Copper Deposits. Proceedings of the Copper
Symposium 27th International Geolgical Congress Moscow.- Special
publication No. 4 of the Socitey for Geology Applied to
Mineral Deposits, 592 p., 258 figs., [Springer Verlag] Berlin.
HEIMBÜCHNR, N. (1968): Bergbau im Raum Schöllkrippen.- Spessart
Monatszeitschrift des Spessartbundes. Zeitschrift für Wanderer,
Heimatgeschichte und Naturwissen Heft März 1968 S. 24 - 25, 2
Abb., [Verlag "Main-Echo"Kirsch & Co.] Aschaffenburg.
GAPPA, K. (1999): Wappen - Technik - Wirtschaft Bergbau und
Hüttenwesen, Mineral- und Energiegewinnung sowie deren
Produktverwertung in den Emblemen öffentlicher Wappen Band 1:
Deutschland.- 471 S., Veröffentlichung aus dem Deutschen
Bergbau-Museum Bochum Nr. 76, zahlreiche farbige Wappen,
[Selbstverlag] Bochum.
GRIEBEL, E. (1972): Bergmannswerkzeuge Hammer und Schlägel zieren
Ortwappen von Sommerkahl.- Spessart Monatszeitschrift des
Spessartbundes Zeitschrift für Wanderer, Heimatgeschichte und
Naturwissen, Heft Mai 1972, S. 10 - 11, 1 Abb., [Main-Echo GmbH
& Co KG] Aschaffenburg.
HACKEL, W. (2022): Grube Wilhelmine Sommerkahl: Stollen von
1000-Meter?.- Unser Kahlgrund 2023, 68. Jahrgang, S. 209 - 213, 3
Abb., 1 Tab., Hrsg. Arbeitgemeinschaft für Heimatforschung und
Heimatpflege Kahlgrund e. V. in Alzenau [Gebhard druck+medien]
Heusenstamm.
KRÜNITZ, D. J. G. (1801): Kupfer.- Ökonomisch-technologische
Encyklopedie, oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, und
Haus- und Landwirtschaft, und der Kunst-Geschichte in
alphabethischer Ordnung 55. Theil von Kum bis Kupfer, 850 S., mit
30 Kupertafeln auf 8 3/8 Bogen, [Buchhandl. des königl. Preuß.
Geb., Comission-Raths Joachim Pauli] Berlin.
LFU (Bayerisches Landesamt für Umwelt (2014): Geotope in Bayern
erhalten, pflegen und erleben.- 44 S., zahlreiche farb. Abb.,
Karten, [Joh. Walch GmbH & Co. KG] Augsburg.
LORENZ, J. (2016): Die Grube Wilhelmine in Sommerkahl.- NOBLE
Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 02/2016, S. 80 - 82, 11 Abb.,
[Media-Line@Service] Aschaffenburg.
LORENZ, J. (2021): Die Mineralogie der Grube Wilhelmine – die
komplexeste im Spessart.- S. 71 – 78, 25 Fotos, 1 Tab.- in
Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000 e. V. [Hrsg.]
(2021): Die Jubiläumsschrift Wilhelmine feiert 100 alte Jahre – 20
neue Jahre, 110 S., zahlreiche farb. Abb. [Eigenverlag]
Sommerkahl.
LORENZ, J. & SCHMITT, R. T. (2005): Das Kupfererzbergwerk
Grube Wilhelmine in Sommerkahl.- Spessart Monatszeitschrift für
die Kulturlandschaft Spessart 99. Jahrgang, Heft 2 2005,
S. 1 - 32, 53 Abb., 2 Tab., [Main-Echo GmbH & Co KG]
Aschaffenburg.
LORENZ, J. & HIMMELSBACH, G. (2006): Sommerkahl,
Kupfererzbergbwerk Grube „Wilhelmine“.- S. 310 – 311, ohne Abb. in
KRAUS, W. [Hrsg.] (2006): Schauplätze der Industriekultru in
Bayern, 1. Aufl., 320 S., zahlreiche Abb., [Verlag Schnell &
Steiner GmbH] Regensburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, 220 S., Berlin.
OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1965): Erläuterungen zur
Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5921
Schöllkrippen.- 327 S., [Bayerisches Geolgisches Landesamt]
München. OKRUSCH, M., LORENZ, J. & WEYER, S. (2007): The
Genesis of Sulfide Assemblages in the former Wilhelmine mine,
Spessart, Bavaria.- The Canadian Mineralogist Vol. 45, pp.
723 - 750, 11 fig., 10 tab., Toronto, Canada.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 564ff, 733ff.
LORENZ, J. (2021): Die Mineralogie der Grube Wilhelmine – die
komplexeste im Spessart.- S. 71 – 78, 25 Fotos, 1 Tab.- in
Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000 e. V. [Hrsg.]
(2021): Die Jubiläumsschrift Wilhelmine feiert 100 alte Jahre – 20
neue Jahre, 110 S., zahlreiche farb. Abb. [Eigenverlag]
Sommerkahl.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 54f, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,
Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei
Joh. Walch] Augsburg.
Norbert Braun GmbH (2016): Das Bergwerk im Spessart. Firma Braun
schneidet Gang in die Grube Wilhelmine.- Der Betonbohrer Ausgabe
39 - 2016, S. 38 - 39, 3 Abb., Hrsg. vom Fachverband Betonbohren
& -sägen Deutschland e. V. Darmstadt.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
SLOTTA, RAINER & SCHNEPEL, INGA [Hrsg.] (2011): Schätze der
Anden. Chiles Kupfer für die Welt.- 608 S., Katalog der
Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 8. Mai 2011 bis
19. Februar 2012, Veröffentlichungen aus dem Deutschen
Bergbau-Museum Bochum Nr. 179, sehr zahlreiche, meist
farb. Abb., Tab, Karten und Zeichnungen, [GCC Graphisches Centrum
Cuno GmbH] Calbe.
WEINELT, W. (1984) in WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U.,
STEPHAN, W., STREIT, R. & WEINELT, W.: Oberflächennahe
mineralische Rohstoffe von Bayern Lagerstätten und
Hauptverbreitungsgebiete der Steine und Erden.- Geologica Bavarica
86, 563 S., [Bayerisches Geologisches Landesamt] München.

Schild in der Sammlung von Ruth und Peter SCHILLING, Schriesheim
Kupferbergwerk Fischbach bei Idar-Oberstein

Ein ganz ähnliches, aber deutlich größeres Bergwerk (Grube
Hosenberg) bestand von ca. 1400 bis 1800 in den andestischen
Ergussgesteinen bei Fischbach mit einer einfachen, hydrothermalen
Kupfermineralisation aus Chalkopyrit, Chlakosin, Bornit, Covellin
und Digenit, wohl weitgehend ohne Gangarten. Die Gang- und
Imprägnationslagerstätte wurde in großen Weitungen abgebaut, die
in einem Besucherbergwerk (http://www.besucherbergwerk-fischbach.de)
zugänglich sind. Das Berwerk hat einen ganzen Schatz von
Besonderheiten:
- riesige Weitungen
- mittelalterliche Schrämmspuren
- mittelalterliche Stollen
- farbige Sinter
- anschauliche Präsentation der dort tätigen Menschen
- funktionierendes Nass-Pochwerk
- Aufbereitung mit funktionierendem Schmelzofen
Aber wie in den meisten Besucherbergwerken ist das Kupfer-Erz von
Hand ausgeschlagen worden und so keines mehr zu sehen.

Das funktionsfähige Nasspochwerk in Fischbach mit den laufenden
Wasserrad
und den Gerinnen für den Erztransport als Schlamm;
aufgenommen am 01.03.2009 in Rahmen einer Führung.
Literatur:
WILD, H. W. & BÜHLER, H.-E. (ohne Jahr): Das mittelalterliche
Kupferbergwerk Fischbach (Nahe). Geologie, Geschichte, Gewinnung
und Verhüttung der Kupfererze.- 32 S., 21 teils farb. Abb.,
Förderverein Historisches Kupferbergwerk Fischbach e. V.,
[Prinz-Druck GmbH] Idar-Oberstein.
WILD, H. W. (ohne Jahr): Ein Bergwerk erwacht zu neuem Leben. 30
Jahre Historisches Kupferbergwerk Fischbach.- 174 S., einige farb.
und SW-Abb., Hrsg. vom Förderverein Historisches Kupferbergwerk
Fischbach e. V. [Digitaldruck von Papierflieger Offsetdruck GmbH]
Clausthal-Zellerfeld.
Zurück zur
Homepage oder an den Anfang der Seite
Malachit für das Auge
In den tropischen Klimaten bei sehr reichlich Kupferionen können
sich sehr große Massen (aus denen sich einzelne Stücke bis zu m³
Größe gewinnen lassen) an Kupfermineralien bilden. Beispiele sind
die bekannten Kupferlagerstätten Tsumeb in Namibia, im Ural in
Russland (heute als Vasen und Tischplatten in der Eremitage in St.
Petersbeurg oder im Berg-Institut der gleichen Stadt zu sehen),
Bisbee in den USA und viele andere mehr, wie z. B. aus der
Demokratischen Republik Kongo (Zaire). In letzterem werden in dem
Kupfergürtel von Katanga sehr große Massen an Malachit gewonnen,
die roh oder in Form von Kunstgewerbe aus den Markt kommen. Es
handelt sich um oft konzentrisch-schalige Massen, deren Aufbau an
einen Achat erinnern. In vielen Stücken erkennt man auch
stalagtitische Formen. Der größte Teil stammt aus dem Tagebau von
Mashamba West bzw. der Dikuluwe-Mine im sogn. Di-Ma-Gebiet oder
aus Likasi. Belegstücke finden sich fast in allen Sammlungen. Der
Malachit stammt - wie viele andere sehr bunte Mineralien - aus den
hier sehr großen und tief reichenen Oxidationszonen (auch
"Eiserner Hut", engl. als "gossan" bezeichnet) der Lagerstätte.
abgebrochener
Malachit-Stalagtit

ausgestellt im Museum Karlstein
Bildbreite 7 cm
|
Querschnitt

Bildbreite 7 cm
|
Detail aus der Abb. links

Bildbreite 2 cm
|
Das Stück eines Stalagtiten ist bereits in geologischer Zeit am
unteren Ende abgebrochen (im Foto oben) und die Bruchfläche ist
mit kleinen Malachit-Kristallen überkrustet. Als Beweis, dass es
sich wirklich um Stalagtiten handelt, dienen die immer zentralen
Hohlkanäle, die bis zum Ende bestehen, wie man es von den
Stalagtiten der Höhlen aus Calcit kennt. Das geschliffen und
polierte Ende offenbart einen konzentrisch-lagigen Aufbau mit
unterschiedlich grünen Anwachsstreifen. Die dunklen Streifen
werden von größeren Malachit-Kristallen gebildet, die hellen
Streifen bestehen aus kleinen bis sehr kleinen Kriställchen mit
Hohlräumen ("Poren") dazwischen. Die Oberflächen bestehen aus
kleinen, flachen Malachit-Kristallen.
Das Stück ist gegenwärtig in der "Kupfer-Vitrine" im Museum
Karlstein ausgestellt.