Felsenkeller,
Eiskeller & Bierkeller
im und am Spessart -
die "Kühlschränke" der Brauereien des 19. Jahrhunderts.
von Joachim Lorenz, Karlstein
a. Main

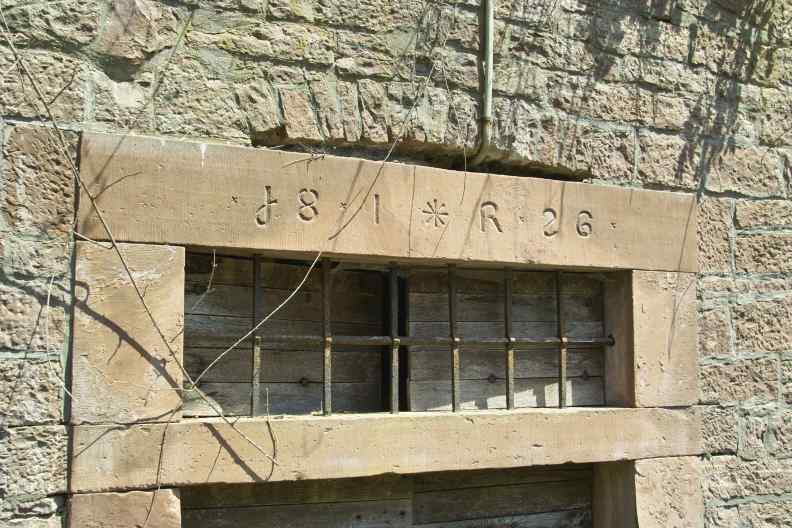
Felsenkeller bei Langenprozelten an der Straße zum
Pumpspeicherwerk, gegenüber dem Sägwerk Grötsch. Im Türsturz aus
dem
örtlichen Buntsandstein unter dem Entlastungsbogen ist die
Jahreszahl 1826 eingeschlagen,
aufgenommen am 16.07.2010.

Geheimnisvoll und ohne Beleuchtung:
Der Eis- und Bierkeller unter der Gaststätte "Zum Neuen Brauhaus
1816" in Marktheidenfeld aus dem Jahr 1811 im Unteren
Buntsandstein aufgefahren und
durch tragende Gewölbeausmauerungen (Bögen) verstärkt; der
Sandstein ist hier am Berghang reich an Klüften,
aufgenommen am 15.06.2014
Das Kühlen von Speisen und Getränken war vor der
Erfindung des Kühlschranks ein großes Problem. Man behalf
sich mit zahlreichen Techniken wie Pökeln, Einsalzen, Gären,
Reifen, Einkochen, Räuchern, Trocknen, Eindosen, usw. Aber
all diese Verfahren beeinflussten den Geschmack und die
Konsistenz der Nahrungsmittel nicht unerheblich - oft
unerwünscht.
In der Neuzeit begann man das Eis des Winters einzulagerm, so dass
man es auch im Sommer zum Kühlen verwenden konnte. Die
ersten Lagerstellen waren Eismieten, in denen unter Stroh
und Torf Eis gelagert wurde. Daraus entwickelten sich die
Eiskeller und auch Kühlhäuser, die es bis in das erste
Drittel des 20. Jahrhunderts gab. In Norddeutschland wurde
der Eisbedarf teilweise damit gedeckt, in dem man
Gletschereis aus Norwegen improtierte!
Seit dem Jahr 1805 ist Eis eine Handelsware, in dem man
aus den Neuenglandstaaten natürliches Eis in die Karibik
verschiffte (BÜSCHER 1942:67ff). In Nordamerika wurde Eis
aus Labrador mittels Schiffen um die Welt verfrachtet und
mit erheblichem Gewinn bis nach Bombay, Madras, Calcutta
(Indien) und Canton (China) verhandelt (LEONHARD
1845:188). Die in Stroh und Sägespäne verpackten Eisblöcke
überstanden den Transport und die Nachfrage und damit die
Preise waren wohl so hoch, dass sich die weiten Reisen
lohnten.
Das Eis wurde im Winter in Seen, Teichen und Flüssen
kollektiv mit viel Aufwand gewonnen und dann zerstoßen in
die Keller eingelagert. Ersatzweise wurde auch Schnee
verwandt - oder man ließ Wasser über Gestelle laufen
(FAUST 2004:45 mit Abb.) und hackte das gefrorene Wasser
ab und lagerte es ein. Das Eis brauchten nicht nur in
Brauereien, sondern es wurde auch in Meiereien
(Milchwirtschaften), Metzgereien, Apotheken und
Krankenhäusern benötigt. Das Eis wurde als wertvolle Ware
gehandelt und kam auch in die Haushaltungen, wo man es in
Kühlkisten verwandte. Die Verwendung als Speiseeis spielte
mengenmäßig keine Rolle. Eine Abgrenzung der Kellertypen
ist nicht einfach, da es zahlreiche Formen gibt (LÜTGERT
2000).
Die Regierung von Bayern propagierte 1865 die Anlage von
Eiskellern (eigentlich Eismieten) nach amerikanischem
Vorbild wie man in einem Beitrag mit Zeichnung im
Königlich-Bayerischen Kreis-Amtblatt von Unterfranken und
Aschaffenburg nachlesen kann. Der Grund waren umfangreiche
Maßregeln gegen die asiatische Cholera.
Insbesondere für die Reifung und anschließende
Lagerung von Bier, Apfelwein und Wein waren dunkle, kühle und
gleichmäßig temperierte Lager notwendig. Aus der Tradition vom
Wein richtete man Keller (auch als Bierkeller,
Lagerkeller oder Kunstkeller bezeichnet)
ein, die dort, wo standfester Fels vorhanden war, in diesen
angelegt worden sind. Dabei bediente man sich der Erfahungen
aus dem Bergbau. Dass sich die kalte Luft in den Räumen hielt,
wurden die Keller eingetieft. Dort wo die Standfestigkeit
nicht gewährleistet war, sicherte man mit Gewölben zusätzlich
ab. Die meisten Felsenkeller wurden von den einst vielen
kleinen Brauereien angelegt. Diese Keller wurden auch als
Eiskeller bezeichnet, da in ihnen das winterlich eingelagerte
Eis ganzjährig überdauern konnte.
Der Sinn liegt in der hohen Isolationswirkung der meist
meterdicken Felsen oder Erde. Dies führt dazu, dass die
Lufttemperatur - wie in den Bergwerken ganzjährig und ohne
große Schwankung - etwa bei 8 - 12° C liegt. Da es auch keine
oder nur eine geringe Bewetterung (Belüftung) gab, wurde auch
darüber keine Wärme eingetragen. Wird dazu mit Eis weiter
gekühlt, so sind noch tiefere Temperaturen über einen langen
Zeitraum möglich. Besonders bei großen Kellern mit mehr als 60
m³ Eisvolumen konnte das Eis über den ganzen Sommer entnommen
werden.
Für einen eissparenden Betrieb ist in den Räumen eine
Ventilation erfoderlich, der die Luftfeuchte berücksichtigt
und eine trockene Kälte in den Räumen erhält. Damit war auch
ein Betrieb mit Natureis in Konkurrenz mit dem Kältemaschinen
möglich (STAHL 1908).
Mit der Anlage von tiefen Kellern ohne
einen größeren Abflussquerschnitt für die Gase wurde aber
einen neue Gefahr herauf beschworen: das bei der Gärung frei
werdende Kohlendioxid (CO2)
sammelt sich im tiefsten Teil und wird aufgrund des höheren
Gewichts nicht aus den Räumen entfernt, so dass unter
Umständen ein Ersticken möglich war - trotz einer Lüftung
mit einem Kamin nach oben. Aus diesem Grund nahm man Kerzen
oder eine ähnliche Beleuchtung mit und konnte mit Erfahrung
beim Schwächer werden des Lichtes oder gar beim Verlöschen
der Flamme die hohe Konzentration des CO2 bzw.
den daraus resultierenden Sauerstoffmangel erkennen. Dabei
kommt es auch heute noch immer zu Gärgasunfällen, weil die
Kerze dafür ungeeignet ist und erst bei einem CO2-Gehalt
in
der Luft von etwa 14 % erlischt, aber die für den Menschen
tödliche Konzentration bei etwa 9 % liegt; hierbei tritt der
Tod innerhalb von 5 bis 10 Minuten ein. Das tragische daran
ist, dass man mit den menschlichen Sinnen das Kohlendioxid
nicht wahrnehmen kann und die Konzentration gegen den Boden
weiter zunimmt. Somit fällt der Mensch, nachdem er
bewusstlos geworden ist, zu Boden, wo die Konzentration noch
höher ist als beim Stehen im Kopfbereich. Ohne weitere Hilfe
ist der Tod dann nicht zu verhindern. Der Tod ist für den
Betroffenen schmerzlos, denn er ist ja ohne Bewusstsein. Oft
kommt es dann tragischen Folgeunfällen, denn die die
denjenigen sehen, ahnen nichts von dem tödlichen Gas und
versuchen zu helfen und liegen dann daneben. So wurden schon
ganze Familien - besonders in Landwirtschaften und Silos -
ausgelöscht.
Die Luftschächte in den Kellern hatten den Sinn, die Keller
im Winter zu trocknen und auch durch die Ventilation während
des Frostes zu kühlen, so dass man das Eis in einen
vorgekühlten Keller lagern konnte. Das Trocknen
funktionierte so, dass bei einer Außentemperatur von weniger
als 0° C die mit 8 - 12° C "warme" Luft des Kellers nach
oben stieg und über die Luftschächte abströmte. Gleichzeitig
konnte die Kaltluft über den Eingang nachströmen und so den
Keller auskühlen. Gleichzeitig wurde der Keller trocken, da
die warme Luft die Feuchte austrug und die kalte Luft kaum
Feuchtigkeit eintrug (je kälter dass es ist, um so weniger
Wasser kann die Luft binden; bei -10° C ist praktisch kein
Wasser mehr in der Luft und das empfindet auch der Mensch
als angenehmer, denn die trockene Luft isoliert besser). In
einem trockenen Keller bleibt das Eis länger erhalten als in
einem nassen Keller!
Infolge der örtlichen Gegebenheiten kann man
unterscheiden:
- Felsenkeller, d. h. der Raum ist in den standfesten Fels
getrieben worden (selten)
- Gewölbekeller, ein Raum im Fels mit einer Überdeckung aus
einem Gewölbe aus Bruchsteinen (häufig)
- Eismieten (lokal auch als "Strohtempel" bezeichnet) und
Eisgruben
- ehemalige Stollen von Bergwerken
- Keller für den Luftschutz im 2. Weltkrieg
- Eishäuser (im Spessart keine bekannt)
- (Erdställe)
Der Name weist auf die Verwendung oder die Bauweise hin. Es
gibt auch alle denkbaren Varianten, d. h. der Keller ist in
örtlichen Fels geschlagen, aber wegen mangelnder Standfestigkeit
mit Steinen überwölbt.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur Felsen- und
Gewölbekeller, besonders zur Kühlung von verderblichen Waren. In
vielen Fällen baute man dann bei hoch belasteten oder feuchten
Kellerdecken die preußische Kappendecke, die erst ab etwa 1930
von der Betondecke aus Ortbeton oder Systemdecken ersetzt. So
haben alle unterkellerten Häuser aus der Zeit vor etwa 1850
einen Gewölbekeller. Infolge der begrenzten Möglichkeiten
bestehen diese Keller meist aus einem Raum und sind nur von
außerhalb des Gebäudes zu begehen.
Diese Keller sind meist nicht sehr groß (etwa ca. 15 m
lang, 6 m breit und ca. 4 m hoch; aber in Ausnahmefällen auch 50
m lang! Als Kette von Kellern können auch 100 m erreicht werden,
z. B. in Miltenberg), da die Herstellung von Hand erfolgte und
das Abbauen des Felses einen erheblichen Aufwand darstellte. Als
zusätzliches Kühlmedium wurde Wassereis eingebracht. Das Eis
wurde über und zwischen den Fässern eingebacht, so dass der
Keller einen winterlichen Eindruck machen konnte. Zur weiteren
Isolierung wurde das Eis auch mit Stroh, Torf oder Sägespänen
überdeckt. Die Gewinnung des Eises erfolgte im Winter bei
strengem Frost, in dem man aus den Teichen, Seen, Bächen oder
Flüssen das Eis heraussägte und dann in den Kellern einlagerte.
In einigen Fällen wurden dafür in der Nähe Eisteiche angelegt,
so dass der Transport über keine großen Strecken erfolgen
musste. Das Tauwasser musste über die Klüfte versickern oder
einen Abfluss ablaufen können.
Merkwürdig ist, dass die Mehrzahl der von mir eingesehenen
Keller Treppen als Zugang sowohl für Menschen als auch für das
Lager- und Kühlgut haben. Dies bedeutet, dass man den gesamten
Umschlag mühevoll über die Treppen schleppen bzw. rollen musste.
Es ist aus heutiger Sicht unverständlich, warum man keine Rampen
oder sowas ähnliches zur Beschickung baute. Oder Öffnungen in
der Decke, so dass man das Lagergut mit einer Haspel, einem
Flaschenzug oder gar einem Kran herausziehen
konnten.
Mit dem Aufkommen der Kühlanlagen nach der Erfindung von
Carl LINDE (*1842 †1934)
ist die Notwendigkeit als Brauerei einen Felsenkeller zu
haben, zurück gegangen. Der Erfinder ließ bei der
Maschinenfabrik Augsburg (heute MAN SE) ab 1871 Kältemaschinen
bauen. Mit einem Patent auf die Ammoniak-Kältemaschinen 1876
ließ er einfache und sehr wirtschaftliche Kühlanlagen bauen,
die von den Brauereien sehr gut aufgenommen wurden. Daraus
entstand die heutige Linde AG. Mit den Kühlanlagen war man in
den Brauereien unabhängig vom winterlichen Eis (aber abhängig
vom elektrischen Strom), welches nicht in jedem Winter in
ausreichender Menge zur Verfügung stand (es gab auch im 19.
Jahrhundert milde Winter, so 1862/63, 1883/84). Dies war das
langfristige "Aus" für die teuren Felsenkeller. Der Boden der
meisten Keller waren nicht befestigt, die Wände nicht verputzt
oder gar angestrichen.
Viele bestehende Keller waren für eine wachsende Logistik zu
klein und deshalb wurden die nicht mehr gepflegt und oft
einfach zur Sicherheit verschüttet, vergittert oder
zugemauert. Insbesondere der Bewuchs über den Kellern
gefährdet die Standfestigkeit der Decken, da die Wurzeln über
Risse in die Hohlräume wachsen. Bei einer Windlast werden die
enormen Kräfte (Hebelwirkung der Bäume!) in die Felsen immer
wiederholend eingeleitet, was über lange Zeit zu einer
Lockerung des Gesteinsverbandes führen kann.
In manch modernem Haus wurden solche Keller nachgebaut oder
nachgeahmt, in dem man einen Kellerraum außerhalb des
eigentlichen Hauses - z. B. unter der Terrasse - vom restlichen
Keller thermisch abtrennt und einen Boden aus Lehm stampft oder
Hochlochziegel lose einlegt. Die hohe Feuchtigkeit und die
niedrige Temperatur eingnet sich auch heute noch hervorragend
zum Einlagern von Lebensmitteln wie Getränke, Obst und/oder
Kartoffeln.
Die Tradition der Felsenkeller ist in Deutschland, Österreich
und der Schweiz weit verbreitet. In den großen Städten und
berühmten Brauorten gab es riesige Felsenkeller, wie z. B. in
Erlangen, Bamberg, Mendig (Eifel), Saarbrücken, Mainz usw. Die
außerhalb der Ortslagen erbauten Keller haben kein elektrisches
Licht und müssen wie früher von Hand beleuchtet werden. Neben
der Nutzung für Fledermäuse erfolgt in den meisten Fällen eine
gastronomische Verwendung als Gaststätte, Vinothek, Weinkeller
oder für besondere Veranstaltungen. Viele Gaststätten führen den
Namen "Felsenkeller". Und die Straßennamen weisen auf
Felsenkeller hin - siehe unten.
Nun könnte es zu einer Renaissance der Eiskeller kommen.
Nach den mündlichen Ausführungen von Cornelius FAUST (am
23.01.2015) vom gleichnamigen Brauhaus zu Miltenberg wird
gegenwärtig erprobt, wieder Wassereis zum Kühlen des Biers zu
verwenden. Die Technologie liefert der Skisport: Die
Schneekanonen! Damit kann man leicht bei geeignetem Wetter und
schon bei geringem Frost beliebig große Mengen an Eis erzeugen,
welches in den Wintermonaten zur Kühlung des Biers verwendet
werden kann, so dass man erhebliche Stromkosten einsparen kann,
denn die Kosten für des Wasser und die Pumpen sind geringer als
die Strom- und Betriebskosten einer ständig laufenden
Kühlanlage.
Mit der Erfindung der Eismaschine von Carl LINDE wurde das
Eis zunehmend künstlich erzeugt. Dabei gab es verschiedene
Qualitäten:
- Kunsteis aus gewöhnlichem Wasser
- Klareis aus Brunnenwasser
- Krystalleis aus destilliertem Wasser
Nachdem die Maschinen wirtschaftlich und wetterunabhängig
arbeiten konnten und die Energie zum Betrieb immer billiger
wurde, wurden ganze Eisfabriken gebaut und betrieben. Eis war
weiterhin eine Handelsware. Erst mit dem Aufkommen der
elektrischen Kühlschränke in allen Haushalten am Ende des
Wirtschaftswunders in den 1960iger Jahren wurde das Eis als
Kühlmedium abgelöst. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es
kein örtliches Fest ohne Stangeneis von einer Brauerei zum
Kühlen der Getränke und Lebensmittel gab.

Kühlschrank, der ohne Strom, aber mit Eis betrieben wurde. Es ein
mit Zinkblech
beschlagener Holzschrank, dessen Kühlleistung durch das Einlegen
von Eis erbracht
wurde. Das Möbelstück steht im Heimatmuseum in Eisenbach
(Obernburg),
aufgenommen am 02.02.2020
In der 6. Auflage des Meyers Konversations-Lexikon von 1906,
5. Band, S. 476 ist eine Tabelle angeführt, aus der man ersehen
kann, wie viel Eis man zum "Betrieb" eines solchen Kühlschrankes
braucht. Je nach Außentemperatur liegt der Eisverbrauch bei 5
bis 10 kg Eis pro Tag, was sich bei einer "normalen" Nutzung auf
1.200 bis 1.750 kg pro Jahr summiert. Dieser Bedarf kann kaum
aus einem Eiskeller gedeckt werden, so dass hier Eis zugekauft
werden musste. Und das war dann richtiger Luxus, solche Massen
an Eis auch im Sommer beziehen zu können.
In folgenden Orten des Spessarts sind mir Felsenkeller
und markante Gewölbekeller bekannt oder erhalten. Bei einigen
Bauwerken dieser Art erschließt sich der Sinn oder die
Verwendung heute nicht mehr:
- Alzenau: "Funke-Keller", an der Hanauer Straße 90,
bestand ein Gewölbekeller aus Sandstein, der lange als
Wein-Bistro genutzt und Ende 2017 abgebrochen und verfüllt
wurde.

Die Brauerei Stein besaß einen Eiskeller, der mit Eis von
einem Weiher unterhalb der Burg beschickt wurde. Aus ihm
konnte man ganzjährig Eis holen. Der Keller ist mit dem Abriss
der Brauereigebäude 1992 zerstört worden (Foto vom
21.12.1992). Ich kann mich noch an die zahlreichen dünnen
Tropfsteine an der Decke erinnern.
Die Brauerei stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, als
Brauerei Stein aus dem Jahr 1876. Die Keller werden erstmals
1906 erwähnt. Die Eisweiher zur winterlichen Eisgewinnung
befanden sich unterhalb der Weinberge in Wasserlos (STRAUSS
2025:72ff).
Einen weiteren Felsenkeller - für den Luftschutz - besteht
beim Geschäft Musik-Alt an der Märkerstraße (mündl. Mitteilung
Frau SEHRING vom Geschichtsverein Alzenau am 01.04.2013).
 Aschaffenburg: Neben Bier- und
Eiskellern werden Gewölbekeller auch heute noch genutzt, so
zum Beispiel der Weinkeller unter dem Hotel Wilder Mann in
Aschaffenburg. Das Gebäude verfügt über zusätzlich einen
großen und einen kleinen Gewölbekeller, die aufgrund der
Bauart nur schwer zeitlich eingestuft werden können.
Aschaffenburg: Neben Bier- und
Eiskellern werden Gewölbekeller auch heute noch genutzt, so
zum Beispiel der Weinkeller unter dem Hotel Wilder Mann in
Aschaffenburg. Das Gebäude verfügt über zusätzlich einen
großen und einen kleinen Gewölbekeller, die aufgrund der
Bauart nur schwer zeitlich eingestuft werden können.
Felsen- bzw. Gewölbekeller bestanden an und unter den
zahlreichen Brauereien, darüber hinaus auch an der Bergmühle
in Damm - diese Keller wurden auch während des 2. Weltkriegs
als Luftschutzkeller genutzt, wie aus mündlichen Schilderungen
überliefert ist. Der Keller ist nicht mehr zugänglich.
Unter dem Schloss Johannisburg sind große Weinkeller als
Gewölbekeller eingerichtet, die heute noch genutzt werden.
Weitere Keller der Vorgängerburg sind wohl noch vorhanden,
aber unzugänglich.
In der Aschaffenburger Oberstadt konnten bisher 79
Kelleranlagen dokumentiert werden. Der kleinste Einzelkeller
ist 4,8 m³ groß, die größte Kelleranlage besteht aus 16 Räumen
mit zusammen 570 m³ bis zu 13 m unter der Brauerei
Schlappeseppel (Denkmalschutzbehörde Stadt Aschaffenburg
2010:31f; AHRENDT-FLEMMING 2014; HOLLEBER 2014). Dabei handelt
es sich nach den geologischen Verhältnissen ausnahmslos um
Gewölbekeller, da hier kein standfester Fels ansteht. Sicher
wurde nur ein kleiner Teil als Bier- und Eiskeller genutzt.
Weitere Gewölbe- und Eiskeller sind wahrscheinlich vorhanden,
aber nicht bekannt.
Auch das Schloss Johannisburg besaß einen außen angelegten
Eiskeller (HELMBERGER 2022:18).
Die wohl mit Abstand nach Fläche und Volumen größte und
komplexeste Kelleranlage in Aschaffenburg befindet sich
zwischen Fischergasse, Güterberg, Löhergraben und dem
Altstadtfriedhof. Die Bier- und Eiskeller stammen von
Aschaffenburger Brauereien aus verschiedenen Zeiten; für eine
Brauerei sind die zu umfangreich. Die Keller sind gegenwärtig
nicht zugänglich und wurden zuletzt während des 2. Weltkriegs
als Luftschutzbunker genutzt. Die sehr verschachtelte Anlage
erstreckt sich über 2 Ebenen. Ohne eine ausreichende
Ausrüstung ist eine Befahrung als gefährlich einzustufen. Eine
ausführliche Beschreibung oder Vermessung ist nicht bekannt.
Durch eine Befahrung im Oktober 2022 kam ein Bericht in der
Tageszeitung "Main-Echo"
vom 19.11.2022 zu stande.
Nach den wenigen vorliegenden Archivalien sind es die Keller
der ehemaligen Brauerei "Gesellschaftsbrauerei" und vor allem
der Brauerei "Wurstbendel" Ludwig Geiger mit einem Gasthaus
(siehe auch FAUST 2004:22), dem weite Teile des Areals
gehörten; es war eine der großen Brauereien in Aschaffenburg.
Man begann 1876 mit einem Eiskeller und 1881 mit dem Bau der
weiterer Keller und erweiterte diese Kelleranlage im Abstand
von Jahren. Es handelte sich um Gär-, Eis- und Bierkeller, die
durch einen Aufzug mit der darüber stehenden Brauerei
verbunden waren. Die Brauerei wurde 1901 von der Bayerischen
Aktienbrauerei AG übernommen und dann still gelegt. Am
1.2.1940 kam es zu einem kleinen Einsturz (Nachbruch), der
einen umfangreichen Schriftwechsel hinterließ.
 Bad Orb: Felsenkeller an der Altenbergstraße
auf dem Weg von Stadt zu den Steinbrüchen im Unteren
Buntsandstein. Aufgrund der Größe, der Hanglagen und der
Bedeutung der Stadt sind sicher zahlreiche weitere
Felsenkeller vorhanden.
Bad Orb: Felsenkeller an der Altenbergstraße
auf dem Weg von Stadt zu den Steinbrüchen im Unteren
Buntsandstein. Aufgrund der Größe, der Hanglagen und der
Bedeutung der Stadt sind sicher zahlreiche weitere
Felsenkeller vorhanden.
- Bamberger Mühle: Felsenkeller als Quellstube (WEHL
2009:75).
- Bessenbach: In Oberbessenbach gibt es einen
Felsenkeller des ehemaligen Gasthauses "Zur Krone". Dieser
wurde teilweise verfüllt und überbaut.
- Blankenbach: An der Krombacher Str. bestand bis
2006 ein Felsenkeller, der zu Luftschutzzwecken erbaut worden
war (WEHL 2009:74f).
- Dettingen (Gemeinde Karlstein a. Main) Nach den
unveröffentlichten Ausführungen von Harald WEIS (2016) aus
Hörstein bestand im Gasthaus "Zum weißen Ross", heute
"Gasthaus zur Krone" eine Brauerei. In einem noch erhaltenen
Torbogenstein ist eingeschlagen: "Anno domini·15·79·C·H·"
für Cilio HELFFRICH, der damals das Anwesen Mainplatz 4
erweiterte. Im Keller befinden sich Gär-, Lager- und Eiskeller
als Gewölbekeller. Der Gastronomiebetrieb wurde 2024
eingestellt.
- Erlenbach: Kühlkeller eine Gastwirtschaft (WEHL
2009:75).
- Eschau: Die Brauerei in dem ehemaligen Gasthaus
"Zur Krone" hatte 1881 einen Felsenkeller bauen lassen.
- Frammersbach: In der 1886 begründeten
Waldschloss-Brauerei gibt es auch einen Felsenkeller, der aber
nicht mehr gemutzt wird.
 Geiselbach: Mindesten 3 Felsenkeller an der Straße
nach Hofstätten (WEHL 2009:75).
Geiselbach: Mindesten 3 Felsenkeller an der Straße
nach Hofstätten (WEHL 2009:75).
- Glattbach: Galerie Gewölbekeller an der Schulstr.
17
 Goldbach: Die Löwenbrauerei
(FAUST 2004:38) in Goldbach ließ 1835 einen Felsenkeller
einrichten, der bis 1908 als Bierkeller und später als
Eiskeller benutzt wurde. 1944/45 diente er als
Luftschutzkeller für bis zu 300 Goldbacher. Heute wird er von
der Familie Rüger gepflegt und befindet sich an der Straße Am
Felsenkeller 2. Es handelt sich sicher um den beeindruckensten
Felsenkeller im Spessart. Er besteht aus einem alten kleinen
Weinkeller (wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert), der mit
Schlägel und Eisen sorgfältig aus dem Fels gehauen wurde.
Dahinter schließt sich der jüngere große Bierkeller an, der in
Bohr- und Sprengarbeit erstellt worden ist. Bemerkenswert ist
ein kleiner Pegmatit-Gang, der den Goldbacher Gneis
durchschlägt und ein m²-großer Harnisch. Lüftungsschächte
bewettern die Hohlräume.
Goldbach: Die Löwenbrauerei
(FAUST 2004:38) in Goldbach ließ 1835 einen Felsenkeller
einrichten, der bis 1908 als Bierkeller und später als
Eiskeller benutzt wurde. 1944/45 diente er als
Luftschutzkeller für bis zu 300 Goldbacher. Heute wird er von
der Familie Rüger gepflegt und befindet sich an der Straße Am
Felsenkeller 2. Es handelt sich sicher um den beeindruckensten
Felsenkeller im Spessart. Er besteht aus einem alten kleinen
Weinkeller (wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert), der mit
Schlägel und Eisen sorgfältig aus dem Fels gehauen wurde.
Dahinter schließt sich der jüngere große Bierkeller an, der in
Bohr- und Sprengarbeit erstellt worden ist. Bemerkenswert ist
ein kleiner Pegmatit-Gang, der den Goldbacher Gneis
durchschlägt und ein m²-großer Harnisch. Lüftungsschächte
bewettern die Hohlräume.
 Großkahl: Felsenkeller am
Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH
et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).
Großkahl: Felsenkeller am
Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH
et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).
- Großheubach: Die Brauerei und Gastwirtschaft "Zur
Rose" hat einen Gewölbekeller (FAUST 2004:40).
Aus der Zeit um 1930 sind Fotos erhalten, die eine
Eisgewinnung mit einer Wasserleitung und einem Gestell im
Bereich des heutigen Friedhofs zeigen. Hierbei ließ man Wasser
bei Frost über ein hölzernes Gatter laufen, welches dann daran
zu langen Eiszapfen gefror. Dieses Eis wurde mit großen
Holzhämmern abgeschlagen, zusammen geschaufelt und dann in
eine daneben stehende einfache Eismiete, die dick mit Stroh
abgedeckt war (lokal "Strohtempel" genannt), gelagert. Eine
größere Eismasse konnte damit bis in den Sommer erhalten
werden.

 Großlaudenbach: Beim
Sanieren der Großlaudenbacher Straße Anfang August 2014 wurde
gegenüber des Hauses Nr. 44 ein kleiner Felsenkeller frei
gelegt. Er ist in den hier anstehenden Gneis eingetieft und
mit einem Bruchsteingewölbe geschlossen und dann mit
Hangschutt überdeckt. Die ursprüngliche Höhe war durch
eingeschwemmtes Sediment erheblich erniedrigt worden. Daten
zur Nutzung und Alter sind nicht bekannt. Die Bauart und der
Kalksinter, auch bis zu 4 cm lange innen hohle Stalagtiten,
aus Calcit weisen auf ein hohes Alter hin.
Großlaudenbach: Beim
Sanieren der Großlaudenbacher Straße Anfang August 2014 wurde
gegenüber des Hauses Nr. 44 ein kleiner Felsenkeller frei
gelegt. Er ist in den hier anstehenden Gneis eingetieft und
mit einem Bruchsteingewölbe geschlossen und dann mit
Hangschutt überdeckt. Die ursprüngliche Höhe war durch
eingeschwemmtes Sediment erheblich erniedrigt worden. Daten
zur Nutzung und Alter sind nicht bekannt. Die Bauart und der
Kalksinter, auch bis zu 4 cm lange innen hohle Stalagtiten,
aus Calcit weisen auf ein hohes Alter hin.
- Großostheim: Eine Besonderheit sind Erdställe und
Fluchtkeller, die hier im anstehenden Löss als standfestes
Lockergestein angelegt wurden. Sie stammen vermutlich aus dem
Mittelalter und sind mit Gewölbekellern kombiniert (HILLA
2013).
- Großwallstadt: In der Gastwirtschaft
"Zum Anker" wird seit 1852 Bier gebraut. Das Eis
der Brauerei "Ankerbräu" wurde noch in den 1930er Jahren in
einer großen Eismiete auf dem Schauderberg gelagert. Der
Braubetrieb wird 1956 eingestellt (WEINKÖTZ 1990:13ff).
 Gunzenbach: An der Eichwaldstr. befinden sich im
Quarzit 2 Keller, die in den steilen Hang eingebaut worden
sind. Sie sind mit einem gemauerten Gewölbe gesichert und
stoßen mit der Sohle und der Rückwand in den Fels. Die Bauart
deutet auf des 19. Jahrhundert hin. Der linke Felsenkeller ist
in Privatbesitz einer ehemaligen Gaststätte gegenüber und
aufgrund der Bewaldung nachgebrochen, wie bei einer
Besichtigung am 12.07.2025 zu sehen war. Der rechte Keller ist
ein sehr kleiner Gewölbekeller im Eigentum der Gemeinde.
Gunzenbach: An der Eichwaldstr. befinden sich im
Quarzit 2 Keller, die in den steilen Hang eingebaut worden
sind. Sie sind mit einem gemauerten Gewölbe gesichert und
stoßen mit der Sohle und der Rückwand in den Fels. Die Bauart
deutet auf des 19. Jahrhundert hin. Der linke Felsenkeller ist
in Privatbesitz einer ehemaligen Gaststätte gegenüber und
aufgrund der Bewaldung nachgebrochen, wie bei einer
Besichtigung am 12.07.2025 zu sehen war. Der rechte Keller ist
ein sehr kleiner Gewölbekeller im Eigentum der Gemeinde.
- Hafenlohr: Hier bestand bis 1972 die Brauerei
Hafenlohr der Brauerdynastie Mehling. Im 16. Jahrhundert
gehörte zur Brauerei bereits ein Felsenkeller am "Oberen
Bidum". Im Jahr 1846 wurden 3 parallele Felsenkeller im
Sandstein angelegt, die als Eiskeller genutzt wurden.
 Homburg (Triefenstein): Der
Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier
anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit
einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.
Homburg (Triefenstein): Der
Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier
anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit
einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.
Die Pension und Weinstube Weinkrug an der Maintalstr. 19
betreibt einen Felsenkeller, der für Weinproben genutzt wird.
Der kleine Keller ist in den Sandstein eingetieft und mit
einem Gewölbe gesichert.
Unter dem Schloss befindet sich ein Gewölbekeller aus
Sandstein aus dem 16. Jahrhundert.
 Hörstein: Unweit des Hofguts gibt
es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den
Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum
Löwen" (FAUST 2004:53) der sich
zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße
befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in
dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller
ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von
Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der
ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als
Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &
Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem
feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er
verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert
daran.
Hörstein: Unweit des Hofguts gibt
es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den
Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum
Löwen" (FAUST 2004:53) der sich
zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße
befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in
dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller
ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von
Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der
ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als
Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &
Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem
feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er
verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert
daran.
- Kassel: Nach den mündlichen Ausführungen von Josef
ACKER gab es hier einen Eiskeller und einen Bierkeller einer
örtlichen Gasthausbrauerei, die beide nicht mehr erhalten
sind.
 Kleinheubach: in
Richtung Odenwald führt die Straße "Am Felsenkeller". Hier
befinden sich 2 großer Felsenkeller, die aber nicht in den
anstehenden Sandstein getrieben, sondern mit einem Gewölbe
überbaut sind. Der obere Felsenkeller wurde 1869 für den
Schwanenwirt angelegt. Der Aushub diente zum Anheben den
Niveaus des Friedhofs (mündl. Mitteilung Alf DIETERLE am
15.10.2016).
Kleinheubach: in
Richtung Odenwald führt die Straße "Am Felsenkeller". Hier
befinden sich 2 großer Felsenkeller, die aber nicht in den
anstehenden Sandstein getrieben, sondern mit einem Gewölbe
überbaut sind. Der obere Felsenkeller wurde 1869 für den
Schwanenwirt angelegt. Der Aushub diente zum Anheben den
Niveaus des Friedhofs (mündl. Mitteilung Alf DIETERLE am
15.10.2016).
- Kleinkahl: Felsenkeller am Glashüttenhof (WEHL
2009:75).
 Kleinwallstadt: Außerhalb des
Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im
Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der
Umgebung als Unterschlupf dienen.
Kleinwallstadt: Außerhalb des
Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im
Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der
Umgebung als Unterschlupf dienen.
 Unter der Zentscheuer von 1548 befindet sich ein
eindrucksvoller Gewölbekeller aus Sandstein, der für
Veranstaltungen genutzt wird. Der Keller ist über 2 Zugänge
erreichbar und besitzt mehrere Fenster (mit blauer
Beleuchtung). In der Firste sind noch die Abdrücke der
Schalbretter des Lehrgerüstes in der Form von Mörtelresten
erkennbar.
Unter der Zentscheuer von 1548 befindet sich ein
eindrucksvoller Gewölbekeller aus Sandstein, der für
Veranstaltungen genutzt wird. Der Keller ist über 2 Zugänge
erreichbar und besitzt mehrere Fenster (mit blauer
Beleuchtung). In der Firste sind noch die Abdrücke der
Schalbretter des Lehrgerüstes in der Form von Mörtelresten
erkennbar.
 Klingenberg: Felsenkeller im ältesten
Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der
Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein
Schankraum eingerichtet worden.
Klingenberg: Felsenkeller im ältesten
Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der
Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein
Schankraum eingerichtet worden.


Von der Stadt zur Seltenbachschlucht sind mehr als 10 weitere
Felsenkeller bekannt, von denen heute noch Teile genutzt
werden. Darunter war auch mind. 1 Bierkeller der Brauerei
Ebert am Beginn der Schlucht, der heute den Fledermäusen als
Schlafplatz dient. All diese Keller sind in den steilen Hang
aus Sandstein vorgetrieben worden.

Das Museum in Klingenberg (eine ehemalige Brauerei) verügt
auch über einen in den Hangschutt des Bergers eingelassenen
Gewölbekeller, der heute mit Thema Weinbau und Winzer belegt
ist.
- Kreuzwertheim: Die aus dem Gasthaus
"Zum Goldenen Löwen" hervorgegangene und seit 1809 brauende
"Spessart Brauerei" verfügte über einen Bier- und einen
Eiskeller.
- Krombach: etwa 100 m² großer und 9 m hoher
Felsenkeller einer Bierbrauerei von 1830 bis 1942 an der
Hauptstraße, heute verschüttet (WEHL 2009:75).
- Langenprozelten: Felsenkeller gegenüber dem
Sägewerk Grötsch (siehe Fotos ganz oben)
 Lohr am Main: Hier gibt es ein
Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am
Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind
Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834
eingeschlagen.
Lohr am Main: Hier gibt es ein
Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am
Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind
Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834
eingeschlagen.
 Mainaschaff: 1860-1862 als
Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von
Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der
ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981
(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine
Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und
zugänglich.
Mainaschaff: 1860-1862 als
Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von
Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der
ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981
(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine
Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und
zugänglich.
Nach SCHLETT (1995:43ff) wurde der Bierkeller vom Gastwirt und
Brauer Nikolaus OFENSTEIN (Gasthaus "Zur Krone", Haus Nr. 41
an der Kirchgasse gelegen; heute griechisches Krone Restaurant
an der Schulstraße 3 im alten Ortskern von Mainaschaff) am
28.12.1859 beantragt. Der Brauer sah die Einkellerung von etwa
1.500 Eimer Lagerbier in Fässern vor. Der Hohlraum wurde 1860
durch einen nicht näher bezeichneten "Bergknappen" (Bergmann)
in dem sehr standfesten Gneis hergestellt. Die Kosten wurden
reduziert, in dem man die gewonnen Steine als Baumaterial
verkaufte und den Kleinschlag zum Wegebau zum Bierkeller
verandts. Der Keller wurde im Dezember 1862 mit einer Länge
von 83 Fuß bei gleicher Breite (?) und einer Höhe von 8 Fuß
fertig gestellt. Darüber bestand über eine lange Zeit eine
Schankhalle, die die Bürger an Sonntagen und bei
Veranstaltungen mit Getränken versorgte.
 Marktheidenfeld: Am
rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von
verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der
Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.
Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach
Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.
Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der
Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,
so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden
sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13
vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch
gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein
Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist
eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut
erklärt wird.
Marktheidenfeld: Am
rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von
verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der
Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.
Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach
Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.
Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der
Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,
so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden
sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13
vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch
gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein
Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist
eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut
erklärt wird.
1811 wurde unter der Schankwirtschaft und Biergarten
"Felsenkeller" (damals war
der Name "Zum Neuen Brauhaus 1816", denn bis dahin
existierten ja noch keine Felsenkeller. Der Name hat sich
dann erst danach gebildet) ein ca. 50 m langer und 5 m breiter
Keller angelegt, was der größten dieser Art darstellt, der
heute von etwa 10 Feldermäusen besiedelt ist, die hier bei ca.
9° C und 80 % rel. Luftfeuchte überwintern. Der Felsenkeller
beginnt unter dem neuen Brauhaus von 1816. Die Decke ist mit
zahlreichen Entlastungsbögen gesichert. 2 senkrecht nach oben
angelegte Luftschächte sorgen für eine Bewetterung. Von dem
Keller gehen seitliche Räume ab. Auf dem Boden liegen
beiderseits die quaderförmigen Auflager für die Bierfässer.
Der Sandstein ist hier stark geklüftet, weshalb umfangreiche
Sicherungsmaßnahmen notwendig waren. Im Bereich des Einganges
tritt etwas Tropfwasser zu, sonst ist der Keller trocken. Eine
Besonderheit sind Sinterbildungen, die bei Sanierungsarbeiten
entdeckt und durch eine Glasscheibe von Herrn Markus ("Mäx")
Tauberschmitt sichtbar gemacht wurden: Bis zu 1 m lange, ca. 5
mm dicke, schmutzigweiße Tropfsteine (Makkaroni) die entlang
eines Risses von der Decke wachsen!
Übrigens wurde der 4. Keller von dem Marktheidenfelder
Schiffer Dadvid SCHATZ im Jahre 1819 errichtet. Warum
ein Schiffer einen Felsenkeller anlegen ließ, verliert
sich im Dunkel der Geschichte.

Das neue Brauhaus 1816 mit den Felsenkellern und Fasshallen am
Main um 1925 (Archiv Tauberschmitt). Ein Teil der Keller
können im Rahmen von Führungen von Herrn Tauberschmitt
besichtigt werden - das ganz besondere Erlebnis. Wenn man die
Lokation besucht, dann beachte man auch die Hochwassermarken
rechts neben und auf dem Torbogen. Merkwürdigerweise ist die
Brauerei bei (FAUST 2004) nicht
aufgeführt.
 Mespelbrunn: Selbstverständlich hat ein
Schloss einen Eiskeller, der hier im Nordhang am Zugang zum
Schloss eingebaut wurde. Der Eisweiher liegt ja direkt
daneben. Details über Größe, Alter usw. waren dem Führer nicht
bekannt.
Mespelbrunn: Selbstverständlich hat ein
Schloss einen Eiskeller, der hier im Nordhang am Zugang zum
Schloss eingebaut wurde. Der Eisweiher liegt ja direkt
daneben. Details über Größe, Alter usw. waren dem Führer nicht
bekannt.
- Miltenberg: Etwa 100 m tiefer Weinkeller im
Sandstein der St. Kilian Kellerei "Vinothek" an der
Hauptstraße 241-245 in der Altstadt von Miltenberg. Der Keller
wurde bereits im 15. Jahrhundert erwähnt.


Das Brauerhaus Faust an der Hauptstraße 219 in der Altstadt
von Miltenberg verfügt ebenfalls über mehrere Eis- und
Bierkeller, die in Sandstein im steilen Hang eingetieft sind.
Oberhalb der Brauerei hatte man einen Eisweiher gebaut, um das
Eis von oben in die Keller fallen lassen zu können. In den
Jahren, in denen sich kein Eis bildete, wurde Eis mit der Bahn
aus Norddeutschland angeliefert (mündl. Mitteilung Cornelius
FAUST am 23.1.2015). Die beeindruckenden Keller mit den
Holzfässern sind in den anstehenden Fels getrieben und
trotzdem überwölbt, da der dickbankige Miltenberger Sandstein
durch die dünnen Tonsteinlagen zwischen den Bänken in der
Firste ohne weitere Maßnahmen keine stabile Decke hergeben.

Das Museum am Schnatterloch verfügt über einen ehemaligen
Weinkeller, der als Gewölbekeller ausgeführt ist und für
Ausstellungen genutzt wird.

Der tiefste Eiskeller sind die Gewölbekeller im Buntsandstein
der Weinhandlung St. Kilian Kellerei an der Hauptstr. 241 -
245 in Miltenberg. Nach dem Ausführungen von Johann A. GEIGER
ist der unterschiedlich hohe Keller 100 m in den Fels des
Greinberges vorgetrieben worden. Infolge der Klüftigkeit und
der horizonalen Schichtung wurde der Keller ausgemauert, so
dass ein Gewölbe entstand. Der als Eiskeller angelegte,
älteste Teil stammt aus dem Jahr 1482 und es dürfte sich dabei
um einen der ältesten datierten Keller im Spessart handeln. Um
1880 wurde der Keller erweitert. Ein Lichtloch wurde ausgebaut
und erreicht nach 27 m die Tagesoberfläche. Ein Abzweig der
Kelleranlage hat ganzjährig nur 7° bis 9° C. Die Keller enden
an Störungen und breiten Klüften, wie man in der Fiste sehen
kann. Das tiefste Ende steht in einer Brekzie aus teils
schlierig hell alteriertem Sandstein. Über den im Rahmen einer
Führung während der Geschäftszeiten begehbaren Keller befindet
sich ein weiterer Gewölbekeller. Es handelt sich um den wohl
längsten bzw. tiefsten Eiskeller im Spessart.
- Obernburg: Beim Abbruch der Obstverwertungsgenossenschaft
Obernburg (OVGO) im Jahre 2005 wurden die Felsenkeller
verschlossen. Die etwa 100 Jahre alten und bis zu 30 m in den
Sandstein gehauenen Keller dienten während des 2. Weltkriegs
als Luftschutzkeller (nach Angaben des Heimat- und
Verkehrsvereins Obernburg).
- Rohrbrunn: Nach den Ausführungen von JESSBERGER
& SCHNEIDER (1985:273f) hatte sogar der Weiler Rohrbrunn
einen Eiskeller und dazu gehörig einen 20 x 50 m großen
Weiher, aus dem das Eis gewonnen wurde. Der Eiskeller befand
sich etwa dort, wo sich heute das Rausthaus auf der Südseite
befindet.

 Rothenbuch: An der Schlossstraße
befindet sich im Osthang der 1893 erbaute Bierkeller der
ehemaligen Geststätte "Zum Spessart". Der überwölbte Keller
wurde in den Jahren 2011 bis 12 saniert und somit erhalten. An
der Decke hat sich etwas Kalksinter gebildet.
Rothenbuch: An der Schlossstraße
befindet sich im Osthang der 1893 erbaute Bierkeller der
ehemaligen Geststätte "Zum Spessart". Der überwölbte Keller
wurde in den Jahren 2011 bis 12 saniert und somit erhalten. An
der Decke hat sich etwas Kalksinter gebildet.
Unter dem dem Schlosshotel befindet sich ein großer
Gewölbekeller, der heute als Gaststätte genutzt wird.
- Rothengrund: Hier befinden sich im
Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis der Mömbris-Formation 2
kleine Gewölbekeller, die in den Gneis-Saprolith von der
Talseite in den Hang bis etwa 10 m eingetieft worden sind.
Aufgrund der Form und Qualität der Ziegelsteine in der
Überwölbung können die Keller in das späte 19. Jahrhundert und
das frühe 20. Jahrhundert eingestuft werden.
 Sailauf:
Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich
zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller
befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des
Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.
Sailauf:
Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich
zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller
befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des
Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.

Der Felsenkeller weist eine Tür auf, ist dahinter aber
zugemauert und somit nicht zugänglich. Der einstige Bierkeller
wurde 1900 von Sebastian SAUER in den Fels vorgetrieben. Im 2.
Weltkrieg wurde der Keller von Johann BÜTTNER zum
Luftschutzkeller erweitert - wie eine daneben angebrachte
Tafel ausweist. Die Decke ist mit einem Ziegelsteingewölbe
ausgekleidet, ein Teil ist eingebrochen. Reste aus verrostetem
Eisen sind wohl Teile der Luftschutzausstattung aus dem 2.
Welkrieg.

Es existiert ein weiterer, weit aus größerer Eis- und
Bierkeller, der jedoch nur nach längerer Trockenheit befahren
werden kann. Er gehörte sehr wahrscheinlich zum Gasthaus "Zum
Grünen Baum", in Sailauf "Päffche" genannt; vermutlich ließ
der Gastwirt und Brauereibesitzer Johann Adam BERGMANN den
Keller in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts den Keller
anlegen. Der für Sailauf relativ große Keller ist sehr
sorgfältig aus Sandstein gemauert und gut erhalten; leider
sind bis jetzt keine Archivalien zum Bau gefunden worden.
Probleme bereitet das vom Hang darüber zulaufende Regenwasser.
Das Foto zeigt die Teilnehmer einer Befahrung am 04.03.2023
zur Risikoabschätzung.
- Schneppenbach: Felsenkeller an der Bergstraße
(WEHL 2009: 74).
- Schöllkrippen: 7 Felsenkeller aus der Zeit
zwischen 1847 und 1877 (siehe WEHL 2009:73f)

 Seligenstadt: der sogn.
"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe
FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt
(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher
Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man
Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der
Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten
Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom
gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat
zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE
2011), in der die Historie des Kellers auf seinem
Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am
25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;
SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich
um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus
Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden
noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die
Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen
gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein
verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden
verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt
befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer
Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller
unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898
wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -
daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als
Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem
Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE
pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man
beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des
Kellers.
Seligenstadt: der sogn.
"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe
FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt
(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher
Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man
Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der
Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten
Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom
gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat
zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE
2011), in der die Historie des Kellers auf seinem
Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am
25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;
SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich
um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus
Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden
noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die
Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen
gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein
verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden
verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt
befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer
Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller
unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898
wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -
daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als
Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem
Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE
pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man
beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des
Kellers.
Nach der alten Literatur soll im Umfeld des Kelles ein
vulkanisches Gestein ("Untermain-Trapp") angetroffen worden
sein; von diesem ist heute nichts mehr zu sehen.
 Sommerkahl:
5 Felsenkeller an der Ernstkricher Str. und Schwedenstraße (WEHL
2009:75).
Sommerkahl:
5 Felsenkeller an der Ernstkricher Str. und Schwedenstraße (WEHL
2009:75).
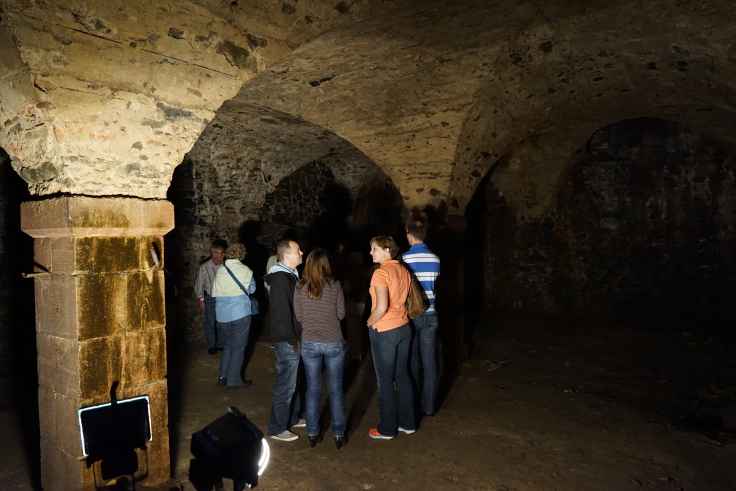 Steinheim a. Main: Unter der
Altstadt von Großsteinheim befinden sich zahlreiche
Gewölbekeller, die gegenwärtig vermessen und untersucht werden
(KIPPERS et al. 2013). Der hier abgebildete und mit 106 m²
außergewöhnlich große Keller mit dem markanten
Kreuzgratgewölbe befindet sich im Garten vom Anwesen Platz des
Friedens 7. Es ist nicht bekannt, wann der Keller erbaut
wurde. Vermutlich wurde der Keller im 19. Jahrhundert neu
überwölbt. Die Größe lässt eine Nutzung als Lager- und
Eiskeller für eine Brauerei als sehr wahrscheinlich vermuten;
zuletzt wurde der Keller von einem Fischhändler genutzt.
Steinheim a. Main: Unter der
Altstadt von Großsteinheim befinden sich zahlreiche
Gewölbekeller, die gegenwärtig vermessen und untersucht werden
(KIPPERS et al. 2013). Der hier abgebildete und mit 106 m²
außergewöhnlich große Keller mit dem markanten
Kreuzgratgewölbe befindet sich im Garten vom Anwesen Platz des
Friedens 7. Es ist nicht bekannt, wann der Keller erbaut
wurde. Vermutlich wurde der Keller im 19. Jahrhundert neu
überwölbt. Die Größe lässt eine Nutzung als Lager- und
Eiskeller für eine Brauerei als sehr wahrscheinlich vermuten;
zuletzt wurde der Keller von einem Fischhändler genutzt.
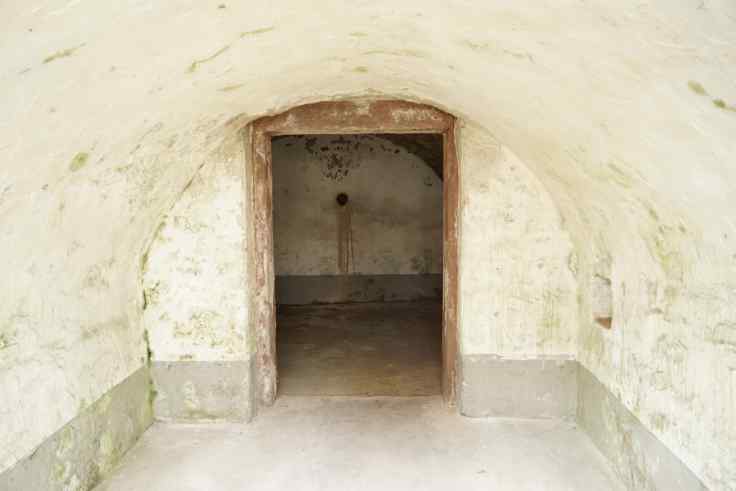 Sulzbach am Main (Markt):
Unter dem Friedhof befindet sich ein alter, kleiner Bier- und
Eiskeller. Der sehr kleine Keller wurde nach dem Einsturz der
Decke renolviert und mit einem Gitter gesichert
(mündlicher Hinweis von Peter Wohlschlögel, Sulzbach)
Sulzbach am Main (Markt):
Unter dem Friedhof befindet sich ein alter, kleiner Bier- und
Eiskeller. Der sehr kleine Keller wurde nach dem Einsturz der
Decke renolviert und mit einem Gitter gesichert
(mündlicher Hinweis von Peter Wohlschlögel, Sulzbach)
- Stockstadt: Felsenkeller im örtlich anstehenden
Orthogneis der Brauerei "Zum Schwanen", heute steht hier das
Gasthaus "Zur Traube" (MILTENBERGER 1982:204). Die Brauerei
ist bei FAUST (2004) nicht angeführt. Der Felsenkeller, wohl
wegen der Nähe zum Main als Eiskeller angelegt, ist noch
vorhanden, aber für Besucher nicht zugänglich.
 Waldaschaff: Beim Bau eines Hauses an der
Aschaffenburger Str. 74 wurden Teile eines Eiskellers frei
gelegt, die zur einstigen Gastwirschaft ? gehörte. Der im
Diorit-Saprolit mit gering mächtigen Baryt-Gängen angelegte
Keller verfügte über einen Schacht zum Eiseinwurf vom oben. Im
2. Weltkrieg wurde ein Gang angefügt, der an einem der
Baryt-Gänge angesetzt wurde. Die Hohlräume waren in Schlägel-
und Eisenarbeit aufgefahren worden. Die Hohlräume wurden im
Zuge der Bauarbeiten gesichert und verschlossen.
Waldaschaff: Beim Bau eines Hauses an der
Aschaffenburger Str. 74 wurden Teile eines Eiskellers frei
gelegt, die zur einstigen Gastwirschaft ? gehörte. Der im
Diorit-Saprolit mit gering mächtigen Baryt-Gängen angelegte
Keller verfügte über einen Schacht zum Eiseinwurf vom oben. Im
2. Weltkrieg wurde ein Gang angefügt, der an einem der
Baryt-Gänge angesetzt wurde. Die Hohlräume waren in Schlägel-
und Eisenarbeit aufgefahren worden. Die Hohlräume wurden im
Zuge der Bauarbeiten gesichert und verschlossen.
 Wernfeld
(Gemünden): Zum heute noch bestehenden, 300 Jahre alten
Gasthof Hofmann gehört(e) ein Bier- und Eiskeller
an der Dirmbachstraße. Der ist über einen Zugang erschlossen,
der klassisch nach Norden zeigt und überdacht ist. Die 2 Türen
und das tiefer liegen des Kellers verhindern das Austreten der
kalten Luft. Der Keller ist in einem sehr guten Zustand, an
den Wänden weiß gekalkt und aus behauenem Sandstein erbaut,
also ein Gewölbe- und kein Felsenkeller. Reste der früheren
Nutzung sind noch vorhanden. Anhand der Bauweise kann
schätzen, dass der Keller in seinem heutigen Umfang um 1890
(±10 Jahre) erbaut oder erweitert wurde.
Wernfeld
(Gemünden): Zum heute noch bestehenden, 300 Jahre alten
Gasthof Hofmann gehört(e) ein Bier- und Eiskeller
an der Dirmbachstraße. Der ist über einen Zugang erschlossen,
der klassisch nach Norden zeigt und überdacht ist. Die 2 Türen
und das tiefer liegen des Kellers verhindern das Austreten der
kalten Luft. Der Keller ist in einem sehr guten Zustand, an
den Wänden weiß gekalkt und aus behauenem Sandstein erbaut,
also ein Gewölbe- und kein Felsenkeller. Reste der früheren
Nutzung sind noch vorhanden. Anhand der Bauweise kann
schätzen, dass der Keller in seinem heutigen Umfang um 1890
(±10 Jahre) erbaut oder erweitert wurde.
Bemerkenswert sind die vielen dünn langbeinige, fliegende und
etwa 3 cm große Insekten, die zu tausenden auf Abstand an den
Wänden sitzen und deren Flügel übereinander geklappt am Körper
anliegen. Dabei handelt es sich um die Gemeine
Höhlenstelzmücke (Limonia nubeculosa), die sonst in
natürlichen Höhlen leben. Die Tiere sind für Menschen völlig
harmos; über die Biologie dieser Tiere ist wenig bekannt. In
Deutschland sind ungefähr 290 Arten der Stelzmücken
nachgewiesen worden.
- Westerngrund: Felsenkeller an der Spessartstraße (WEHL
2009:75).
 Wildenstein (Burg): Das beeindruckende Gewölbe
des Kellers im Pallas ist sehr sorgfältig aus ganz groben
Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt worden, aufgenommen im
Rahmen einer Führung durch den Archäologen Harald Rosmanitz
vom Archäologischen Spessartprojekt beim Burgfest am
09.06.2012.
Wildenstein (Burg): Das beeindruckende Gewölbe
des Kellers im Pallas ist sehr sorgfältig aus ganz groben
Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt worden, aufgenommen im
Rahmen einer Führung durch den Archäologen Harald Rosmanitz
vom Archäologischen Spessartprojekt beim Burgfest am
09.06.2012.
Es gibt sicher sehr viel mehr solche Bauwerke, insbesondere
wenn man an die vielen Weinbaubetriebe am Main zwischen Steinau,
Gelnhausen, Aschaffenburg, Miltenberg, Wertheim, Marktheidenfeld
und Lohr denkt. Da es früher sehr viele Brauereien gab, sind
auch in der Fläche sicher in nahezu jedem größeren Ort solche
Keller vorhanden (gewesen). Die Literatur darüber ist sehr
spärlich.
Für den Spessart existiert keine Auflistung der Kellerbauwerke.
Bierkeller üben eine gewisse Anziehungskraft aus, so dass
die auch werbewirksam eingesetzt werden. Etliche Gaststätten
führen auch den Namen "Keller" in ihrem Namen, insbesondere im
Fränkischen. Sie sind oft außerhalb der Ortslagen erbaut worden
und betreiben heute auch Biergärten (RAUPACH & BÖTTNER
2010). Der berühmteste von diesen ist wohl die Gaststätte
"Auerbachs Keller" in Leipzig, die durch Goethes Faust zu dem
Ruhm kam.
Literatur:
AHRENDT-FLEMMING, F. (2014): Das Kellerkataster der
Aschaffenburger Oberstadt 2005 - 2012. Eine stadtgeschichtliche
Auswertung der dokumentierten Kelleranlagen.- Aschaffenburger
Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und Kunst des
Untermaingebietes Band 30, S. 129 - 146, 13 Abb.,
Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e. V., [Verlagsdruckerei
Schmidt GmbH] Neustandt a. d. A.
Autorenkollektiv (2023): Unterirdische Labyrinthe.- Bayerische
archäologie Heft 3/2023, 60 S., zahlreiche farb. Abb., Hrsg. von
Roland Gschlößl in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für
Archäologie in Bayern e. V. [Verlag Freidrich Pustet]
Regensburg.
BALZER, W. & BENZ, L. (2007): Mainzer Unterwelten.- 190 S.,
sehr viele, meist farb. Abb., [VITRUV Verlag] Mainz.
BEHREND, G. (1900): Der Eiskellerbau mit einer Anzahl ausgeführter
Anlagen neuester Art.- 37 S., 54 Textabb., [Verlag von Wilhelm
Knapp] Halle a. S.
BÜSCHER, G. (1942): Festes Wasser, flüssige Luft. Carl von Lindes
Kampf um Kältegrade.- Bücher deutscher Kultur, 160 S., 8
SW-Tafeln, einige Abb. im Text, [Wilhelm Limpert-Verlag] Berlin.
FAUST, G. (2004): Hopfen & Malz Gott erhalt´s. Die ehemaligen
und bestehenden Brauereien unserer Region.- 1 Karte, einige
historische SW-Abb., 16 Seiten Farbabb., hrsg. von der Brauerei
Faust [Plexus-Verlag] Miltenberg.
HARZER, F. (1864): Die Anlegung und Benutzung der Eiskeller, sowie
die Bereitung des künstlichen Eises und dazu dienenden Apparate
nach neuester und vorzüglicher Konstruktion. Für herrschaftliche
und landwirtschaftliche Haushaltungen, Konditoreien, Schlächter,
Brauerei- und Brennereibesitzer u. a. m.- 2. Auflage von Eberhard
Ducken, 86 S., 44 Abb. auf 7 Quarttafeln im Anhang, [Bernhard
Friedrich Voigt] Weimar.
HELMBERGER, W. (2022): Die Aschaffenburger
Ansichten von Ferdinand und Wilhelm Kobell. Landschaftgemälde
als Zeitdokumente.- Beihefte zum Aschaffenburger Jahrbuch 5,
112 S., zahlreiche farb. Abb., Hrsg. vom Geschichts- und
Kunstverein Aschaffenburg e. V. [VDS-Verlagsdruckerei Schmidt]
Neustadt an der Aisch.
HILLA, B. (2013): Geheimnisvolle Orte im Bachgau. Die
Wiederentdeckung der Erdställe und Fluchtkeller in Großóstheim.-
Spessart Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 107.
Jahrgang, Heft April 2013, S. 22 - 25, 6 Abb., [Main-Echo GmbH
& Co KG] Aschaffenburg.
HOLLEBER, E. (2014): Der Abbruch des Anwesens Dalbergstraße 31 in
Aschaffenburg. Aufmaß und Beschreibung des Gewölbekellers und
anderer Merkwürdigkeiten.- Aschaffenburger Jahrbuch für
Geschichte, Landeskunde und Kunst des Untermaingebietes Band 30,
S. 129 - 146, 13 Abb., Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg
e. V., [Verlagsdruckerei Schmidt GmbH] Neustandt a. d. A.
JESSBERGER, K. & SCHNEIDER, M. (1985):
Rohrbrunn und der Hochspessart. Erinnerungen an ine
verlorene Einöde.- 335 S., zahlreiche SW-Abb.,
[Eigenverlag Jessberger - Fränkische Nachrichten Druck-
und Verlags GmbH] Tauberbischofsheim.
Königlich-Bayerisches Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und
Aschaffenburg (1865): Erläuterungen zu der Zeichung eines
Eiskellers.- Nr. 162 vom 16. Dezember 1865, 1 ausklappbare
Tafel, [Bonitas Bauer] Würzburg.
KÜPPERS, S., TEBERATZ-GEISSLER, E., VYDRA, A., OPPERMANN,
F., LEONHARDT, H. & HUWE, B. (2013): Steinheimer
Unterwelt. Kellerkataster der Altstadt. Zwischenbericht.-
46 S., zahlreiche farb. Abb., Karten, Pläne und Schnitte
(davon 2 ausklappbar), Hrsg. Magistrat der Stadt Hanau
Fachbereich Kultur - Museen der Stadt Hanau in Kooperation
mit der Hochschule Darmstadt Fachbereich Architektur,
Heimat- und Geschichtsverein Steinheim e. V.,
LAUBE, T. (2011): "Seligenstädter Intelligenzblatt" Ausgabe
September 2011.- 4 S., 15 Abb., Eigendruck
LEONHARD, K. C. v. (1845): Taschenbuch für die Freunde der
Geologie in allgemein faßlicher Weise bearbeitet.- Erster
Jahrgang, 239 S., 1 Stahlstich, 1 Lithographie, mehrere Abb. Im
Text, [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
LORENZ, J. (2017): Felsenkeller – Die frühen Eis- und
Kühlschränke. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 04/2017, S.
46 - 48, 5 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von Okrusch, M., Geyer, G., Jung,
J., Himmelsbach, G. & Dietl, C. (2010): Spessartsteine. Spessartin,
Spessartit und Buntsandstein - eine umfassende Geologie und
Mineralogie des Spessarts. Geographische, geologische,
petrographische, mineralogische und bergbaukundliche Einsichten in
ein deutsches Mittelgebirge. VI + 912 S., 2.532 meist farbigen
Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer ausklappbaren
Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.
LÜTGERT, S. A. (2000): Eiskeller, Eiswerke und Kühlhäuser in
Schleswig-Holstein und Hamburg. Ein Beitrag zur
Kulturlandshcaftsforschung und Industriearchäologie- 328 S.,
Karten im Text, 87 Abb. im Anhang, [HusumDruck- und
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG] Husum.
MILTENBERGER, K. (1982): Chronik Stockstadt a. Main. Beiträge zur
geschichtlichen Entwicklung.- 457 S., zahlreiche SW- nd wenige
Farbabb., Hrsg. von der Gemeinde Stockstadt, [Buchdruckerei Stock
& Kerber] Aschaffenburg.
NÖTHLING, E. (1896): Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke,
ihre Konstruktion und Benutzung. Für Bautechniker,
Brauereibesitzer, Landwirte, Schlächter, Konditoren, Gastwirte u.
s. w.- 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage, 184 S., 161 Fig. im
Text, [Bernhard Friedrich Voigt] Weimar.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
RAUPACH, M. & BÖTTNER, B. (2010): Frankens schönste Bierkeller
und Biergärten. 600 Tipps - unabhängig recherchiert.- 672 S., sehr
viele farb. Abb., 1 gefaltete Karte lose im Umschlag,
[Mediengruppe Oberfranken Buch- und Fachverlage GmbH & Co. KG]
Kulmbach.
REININK, W. (1995): Eiskeller. Kulturgeschichte alter
Kühltechniken.- Kulturstudien. Bibliothek der Kulturgeschichte
Sonderband 15, 248 S., 84 SW-Abb., [Böhlau Verlag] Wien.
SCHOPP, M. (2011): Der Gasthof "Zur Krone" am Freihof in
Seligenstadt. Eine historische Miniatur.- 150 S., 52 meist farb.
Abb., Tab., Stammbäume im unpag. Anhang, Hrsg. von der
Ordensbruderschaft vom steyffen Löffel zu Seligenstadt
[Kreiterdruck] Wolfratshausen.
SCHUBERT, A. (1903): Menzel - Schubert. Der Bau der Eiskeller,
Eishäuser, Lagerkeller und Eisschränke sowie die Anlage von
Kühlräumen nebst Eis- und Kühlmaschinen für Brauereien,
Molkereien, Schlächtereien, Eisfabriken usw.- 6. vollständig
neubearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage, 120 S., 135 Abb.,
[Verlag von J. Neumann] Neudamm.
Stadt Aschaffenburg Denkmalschutzbehörde (2010): Die historischen
Kelleranlagen der Aschaffenburger Oberstadt. Erste Ergebnisse der
Auswertung des Kellerkatasters.- 36 S., zahlreiche Abb., Karten,
Schnitte und Zeichnungen, [Repro One Kießlich & Pfeiffer GbR]
Idstein.
SCHLETT, L. (1995): Mainaschaff und sein Weinberg.- S. 25 - 48, 12
Abb., Tab.- in Arbeitsgemeinschaft für Orts- und
Familinegeschichte Mainaschaff [Hrsg.] (1995): Mainaschaffer
Ortsgeschichte Jubiläumsband anlässlich 10jährigen Bestehens der
Arbeitsgemeinschaft für Orts- und Familiengeschichte.- 398 S.,
zahlreiche SW-Abb., Tab., [Verlagsdruckerei Schmidt GmbH] Neustadt
a. d. Aisch.
STAHL, P. (1908): Die Kellerkühlung mittelst Natureis unter
besonderer Berücksichtigung der dabei in Betracht kommenden
Faktoren wie Feuchtigkeitsbestimmungen etc..- 32 S., 9 Abb., 2
Tab., [ohne Verlag] Nürnberg.
STRAUSS, S. (2025): Brauereiein Alzenau, Teil II Brauerei
Stein in Alzenau.- Unser Kahlgrund 2026 Heimatjahrbuch für den
ehemaligen Landkreis Alzenau 71. Jahrgang S. 72 - 88, 10
Abb., Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und
Heimatpflege Kalgrund e. V. [Gebhard druck+medien] Heusenstamm.
SWOBODA, K. (1868): Die Eisapparate der Neuzeit. Erläuterung und
Beschreibung der in dem letzten Decenniumin Anwendung gekommenen
Eismaschinen. Mit besonderer Berücksichtung der in der Pariser
Weltausstellung von 1867 exponierten Eisapparate.- 28 S., mit 5
mehrfach gefalteten Tafeln, enthaltend 24 Abbildungen, [Bernhard
Friedrich Voigt] Weimar.
SWOBODA, K. (1874): Die Anlegung und Benutzung transportabler und
stabiler Eiskeller, Eisschränke, Eisreservoirs und amerikanischer
Eishäuser sowie die Konstruktion und der Gebrauch von Milch-,
Wasser- und Luftkühlern, Gefrorenesmaschinen ec. Für
herrschaftliche und landwirtschaftliche Haushaltungen, Konditoren,
Schlächter, Brauerei- und Brennereibesitzer u. A. m.- 84 S., 3.
vermehrte und verbesserte Auflage von „F. Harzer´s“ Anlegung und
Benutzung der Eiskeller, mit 4 gefalteten Tafeln, enthaltend 49
Abb., [Bernhard Friedrich Voigt] Weimar.
TÄUBRICH, HANS-CHRISTIAN & TSCHOEKE, JUTTA [Konzept] (1991):
Unter Null Kunsteis, Kälte und Kultur.- 312 S., zahlreiche
SW-, wenige Farbabb., Hrsg. Vom Centrum Industriekultur Nürnberg
und dem Münchner Stadtmuseum, [Verlag C. H. Beck] München.
VOIGT, V. & WINKLER, H. [Hrsg.] (2014): Eiskeller und
Himmelslöcher. Interventionen, Erkundungen, Rekonstruktionen und
Kartierungen in Schleswig-Holstein.- 190 S., SW- und Farbabb.,
Gesellschaft für zeitgenössische Konzepte e. V., [Revolver
Publishing] Berlin.
WEHL, G. (2009): Felsenkeller im Oberen Kahlgrund.- In Unser
Kahlgrund Heimatjahrbuch 2009, S. 71-75, 5 Abb., Hrsg. von der
Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und Heimatpflege Kahlgrund
e. V., [Steiner oHG] Alzenau.
WEINKÖTZ, B. (1990): Brauereien sind so beständig wie der Durst,
und verdursten musste im Spessart bis jetzt noch niemand. Seit
Mitte des 16. Jahrhunderts sind Braustätten namentlich bekannt.-
Spessart Heft 9 1990, S. 9 - 18, 9 Abb., [Druck und Verlag
Main-Echo Kirsch & Co.] Aschaffenburg.
WÖRMANN, R. W. A. (1865-66): Das Wasser und seine Verwendung in
der Gärtnerei. Eine vollständige Anleitung zur Ent- und
Bewässerung. zur Anlage der Eiskeller, Teiche, Springbrunnen,
Brücken, Fähren, Bade-, Enten- und Schwanenhäuser, Fischbehälter
und Fischkästen. Nach eigenen Erfahrungen und Entwürfen.- 620 S.,
28 lithographischen Tafeln, [Ernst Schotte & Co.]
Berlin.
Zurück zur Homepage
oder zurück an den Anfang
der Seite

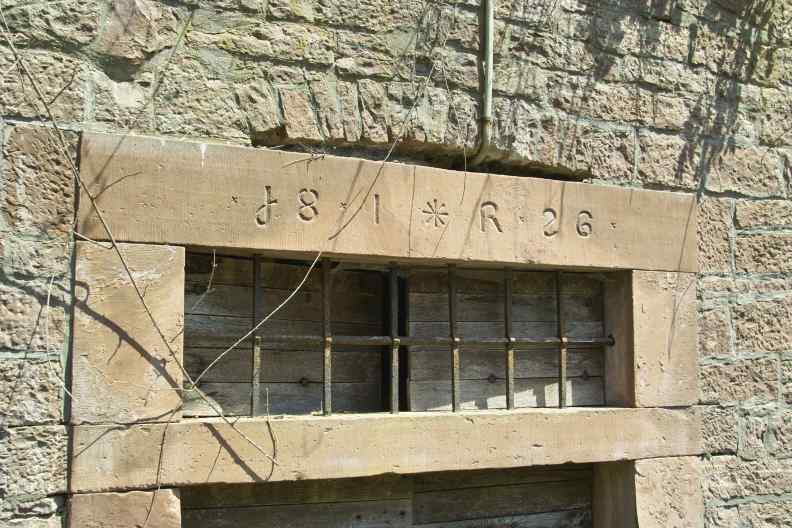

 Großkahl: Felsenkeller am
Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH
et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).
Großkahl: Felsenkeller am
Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH
et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).  Homburg (Triefenstein): Der
Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier
anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit
einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.
Homburg (Triefenstein): Der
Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier
anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit
einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.  Hörstein: Unweit des Hofguts gibt
es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den
Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum
Löwen" (FAUST 2004:53) der sich
zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße
befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in
dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller
ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von
Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der
ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als
Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &
Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem
feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er
verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert
daran.
Hörstein: Unweit des Hofguts gibt
es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den
Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum
Löwen" (FAUST 2004:53) der sich
zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße
befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in
dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller
ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von
Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der
ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als
Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &
Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem
feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er
verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert
daran.  Kleinwallstadt: Außerhalb des
Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im
Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der
Umgebung als Unterschlupf dienen.
Kleinwallstadt: Außerhalb des
Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im
Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der
Umgebung als Unterschlupf dienen.  Klingenberg: Felsenkeller im ältesten
Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der
Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein
Schankraum eingerichtet worden.
Klingenberg: Felsenkeller im ältesten
Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der
Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein
Schankraum eingerichtet worden.  Lohr am Main: Hier gibt es ein
Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am
Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind
Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834
eingeschlagen.
Lohr am Main: Hier gibt es ein
Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am
Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind
Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834
eingeschlagen.  Mainaschaff: 1860-1862 als
Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von
Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der
ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981
(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine
Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und
zugänglich.
Mainaschaff: 1860-1862 als
Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von
Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der
ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981
(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine
Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und
zugänglich.  Marktheidenfeld: Am
rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von
verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der
Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.
Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach
Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.
Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der
Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,
so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden
sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13
vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch
gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein
Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist
eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut
erklärt wird.
Marktheidenfeld: Am
rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von
verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der
Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.
Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach
Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.
Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der
Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,
so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden
sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13
vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch
gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein
Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist
eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut
erklärt wird. 
 Sailauf:
Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich
zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller
befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des
Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.
Sailauf:
Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich
zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller
befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des
Rathauses im hier anstehenden Orthogneis. 

 Seligenstadt: der sogn.
"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe
FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt
(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher
Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man
Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der
Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten
Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom
gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat
zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE
2011), in der die Historie des Kellers auf seinem
Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am
25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;
SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich
um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus
Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden
noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die
Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen
gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein
verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden
verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt
befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer
Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller
unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898
wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -
daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als
Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem
Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE
pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man
beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des
Kellers.
Seligenstadt: der sogn.
"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe
FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt
(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher
Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man
Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der
Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten
Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom
gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat
zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE
2011), in der die Historie des Kellers auf seinem
Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am
25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;
SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich
um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus
Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden
noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die
Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen
gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein
verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden
verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt
befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer
Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller
unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898
wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -
daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als
Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem
Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE
pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man
beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des
Kellers. Sommerkahl:
5 Felsenkeller an der Ernstkricher Str. und Schwedenstraße (WEHL
2009:75).
Sommerkahl:
5 Felsenkeller an der Ernstkricher Str. und Schwedenstraße (WEHL
2009:75).  Wildenstein (Burg): Das beeindruckende Gewölbe
des Kellers im Pallas ist sehr sorgfältig aus ganz groben
Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt worden, aufgenommen im
Rahmen einer Führung durch den Archäologen Harald Rosmanitz
vom Archäologischen Spessartprojekt beim Burgfest am
09.06.2012.
Wildenstein (Burg): Das beeindruckende Gewölbe
des Kellers im Pallas ist sehr sorgfältig aus ganz groben
Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt worden, aufgenommen im
Rahmen einer Führung durch den Archäologen Harald Rosmanitz
vom Archäologischen Spessartprojekt beim Burgfest am
09.06.2012.