Porfido verde antico
das markante, grüne Gestein (andesitischer Porphyr)
aus Krokees bei Sparta
in Lakonien auf dem Peleponnes
in Griechenland.
Oder der Stein mit der christlichen Symbolik!
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

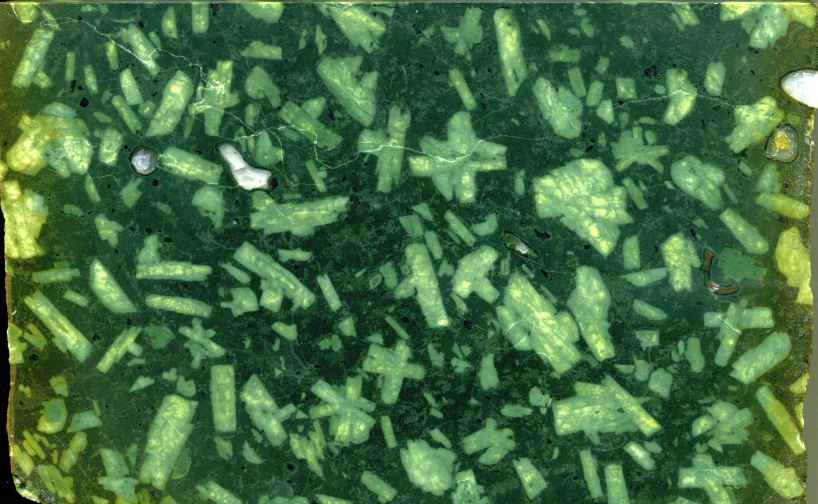
Das markante Gestein von der Fundstelle bei Krokees in Lakonien
(Süd-Peleponnes) bei Sparta in Griechenland,
links gefunden 1973, Bildbreite 9 cm,
rechts Bildbreite 11 cm.
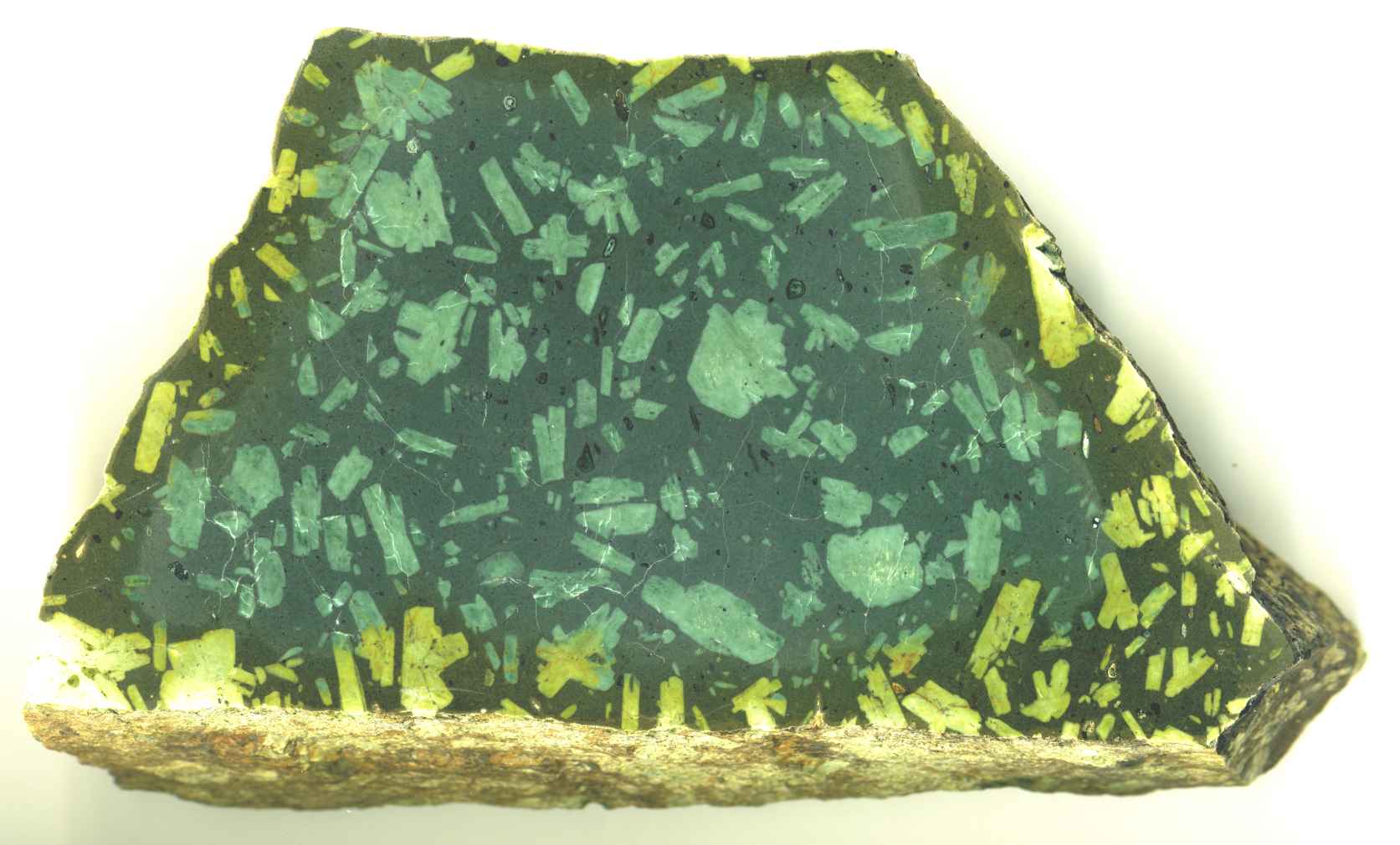
Eine Scheibe des
lapis
lacedaemonius
aus der Gegend von Krokees, angeschliffen und poliert,
gefunden 2011, Bildbreite 18 cm.

Kreuzförmig verwachsener Feldspat im grünen Porphyr auf der
natürlichen
Oberfläche - man erkennt, dass die Grundmasse leichter verwittert
und abgetragen
wird als die jetzt leicht erhabenen vorstehenden
Feldspat-Kristalle,
Bildbreite 3 cm

Büste
aus dem grünen Porphyr ohne Kopf und mit einem alt aussehenden
Sockel aus einem Kalkstein und
auch die Fibel aus Kalkstein; geschaffen wohl in Rom;
aufgenommen am 06.07.2023.
Das ornamentale Material wird im Schrifttum
als lakonischer Porfido
verde antico bezeichnet.
Infolge der jahrtausendlangen Verwendung in ganz
Europa gibt es dafür eine große Anzahl an
synonymen Namen und Bezeichnungen:
- Krokeischer Stein
- Lapis croceus
- Lapis spartanus
- Lapis Taygetas
- Grüner Porphyr
- Lakonischer Porphyr
- Andesitischer Porphyr
- Porfido serpentino verde
- Aphanitporphyr
- Lapis lacedaemonius
- Marmor lacedaemonius
- Porfido verde di Grecia
- "Serpentin"
- Porfidio serpentino
- Marmor lacedaemonium viride
- Serpentino duro antico
- Serpentino verde antico
- Porfido verde risato
- ....
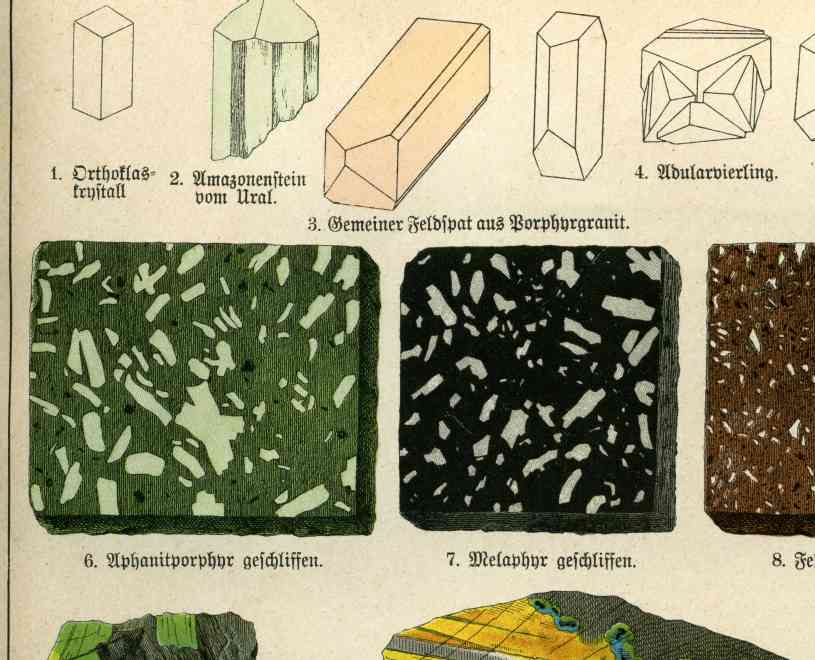
Als
"Aphanitporphyr" ist das geschliffene Gestein in SCHUBERT´s
Naturgeschichte von 1888 in der 3. Abt. 1. Teil Mineralogie
auf
Tafel 8 als Fig. 6 farbig abgebildet.
Das ornamentale Gestein wurde um
1.200 v. Chr in Griechenland abgebaut und zu
unglaublichen Kunstwerken verarbeitet.
Die Römer verwandten das grüne Gestein im
gesamten Reich, meist mit dem Imperialen Porphyr
aus Ägypten. Das Wissen um die Herkunft ging
verloren, so dass man ab dem Mittelalter nur
noch wusste, dass es aus der Antike kommt, weil
das Gestein in vielen römischen Ruinen verbaut
war: Porfido verde antico.
Eine ganz frühe Abbildung findet sich in dem
Marmorbuch von SEPP (1776) auf der Tafel 93 Nr.
3 und in der lateinischen Legende ist die Platte
als Serpentino verde antico beschrieben.
Der berühmte französische Mineraloge F. S.
BEUDANT schreibt noch 1826 im Lehrbuch für
Mineralogie auf Seite 729:
Grüner antiker Porphyr. Grüne
Grundmasse, vom Olivengrünen bis Schwärzlichgrünen
wechselnd, mit weißen oder grünlichen, einige Linien
großen Feldspatkrystallen. Man glaubt, daß ihn die alten
aus Ägypten erhalten haben, ...
Die Wiederentdeckung des Vorkommens erfolgte
erst wenige Jahre später, als Griechenland die türkische
Herrschaft abschüttelte. Heute findet kein Abbau statt, auch
weil keine für einen maschinellen Betrieb wirtschaftlich
notwendigen Blockgrößen gewonnen werden können.
Das grüne bis grünliche Gestein mit einer andesitischen
Zusammensetzung besteht aus einer sehr feinkörnigen
Grundmasse, in der cm-große Feldspatleisten eingeschlossen
sind. Diese Feldspäte sind weitgehend alteriert, so dass man
nur noch sagen kann, dass es sich einst um Plagioklase
gehandelt hat. Weiter erkennt man bei näherem Hinsehen in
der Grundmasse Ansammlungen von Quarz, Augit und auch etwas
Pyrit. Die grüne Farbe ist eine Folge der Mineralien Epidot
und Chlorit, die in der Grundmasse in Farbe und Härte
bestimmernder Menge vorhanden sind.
Das Alter des Gesteins konnte bisher nicht radiometrisch
datiert werden, weil vom ursprünglichen Mineralbestand nur
wenige Mineralien unverändert vorhanden sind, so dass eine
konventionelle Datierung ein zu junges Alter liefern würde.
Dieser grüne "Porphyr" wurde einst von den Griechen abgebaut
und in minoischer Zeit bis nach Kreta verfrachtet. Im Umfeld
des Palastes von Knossos sind Rohsteine bei Ausgrabungen
gefunden worden.
Von Plinius dem Älteren wurde der
attraktive Stein als "lapis lacedaemonius"
beschrieben (in Griechenland wird er heute als Krokeatis
bezeichnet).
Im klassischen Griechenland wurde das Material wohl nicht
mehr verwandt, denn es sind keine entsprechenden
Kunstwerke gefunden worden. Der Grund dürfte einerseits
darin liegen, dass sich keine großen Blöcke gewinnen
ließen. Da ist ein Marmor eindeutig im Vorteil und der ist
auch viel leichter zu bearbeiten, da ein Marmor aus dem
weichen Mineral Calcit besteht. Da die Griechen
andererseits die Skulpturen sehr farbig anmalten, spielt
die Farbe im Untergrund keine Rolle; im Gegenteil, man
hätte strukturiert grüne Farbe zumindest teilweise
übermalen müssen, was mit den antiken Farben vermutlich
nicht so einfach war. Dafür ist der neutral weiße
Untergrund eines Marmors viel besser geeignet.
Der Porphyr war dann erst wieder in römischer Zeit sehr
begehrt und wurde im gesamten römischen Reich als
ornamentaler Stein verwandt (oft zusammen mit einem "roten Porphyr" aus
Ägypten). Mit dem Untergang des römischen Reiches wurde auch
die Gesteinsgewinnung eingestellt. Wann dies erfolgt ist
weder durch Schriftstücke noch durch Spuren im Gelände
belegt. Vermutlich fand im Mittelalter keine weitere
Werksteingewinnung an den Vorkommen bei Krokea in Lakonien
(Griechenland) statt, so dass auch keine weiteren
Lieferungen in den europäischen Raum verhandelt wurden.
Die christlichen Kirchen übernahmen den Porphyr, der ja im
römischen Umfeld an vielen Stellen verbaut war und erhoben
ihn zu einem sehr symbolbeladenen Stein mit der höchsten
Wertschätzung. Wohl auch, weil die reichlich eingewachsenen
Feldspatkristalle je nach Schnittlage kreuzförmig verwachsen
sein können. Dabei griff man auf die römischen Steine in den
Wüstungen und Ruinen (Spolien) zurück und verarbeitete diese
Reste zu kirchlichen Gegeständen, wie beispielsweise
frühmittelalterliche Tragaltäre, aber auch Mosaiken,
Platten, Säulen, ....
Auch heute gibt es keine Werksteingewinnung und -verwendung
mehr.
Aus dem 20. Jahrhundert sind nur ganz einzelne
Kunstgegenstände bekannt geworden, die bei dem britischen
Autktionshaus Christie´s versteigert wurden. So wurde 1995
eine ca. 8 cm große Schnupftabakdose (3.500 €) und 2004 zwei
Vasen von ca. 50 cm Höhe (10.000 €) versteigert.
Lediglich als "Blütenporphyr" wird das oder ein ähnliches
Material (früher auch als "Chrysanthemenstein") im
Heilsteingewerbe verschlieffen.

Inzwischen
gibt es das Gestein auch als Trommelstein,
gesehen auf den Münchner Mineralientagen 2012
am Stand (A6.143) des Achatspezialisten Peter
Jeckel (Achatwelt) aus Worms.
Einzelne Goldschmiede verarbeiten das exotische
Gestein zu Schmuck (siehe unten).
Nach den Ausführungen Einheimischer ist das gesamte
Verbreitungsgebiet des grünen Porphyrs inzwischen gesetzlich
geschützt worden und darf nicht verändert werden. Damit sei
auch jegliche Entnahme von Gesteinsproben verboten. Es gibt
aber vor Ort keine Schilder und Hinweise, die auf diesen
Umstand verweisen.
Es macht auch keinen Sinn, denn die Gesteins-Vorkommen sind so
umfangreich, dass man ganz im Gegenteil, eigentlich eine
Gewinnung und Vermarktung zugunsten der hier lebenden
Bevölkerung empfehlen muss. Dazu muss weder ein Felsen noch
einer den Steinbrüche aktiviert werden, denn in den
natürlichen Hangschuttmassen der Terrassen und der
Straßenböschungen ist für Jahrzehnte ausreichend Gestein
vorhanden. Dieser Formenschatz im Gelände ist sicher nicht
römisch und somit auch nicht erhaltungswürdig.
Die Ruine auf dem Gotthardsberg bei Amorbach/Weilbach


Links: Die gotische Kirche mit dem romanischen
Kern und einem Turm (der jetzt als Aussichtsturm begangen
werden kann - Taschenlampe nicht vergessen -
mit einer herrlichen Aussicht auf Amorbach und Weilbach),
genau auf der Gemarkunsgrenze zwischen Amorbach und Weilbach
auf dem markanten
Gotthardsberg aus dem Sandstein der nahen Anhöhe gebaut.
Rechts: Ein Teil des ausgegrabenen Areals aus
Gebäudegrundmauern, Kellern mit Gewölbe und Straßenpflaster,
ebenfalls ausschließlich aus Sandstein
errichtet und teilweise in den anstehenden Fels eintieft.
Hier befindet sich die Fundstelle des Porphyrstückchens. Der
Kalkmörtel zeigt teilweise noch die
Spuren des händischen Verstreichens auf den Sandsteinen,
aufgenommen am 07.09.2011.
Die heutige Runine besteht aus einem Kloster, welches einst
aus einer salischen Burg hervorging. Die Erbauer sind
vermutlich die Herren von Dürn, die auf der südlich
gelegenen Wildenburg im Odenwald residierten (dort war nach
Wolfram von Eschenbach (*1160/80 †1220)
die mystische Gralsburg im Versroman Parzival).
Ein solches, bearbeitetes Gesteinsstück aus dem kirchlichen
Umfeld des Mittelalters wurde bei einer archäologischen Grabung
des Archäologischen Spessartprojekts von Harald ROSMANITZ und
Christine REICHERT 2010 auf dem Gotthardsberg zwischen Amorbach
und Weilbach im Grenzgebiet zwischen Spessart und Odenwald
gefunden.

Das kleine Stück des Porfido verde antico
aus der Grabung vom Gotthardsberg
auf der Gemarkungsgrenze zwischen Weilbach und Amorbach,
Bildbreite ca. 5 cm.
Die petrographischen Untersuchungen konnten die Herkunft aus
Griechenland sicher belegen. Funde von Bruchstücken solcher
Gesteinsplatten mittelalterlicher Tragaltäre sind aus vielen,
bedeutenden Kirchen- und Klosterorten bekannt und belegen die
Bedeutung des Gotthardsbergs zwischen Amorbach und
Weilbach.
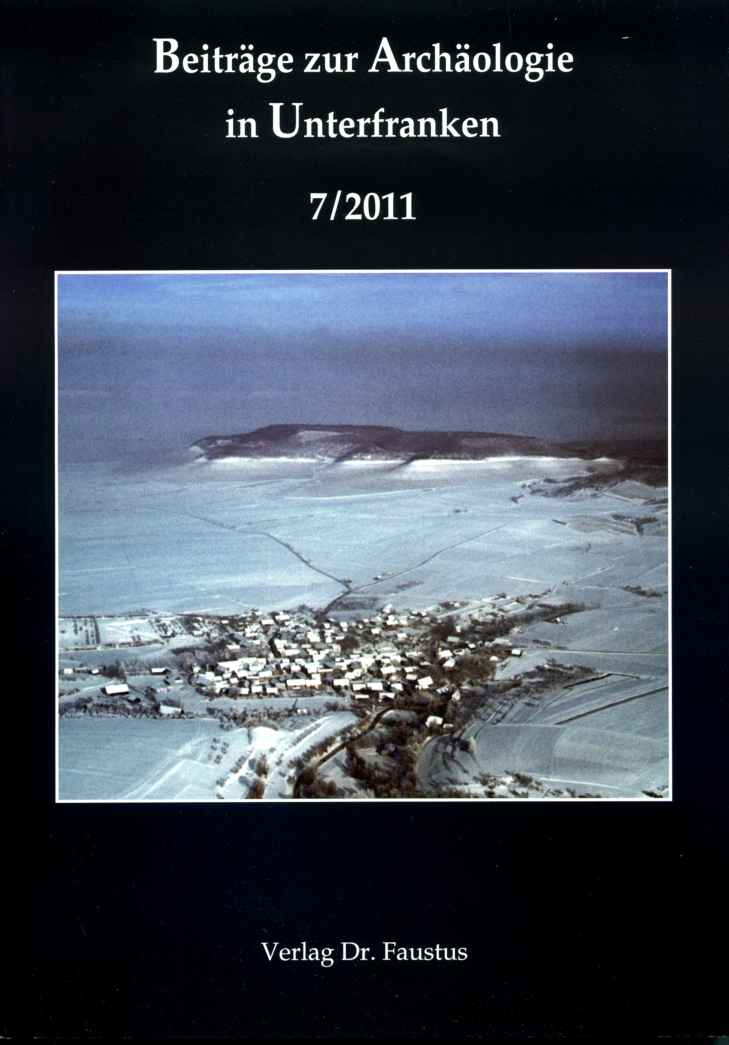
Die dabei gewonnen Erkenntnisse wurden in einer ersten Publikation beschrieben.

Der Gotthardsberg vom Amorbach aus gesehen,
aufgenommen am 22.10.2001.
So sahen die Teilnehmer der Tagung den Berg aus dem
Tagungsraum des Pfarrsaals der katholischen Gemeinde St.
Gangolf in Amorbach. Übringens besteht das Pflaster um die
Kirche in Amorbach aus Buntsandstein,an vielen Stellen
ergänzt durch ein kleinstückiges Porphyr-Plaster aus
Italien!
|

Ausschnitt aus dem Bild links, die Kirche auf dem
Gotthardsberg,
aufgenommen am 22.10.2011
|
"Porphyr-Tagung":
Am Freitag, den 21. und Samstag, den 22.10.2011
fand in Weilbach und Amorbach - in Sichtlinie zum
Gotthardberg - eine kleine Tagung zur Grabung und zum
Porphyr-Fund statt (Programm
als PDF-Datei). Die Tagung wurde veranstaltet von
der ARGE Gotthardsberg und vom Archäologischen
Spessartprojekt aus Aschaffenburg unter der Leitung von
Harald ROSMANITZ. Die Herren FLACHENECKER und ERMISCHER
moderierten und führten durch das Programm.
Dabei wurde der überraschende
Fund der kleinen Porphyrplatte, das Gestein Porphyr und
seine Bedeutung von allen Seiten der Historie, der
Archäologie und der Mineralogie bzw. Petrologie
betrachtet. Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland,
aber auch aus den Ausland:
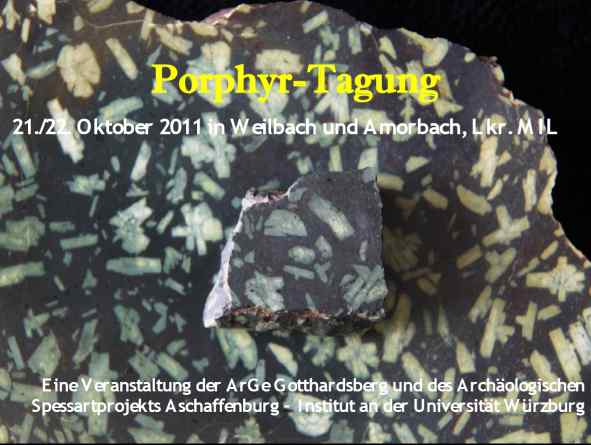
Das Foto zeigt das Stück vom Gotthardsberg auf
einer Platte aus Griechenland.
Weilbach:
Highranking - Porphyr und das deutsche Königtum
Dr. Caspar EHLERS von der Universität Frankfurt a. Main
eröffnete mit "Der ostfränkisch-deutsche König als Bauherr". Herr
Rainer KUHN sprach im Festvortrag über die bemerkenswerten
Funde von antiken Gesteinen im ottonischen Dom zu
Magdeburg (Sachsen-Anhalt), wo sich im Chor drei ca. 3 m
lange Säulen aus Prophyr befinden (2 rot, 1 grün). Dazu
noch ein Taufbecken, hergestellt aus einem antiken Sockel
aus rotem ägyptischen Porpyhr, der einst eine großen
Schale trug. Diese Baustoffe wurden wahrscheinlich als
wertvolle Spolien im Mittelalter aus Italien nach
Magdeburg transportiert.
Amorbach:
Porphyr massenhaft – Der Versuch einer
Zusammenschau
Die weiteste Anreise hatte Frau Orly
SENIOR-NIV von der Universität Tel-Aviv in Israel, die
besonders über die Funde des ägyptischen roten Porphyrs in
Israel berichtete. Weiter wurden von Dr. Christian FORSTER
die Funde von rotem Porphyr und anderen "Buntmarmoren" aus
Lorsch vorgestellt. Herr Dieter BARZ berichtete von einem
rotbraunen (ägyptischen) Porphyr vom Schlössel bei
Klingenmünster. Herr Matthias ZIRM sprach über den Fund
eines Profido verde antico aus dem Frauenstift von
Brunshausen bei Bad Gandersheim.
Dr. Gerhard ERMISCHER trug wortgewltig und bilderreich den Porphyr
in der Liturgie des Mittelalters vor. Prof. Dr. Helmut
FLACHENECKER von der Universität Würzburg trug die archivalischen
Dokumente der Historie des Gotthardsbergs zusammen und Harald
ROSMANITZ versuchte dann, die archäologischen Belege unter dem
Titel Salische Burg und staufisches Kloster – Die Neubewertung des
Gotthardsbergs nach den Ausgrabungen 2011 mit den schriftlichen
Belegen zusammen zu führen. Christine REICHERT zeigte dann die
Fundstelle des Porphyrs vom Gotthardsberg. Und Joachim LORENZ
erklärte in Kurzfassung die petrographische Seite des Porphyrs vom
Gotthardsberg aus geologischer Sicht. Prof.
Dr. Martin OKRUSCH vom Institut für Geographie und
Geologie der Universität Würzburg sprach - anstelle von
Vilma RUPPIENE, die aus gesundheitlichen Gründen nicht
kommen konnte - über die Funde aus Xanten (CUT), bei denen
sich unter ca. 3.000 Gesteinsfragmenten aus dem gesamten
Mittelmeerraum auch einige des grünen Porphyrs aus
Griechenland fanden.
Nicht geklärt werden konnte die Frage, warum man bei den
archäologischen Grabungen in Deutschland vornehmlich die
bis etwa 5 cm große Stücke ehemaliger Platten von ca. 1 -
2 cm Dicke des nur geschliffenen (nicht polierten!) grünen
Porphyrs aus Lakonien findet. Es handelt sich in der Regel
um einzelne Streufunde aus dem kirchlichen Umfeld ohne
einen Zusammenhang.

Herr Rainer KUHN beim Festvortrag in Weilbach (infolge der
schwachen Beleuchtung links schwer erkennbar)
|

Der Rathaussaal in Weilbach mit den ca. 30 Zuhörern der
Tagung am 21.10.2011, die Qualität der Redebeiträge hätte
mehr Besucher verdient!
|

Die ca. 60 Zuhörer der Tagung am Nachmittag lauschen den
Ausführungen von Harald ROSMANITZ zur den Ergebnissen der
Ausgrabung am Gotthardsberg
|

Frau Orly SSENIOR-NIV aus Israel beantwort unter der
Moderation von Dr. Gerhard ERMISCHER Fragen der Teilnehmer
in englischer Sprache. Sie war extra aus Israel angereist,
nachdem Sie über das Internet von der Tagung erfahren hatte!
|

Da Dr. Vilma RUPPINIE von der Universität Würzburg nicht
kommen konnte, spricht Prof. Dr. Martin OKRUSCH über die
Ergebnisse der Dissertation zu den fremden Gesteinen, die
bei den Ausgrabungen der Colonia Ulpia Traiana (CUT) in
Xanten gefunden wurden.
|

Helga LORENZ trug auf der Tagung erstmals einen Anhänger aus
einem in 750er Gold gefasstes Blättchen des lakonischen
Porphyrs (Bildbreite 9 cm) mit einer ausgeprägten Zeichnung
und dessen Wiederholung am Rand in Gold.
Das außergewöhnliche und sehr dekorative Schmuckstück wurde
von Theresia KONRAD aus Aschaffenburg angefertigt
(ehemaliges Schmuckatelier Theresia Konrad, Im Hofgut
Schweinheim, Unterhainstr. 50, 63743 Aschffenburg).
|
Impessionen von der Tagung
Der ausführliche Tagungsband:
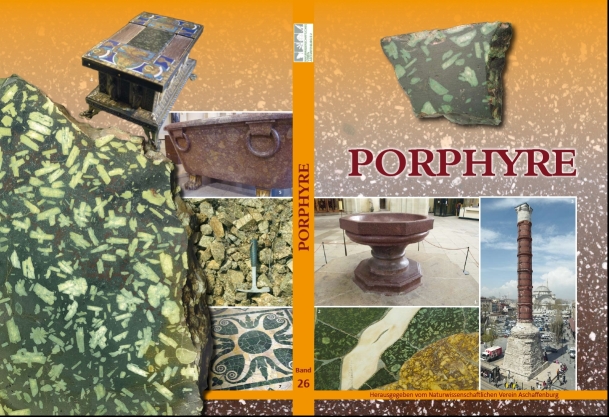
(Entwurf des Umschlags aus Vorder- und
Rückseite)
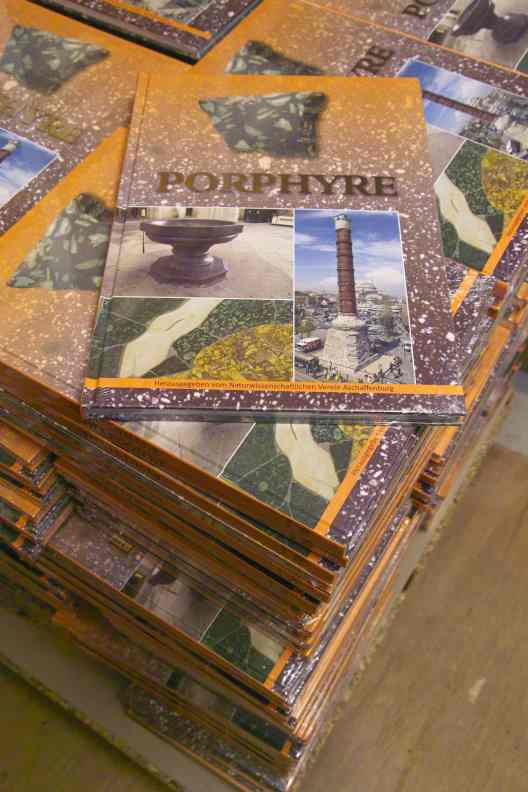
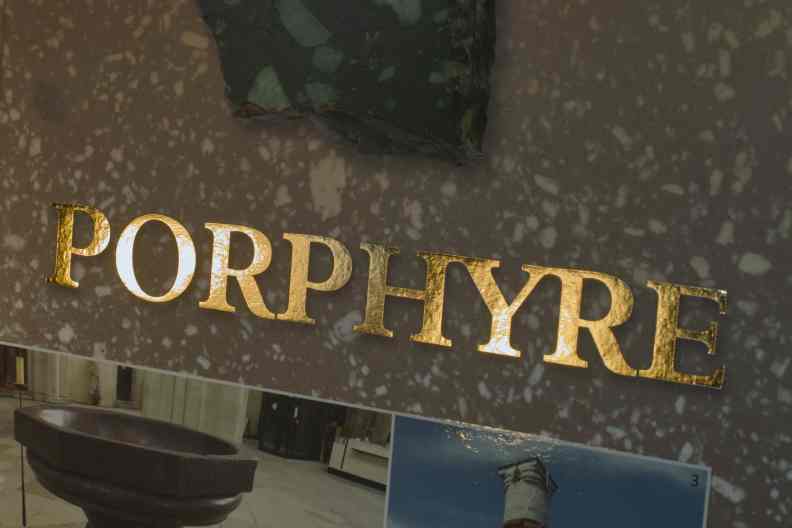
Die Produktion des Buches ist fast fertig. Der Titel in
hochwertigem und schillerndem Gold - ganz passend zun
den
edlen Gesteinen der Porphyre. Der Umschlag ist teilweise
hochglänzend lackiert, so dass die Fotos brillant
hervortreten.
Nach der Veranstaltung gibt es ein umfangreich bebildertes
Buch über die Tagung in all seinen Facetten geben. Es ist
der Band 26 aus der Reihe Mitteilungen des
Naturwissenschaftlichen Museum der Stadt Aschaffenburg,
heraus gegeben vom Naturwissenschaftlichen
Verein Aschaffenburg und vom Spessartprojekt
Aschaffenburg.
Die Beiträge sind u. a.:
- Grußworte der Bürgermeister
von Amorbach und Weilbach
- Porphyre überall
- Joachim Lorenz:
Vorwort
- Christine Reichert &
Harald Rosmanitz:
Der Gotthardsberg –Archäologie auf den Spuren von Macht
und Herrschaft Ein vielschichtiges Forschungsprojekt im
Spessart und nördlichen Odenwald.
- Joachim Lorenz:
„Porfido verde antico“ von Krokees, Lakonien, Peloponnes,
Griechenland. Der originale Fundort zwischen Faros und
Stefania (mit einem Anhang zu den Funden von Karlburg und
Zellingen).
- Caspar Ehlers:
Der ostfränkisch-deutsche König als Bauherr.
- Helmut Flachenecker:
Der Gotthardsberg im Kraftfeld regionaler Interessen: Burg
– Frauenkloster – Propstei.
- Vilma Ruppienė & Ulrich
Schüssler:
Porfido Verde Antico aus Colonia Ulpia Traiana bei Xanten.
- Gerhard Ermischer:
Porphyra sacra.
- Joachim Lorenz:
Rom - die Stadt der Porphyre
- Dieter Barz, Martin Okrusch
und Joachim Lorenz:
Porfido rosso antico von der Burgruine Schlössel bei
Klingenmünster (Pfalz).
- Rainer Kuhn:
Magdeburg und seine Antiken
- Mahrous M. Abu El-Enen und
Martin Okrusch:
PORFIDO ROSSO ANTICO: Die geologische Situation des Mons
Porphyrites am Djebel Dokhan in der ägyptischen Ostwüste.
- Joachim Lorenz:
Porphyre in İstanbul: Die römischen, byzantinischen und
osmanischen Spuren.
- Joachim Lorenz:
Porphyre im Louvre, Paris
- Reinhold Huckriede und Stefan
Dürr (unveränderter Nachdruck):
Geologisches und Kulturgeschichtliches zu einigen
verschleppten Gesteinen in Hessens Boden (Devon-Kalke,
Muschelkalk, Lakonischer Porfido verde antico.
- Andreas Völker:
Buchrezension Spessartführer
- Inhaltsverzeichnis (Index)
- Nachwort.
Das Buch richtet sich an:
Archäologen, Historiker, Geologen, Mineralogen,
Steinmetze, Antiquitätenhändler, Restauratoren, Reisende
in Rom, Paris und Istanbul, Natur- und Wanderführer im
Spessart und an Heimatforscher.
Die Ausgabe erschien im neuen, größeren Format A4, hat 188
S., 228 Abb., 3 Tab., durchgehend vierfarbiger Druck auf
alterungsbeständigem Papier und eine Abgabe zu den
Selbstkosten. Der Verkaufspreis beträgt 27 €. Die
Auslieferung erfolgt nach der Vorstellung am 16.11.2012,
siehe auch der Bestell-Flyer zum Herunterladen.
Vorbestellungen werden ab sofort entgegen genommen; dafür
können Sie das Formular verwenden (PDF-Datei zum
Herunterladen), ausdrucken, ausfüllen und abschicken.
Den Vereinsmitgliedern und der interessierten
Öffentlichkeit in der Region wurde das Buch am Freitag,
den 16. November 2012 um 19.30 Uhr im
Naturwissenschaftlichen Museum in Aschaffenburg
vorgestellt:
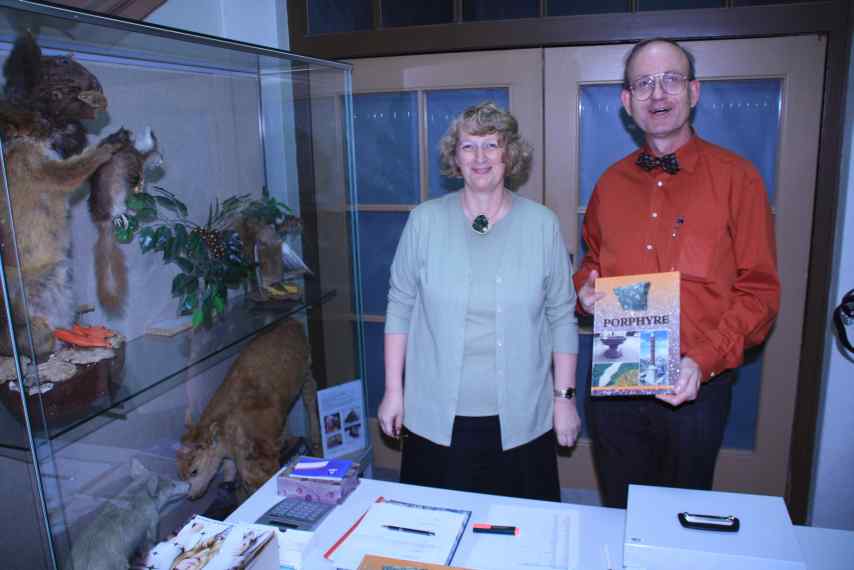
Helga und Joachim LORENZ mit dem zur Abholung bzw. zum
Verkauf stehenden Porphyrbuch
(Foto Johann Thut, Mühlheim)
|

Der Oberbürgermeister von Aschaffenburg, Klaus HERZOG, hielt
eine beachtlicheRede an die über 50 Zuhörer; der weitest
angereiste Autor kam extra aus Magdeburg!
(Foto Johann Thut, Mühlheim)
|

Der Archäologe Harald ROSMANITZ vom Archäologischen
Spessartprojekt berichtete in wenigen Sätzen über die
besonderen Verhältnisse im Spessart und dem Sinn der
Grabungen
in der Vergangenheit (Foto Johann Thut, Mühlheim)
|

Nach dem Vortrag über die Entstehung des Buches und der
Entwicklung seit der Tagung von Joachim LORENZ traf man sich
zum Imbiss und Gedankenaustausch im Foyer
des Museums.
(Foto Johann Thut, Mühlheim)
|

Porphyre machen hungrig: Vom nahen Hotel Wilder Mann gab es
leckere belegte Brötchen, frische Brezeln, Geflügel- und
Obstsalate, Käse und Weintrauben und dazu lokales
Mineralwasser und Apfelsaft.
(Foto Johann THUT, Mühlheim)
|
Das Buch wurde
gefördert durch die Unterfränkische
Kulturstiftung

des Bezirks Unterfranken

der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau

und dem Hotel "Wilder Mann" in Aschaffenburg
.
|
Sie erhalten das Buch in
- Karlstein a. Main, bei Helga
Lorenz, Graslitzer Str. 5
- und auf Mineralienbörsen.
Rezensionen:
"Spessart-Nachrichten"
Porphyre
"...
Es ist im deutschen
Sprachraum nach dem lange vergriffenen Werk von DELBRÜCK
(1932) das erste umfassende Buch über Porpyhre. Neben der
Historie werden auch geologische, mineralogische und
archäologische Gesichtspunkte berücksichtigt. Selbst antike
und neuzeitliche Imitate sind erwähnt."
(Jürgen Schreiner, Spessart. Monatsschrift für die
Kulturlandschaft Spessart, 106. Jahrgang, Heft
November 2012, S. 26).
"Buchbesprechungen
von H.-J. Gregor"
Porphyre
"...
Fazit: ein gelungener Tagungsband über Porphyre mit vielen
wissenswerten Details, Reiseanregungen, Ideen zu weiteren
Studien, Einblicke in Archäologie und Kunstgeschichte, Politik
des Mittelalters und Ideen der Machthaber.
Fazit: Unbedingt zu empfehlen - für einen Preis von 27.- €
fast geschenkt für den dargebotenen Aufwand. Kompliment dem
Schriftleiter Joachim LORENZ und dem Verlag LORENZ."
(Dr. Hans-Joachim Gregor, documenta naturae no. 189.
München 2012, S. 27).

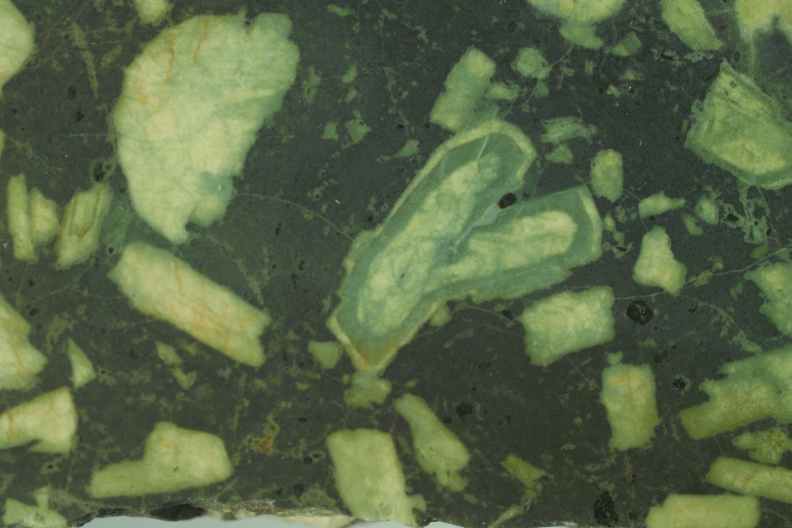
Links:
Eine Bruchfläche des faszinierenden Gesteins Porfido verde
antico mit dem porphyrischen Gefüge und einer andesitischen
Zusammensetzung. Gefunden 1973 am Denkmal zur Schlacht an den
Thermophylen von Prof. Dr. Martin Okrusch, Universität Würzburg
(heute in der Belegsammlung des Instituts für Geodynamik und
Geomaterialforschung), Bildbreite 7 cm.
Rechts:
Zonierter Feldspat-Kristall (alteriert) in einer geschliffenen
Fläche des gleichen Stückes, Bildbreite 3 cm.

Das auch als "Labradorit-Porphyrit" beschriebene, andesitische
Gestein
von der Fundstelle "Maratonisi", Peleponnes Halbinsel,
Griechenland,
Sammlung Martin SCHUSTER, Schöllkrippen, Bildbreite 9 cm. Hier
ist die Grundmasse dunkelbraun und die alterierten
Feldspat-Kristalle
grünlich.
Zur Sicherung des Befundes fuhren wir im heißen Juli
2011 nach Griechenland, suchten das Vorkommen und nahmen
Proben am originalen Fundort:

Die Stadt Krokees (früher Krokee) südlich von Sparti auf dem
Peleponnes, in dessen Nähe sich die Fundstellen befinden,
aufgenommen am 14.07.2011
|

Denkmal aus weißem Marmor auf dem zentralen Platz in Krokees
in Griechenland. Im Sockel sind Bruchstücke des Porphyrs
eingemauert,
aufgenommen am 14.07.2011.
Vor Ort war über das markante Gestein damals kaum etwas
bekannt.
|

Die Fundstelle an einer Straßenböschung bei Krokees in
Lakonien in Griechenland mit Geologenhammer als Maßstab. Das
sind unvergessliche Momente, nach einer langen Fahrt von
2.200 km und 35 °C im Schatten - und auch Stechmücken. Die
in der Sonne liegenden Steine waren so heiß, dass man diese
mit der bloßen Hand nicht angreifen konnte!
Aufgenommen am 14.07.2011.
|

Der Porphyr in plattiger Absonderung als Fundstücke
(Lesestein) aus einem Olivenhain bei Krokees in
Griechenland,
Bildbreite 20 cm
|

Bruchrauhe Fläche des Porfido verde antico aus der Gegend
von Krokees in Griechenland,
Bildbreite 20 cm
|

Anstehender Fels - leider tiefgründig verwittert - des
andesitischen Porphyrsbei Krokees in Griechenland,
aufgenommen am 15.07.2011.
|

Frische Bruchfläche des ornamenatalen Gesteins, welcher auch
als "Krokeischer Stein" bekannt ist,
Bildbreite 6 cm
|

Im berümten Mykene auf dem Peleponnes in Griechenland wurde
das Gestein bereits um 1.250 v. Chr. zur Herstellung von
Kunstgewerblichen Gegenständen verarbeitet, wie man im
örtlichen Museum sehen kann.
Aufgenommen am 14.07.2011
SCHOFIELD (2009:63) vermutet, dass die befestigte Siedlung
durch den Handel mit dem grünen Porphyr zu Reichtum gekommen
sein könnte.
|

Kieselsteine aus verschiedenen Varianten von porphyrischen
Gesteinen aus dem südlichen Peleponnes, gesammelt 2013 von
der sehr rührigen Lena EKERABASI aus Krokees.
Bildbreite 13 cm
(das Stück in der Mitte vorne ist lackiert)
|

Das geschliffen und polierte Gestein zeigt sehr schön die
teils kreuzförmig verwachsenen Feldspäte, aber auch Risse
und ehemalige Gasblasen, die mit weißem Quarz gefüllt sind,
Bildbreite 10 cm
|
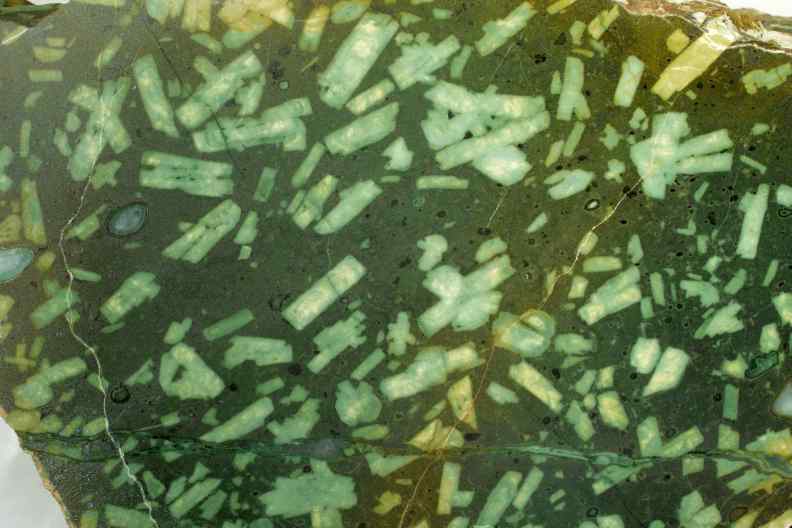
Das Schliffbild offenbart 3 Arten von Rissen: der helle
links ist rezent, der im unteren Viertel parallel zur
Bildkante ist mit Quarz verheilt und der diagonal in der
rechten Hälfte weist eine Vergrünung auf,
Bildbreite 8 cm
|

Unterschiedlich intensiv alterierter, grüner Porphyr,
angeschliffen und poliertes Handstück,
Bildbreite 17 cm.
|

Der nicht grüne Porphyr unter dem Mikroskop: Ein Teil der
Feldspäte sind noch als Plagioklase erkennbar. Diese sind
dann nicht grün.
Bild eines Dünnschliff SE1 mit einer Bildbreite von 5 mm im
polarisiertem Licht bei gekreuzten Polarisatoren
|

Der grüne Porphyr:
In der Grundmasse finden sich zahllose Körnchen aus
schwarzem Magnetit. Die Feldspäte sind teils gänzlich
verändert und im Randbereich mit einem Reaktionssaum (hier
hell) umgeben. Dabei handelt es sich vermutlich um einen
Druckschatten.
Bild eines Dünnschliffs (SE2) bei 5 mm Bildbreite und linear
polarisiertem Licht.
|

Ausschnitt aus dem Stück links mit den stark veränderten
Plagioklas-Kristallen,
Bildbreite 3 cm.
Anmerkung:
Die Bilder der Nahaufnahmen scheinen unscharf, aber das
liegt an den Feldspäten, die nicht ganz scharf gegen das
Gestein abgegrenzt sind (Reaktionssaum), so dass eine
"Unschärfe" entsteht.
|
Barbeitung:
Die Bearbeitung des dichten und harten Gesteins mit der
porphyrischen Struktur gestaltet sich als schwierig. Das
Schlagen eines Handstückes wird von den vielen trennenden
Klüften bestimmt, so dass es nicht einfach ist, ein ausreichend
großes, frisches und rissfreies Stück zu finden, welches auch
durchgängig grün ist. Das Material ist etwas zäh, so dass das
Abschlagen von kleinen Stücken nur bei dünnen Stücken gelingt.
Die Härte beim Sägen wird vom Epidot und auch vom Quarz
bestimmt. Beim Schleifen zeigt es sich, dass die bereits die
Quarze dazu neigen, ein Relief zu erzeugen, da dieser Härter ist
als die Grundmasse. Das Problem ist das Polieren. Hier macht
sich der große Härteunterschied zwischen dem Epidot und dem
Chlorit bemerkbar. Bei einer normalen Politur wird ein leicht
"matter" Glanz erreicht. Wirklich sehr gute Polituren können nur
angebracht werden, wenn neben einem dafür geeigneten
Poliermittel auch ein Zusatz verwandt wird, der die Unterschiede
im Korngefüge ausgleicht.
Dies Fertigkeit war den römischen Steinbearbeitern bekannt und
so finden sich gut polierte Belegstücke aus dieser Zeit in den
Museen. Im Mittelalter war dieses Können verloren gegangen,
weshalb die Porphyrplatten in den Tragaltären immer matt
aussehen. Erst die Steinschneider der Neuzeit waren in der Lage,
nahezu perfekte Polituren zu erzeugen.
 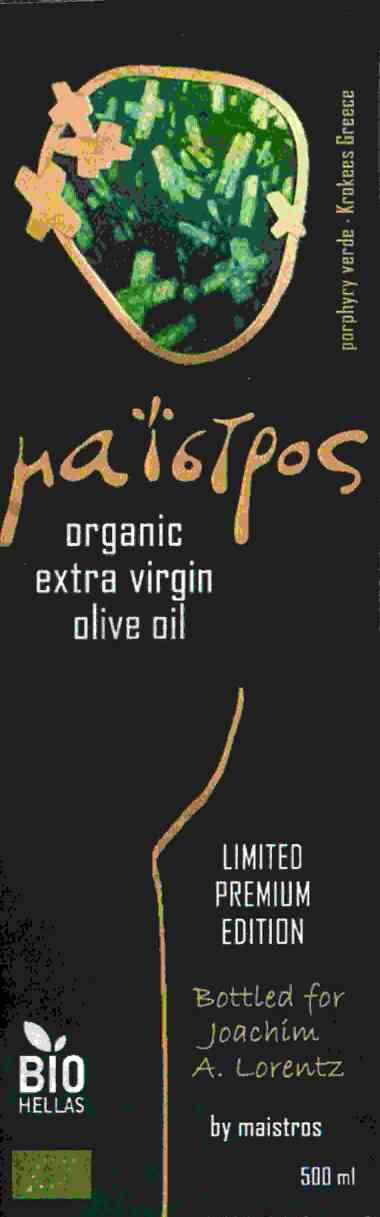 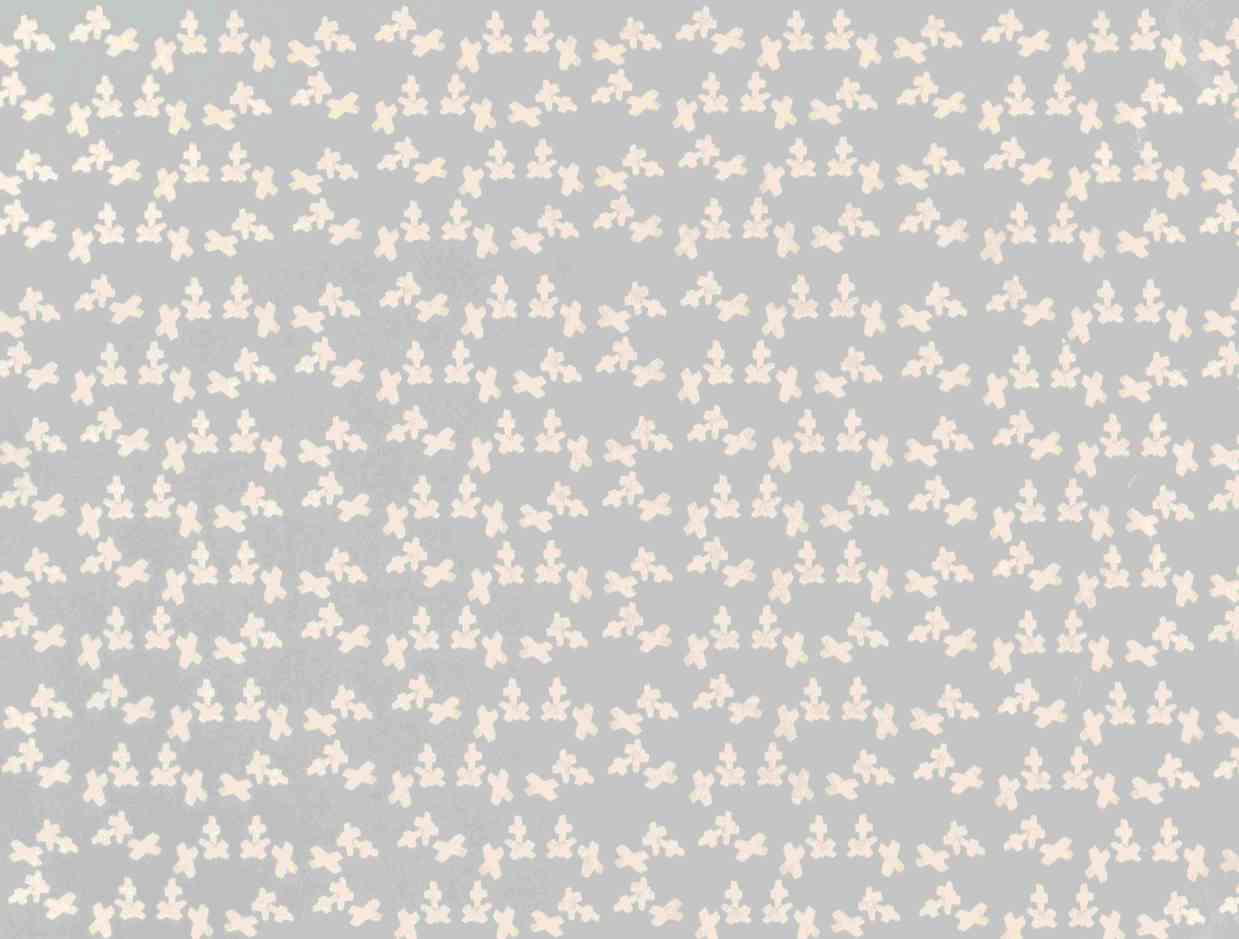
Nun liest man auch in Griechenland im Internet, aufgrund der
sprachlichen Hürden mehr die Bilder. Dabei entdeckte man
diese
Seite und musste erkennen, dass man einen besonderen Stein
im Gemeindegebiet hat. Lena Karampasi erkannte das Potential
und sie positionierten den grünen Prophyr auf das Etikett
ihres Olivenöls. Die Familie produziert ein qualitativ
hochwertiges Öl
und weitere landwirtschaftliche Produkte (die
Internetseite ist in Griechisch verfasst). Die hier
abgebildete Flasche enthält als
Prototyp in der Füllung noch 23-karätige Goldflitter - wie
beim Danziger Goldwasser. Auf den Etiketten der Marke
"Maistros"
ist ein Schmuckstück aufgedruckt. Und auf dem Packpaier ist
das stilsierte Muster der kreuzförmigen Feldspäte
wiederholt.
|
Hauptbestandteile in Gew.-%
|
"Porphyr" von Molai
Probe M819, ohne nähere Beschreibung (nach PE-PIPER &
PIPER 2002)
|
SiO2
|
47,21
|
TiO2
|
1,18
|
Al2O3
|
16,87
|
Fe2O3
|
3,51
|
FeO
|
3,8
|
MnO
|
0,12
|
MgO
|
7,6
|
CaO
|
8,84
|
Na2O
|
3,77
|
K2O
|
0,25
|
P2O5
|
0,2
|
SO3
|
n. b.
|
LOI
|
2,31
|
Summe:
|
99,48
|
| Spurenelemnte in µg/g |
|
Ba
|
112
|
Ce
|
25
|
Co
|
42
|
Cr
|
528
|
Cu
|
42
|
Eu
|
1,28
|
Ga
|
20
|
Hf
|
2,05
|
La
|
10,7
|
Lu
|
0,34
|
Nb
|
5
|
Nd
|
14,7
|
Ni
|
99
|
Rb
|
<5
|
Sc
|
36
|
Sm
|
3,8
|
Sr
|
351
|
Ta
|
0,09
|
Tb
|
0,68
|
Th
|
2,3
|
U
|
1,76
|
V
|
370
|
Y
|
18
|
Yb
|
1,85
|
Zn
|
64
|
Zr
|
94
|
Die Aufschlüsse (Steinbrüche) am Porphyrberg
zwischen Krokees und Stephania
Bei dem griechischen Ort Krokees (früher auch Krokeä) wurde
in römischer Zeit der berühmte grüne Porphyr gewonnen. FIEDLER
(1840:326) zitiert PAUSANIAS (III. Buch 21. 3.; nieder
geschrieben zwischen den Jahren 160 und 175 n. Chr.), der die
schwierige Gewinnung größerer Stücke beschreibt, da es keine
zusammen hängenden Felsen gäbe. Wann die römische
Gesteinsgewinnung eingestellt wurde ist nicht bekannt. Bis zum
Mittelalter war das Wissen um die Herkunft verloren gegangen und
es erfolgte auch keine Gesteinsgewinnung mehr.
Die modernen landwirtschaftlichen Terrassierungen für das
intensive Kultivieren des Olivenbaumes einschließlich einer
Schlauchbewässerung, der Straßenbau aus dem 20. Jahrhundert und
das aktuelle Feldwegenetz haben das Gelände der bis zu 273 m
hohen Berge (Hügel) und auch der Umgebung so nachhaltig
verändert, so dass es schwer ist, zu erkennen, was morphologisch
aus römischer Zeit noch vorhanden ist. Hinzu kommt der Bau von
Gebäuden und die Beweidung mit Schaf und Ziege, die durch den
Tritt auch die Erosion und damit das Gelände nivelieren. Dabei
spielen die angeschnittenen Hangschuttmassen eine große Rolle,
denn es lässt sich kaum erkennen, was als Abraumhalde oder was
als natürliche Bildung zu gelten hat. Hinzu kommen zahlreiche
Schürfe zur Gewinnung von Wegbaumaterial in unterschiedlichen
Altersstufen; dies kann man aus dem Bewuchs und dem Zustand der
Böschungen schließen. Dabei ist es sehr unwahrscheinlich, dass
eine aus erdig verwittertem Gestein bestehende Böschung 1.600
Jahre erhalten sein kann. Die wenigen frei liegenden Felsen und
Blöcke in den Steillagen der Olivenbestände bestehen aus nicht
porphyrischem, vulkanischen Gesteinen mit basaltartigem Aussehen
und andesitischer Zusammensetzung.

Ein - vermutlich römischer - stark verwachsener
Steinbruch am Hügel Psephi (auch Psyphia) neben einem der
vielen Wege für die landwirt-
schaftliche Nutzung als Olivenhain und als Weide für Schafe
und Ziegen. Die hier sichtbaren Felsen an den Böschungen
bestehen nur zum
Teil aus einer porphyrischen Gesteinsform und sind
kleinstückig verwittert und somit für eine Nutzung nicht
verwendbar. Deshalb ist es merk-
würdig, dass sich keine volumetrisch passenden Abraumhalden
erkennen lassen,
aufgenommen am 10.04.2017


Die Fortsetzung des ansteigenden Weges aus dem Foto oben.
Der Weg ist bis auf den anstehenden Fels eingeschnitten
und zeigt den hier zu 10 m mächtigen grünen Porphyr in der
rissigen und angewitterten Form. Blick nach Südosten bis
zum Meer und den Bergen des Südöstlichen Lakoniens. Länge des
Geologenhammers auf dem Porphyr 33 cm,
aufgenommen am 10.04.2017
Für das gegenwärtige Studium der Verbandsverhältnisse
eignen sich besonders die Böschungen der Wege und die sehr
großen und derzeit brach liegenden Terrassen südlich des
Porphyrberges, die vermutlich um 2003 angelegt worden sind. An
den steilen Flanken sind die unterschiedlichen vulkanischen
Gesteine gut, frisch und teils wenig bewachsen
aufgeschlossen.
An zahlreichen Stellen ist das Gestein in der rötlichen wie
auch grünen Variante sichtbar und im Bereich der bis zu 10 m
hohen Böschungen auch in relativ frischer Ausbildung. Der
Porphyr streicht fast NW - SE und fällt mit ca. 60 - 80 ° steil
ein. Die Mächtigkeit variiert von etwa 1 m bis zu ca. 15 m. Die
Verwitterung ist als Folge der tertiären Tiefenverwitterung zu
deuten. Da die Terrassen mit einer dornenreichen und bis zu
einer Wuchshöhe von 1,5 m aufragenden Ruderalflora bestanden
sind, ist das Besuchen der Aufschlüsse nur mit hoch
geschlossener Kleidung zu empfehlen. In den grasigen Flächen
wachsen Zungenständel (Serapias spec.). Eidechsen sind
selten und Schlangen wurden nicht beobachtet.
Der weithin sichtbare Steinbruch als Teil einer Terrasse (GPS
Daten N 36° 51´ 04,4" E 22° 35´ 36,7") führt nur rötlichen und
alterierten Porphyr. Auf Klüften ist Hämatit in schuppiger
Ausbildung zu sehen; dies wird auch von FIEDLER (1840:327)
erwähnt. Derber bzw. feinnadeliger, grüner Epidot mit etwas
Quarz konnte in bis zu faustgroßen Stücken aus den zahlreichen
Klüften in der vulkanischen Gesteinsabfolge geborgen werden.

Verwitterter Porphyr als ca. 25 cm großes Stück, der durch
ein Hämatit-Pigment rötlich gefarbt ist,
aufgenommen am 07.04.2017
|

Kluftsystem, welches mit grünem Epidot und im Zentrum mit
weißem Quarz gefüllt ist. Gesehen an einem Felsaufschluss
der Großterrassen,
Bildbreite 12 cm
|

Kluftfüllung aus strahligem Epidot in einem andesitischen
Vulkanit; gesehen im einem Schurf des Porphyrberges,
Bildbreite 4 cm
|

Stellenweise sind in dem vulkanischen Gestein ehemalige
Gasblasen enthalten. Diese Hohlräume sind meist mit weißem
Quarz (z. T. als gebänderter Chalcedon) ausgefüllt. Im
Hangschutt sind die sehr beständigen Quarze dann isoliert zu
finden. Sie erreichen eine Größe bis zu etwa 8 cm,
Bildbreite 3 cm
|

Basaltischer Andesit mit einer fleckigen Alteration aus
einer Grundmasse aus Chlorit mit Quarz, teils löchrig, so
dass in den kleinen Hohlräumen Quarzkristalle sprossen
konnten. Es sind eindeutig keine Hohlraumfüllungen, sondern
Verdrängungen,
Bildbreite 11 cm |

Völlig epidotisierter Andesit mit einem Harnisch. Mittels
Röntgenverfahren konnte am 06.07.2015 neben Quarz noch
Klinozoisit und Epidot nachgewiesen werden.
Bildbreite 6 cm
|
Bei der geologischen Aufnahme des Gebietes fällt auf, dass
es das porphyrische Gestein auch in einer rötlichen Variante
gibt, die durch Hämatit gefärbt ist. Dieses Gestein ist im
Bereich der großen Terrassen sehr weit verbreitet und meist sehr
stark verwittert - insbesondere die Feldspäte. Die ehemaligen
Plagioklas-Kristalle sind zu einem weichen Ton verwittert. Die
meisten Gesteinsbrocken mit einer porphyrischen Struktur der
Hangschuttdecken (und der in den Straßengräben) sind an der
Oberfläche einfach braun und nicht grün. Bei den größeren
Stücken fällt diese, meist rissige Verwitterungsrinde leicht ab
und so kann man erst nach einem Anschlagen erkennen, ob im
Innern noch frisches Gestein vorhanden ist. Ein weiteres
geeignetes Mittel zum erkennen der Qualität ist das Anschlagen,
denn die rissfreien Stücke klingen hell, während die rissigen
und verwitterten Brocken dumpf klingen; dieses Prüfverfahren ist
bei Steinmetzen seit langem bekannt.
An einer leicht zugänglichen Stelle ist der grüne Porphyr
unmittelbar auf der Südseite der Straße von Krokees nach
Stephania an einer Böschung frei gelegt und hinter dornigen
Ginsterbüschen sichtbar: N 36° 51´ 20,9" E 22° 35´ 17,8". Aber
auch diese Felsen sind kleinstückig durch trennende Klüfte
zerteilt und angewittert. Frische, aber außen angewitterte
Gesteinsproben lassen sich aber ohne Aufwand aus den
Straßengräben und Böschungen des Verwitterungs- bzw.
Hangschuttes im unmittelbaren Umfeld anschauen.

Frühmorgendlicher Blick vom Porphyrberg auf das einige km
entfernte Krokees (weiße Häuser in der Mitte rechts) und
dahinter die schneebedeckten Gipfel des über 2.400 m hohen
Taygetosgebirges,
aufgenommen am 07.04.2017
|

Der hügelige Porphyrberg in der Abendsonne mit dem
schütteren Bewuchs aus Olivenbäumen und den teilweise
terrassierten Hängen,
aufgenommen am 06.04.2017
|

Die südliche Flanke der Straßenböschung an der asphaltierten
Straße von Krokees nach Stephania mit dem anstehenden grünen
Porphyr hinter den Ginsterbüschen,
aufgenommen am 07.04.2017
|

Die 2015 errichtete Stele aus weißem Marmor mit dem
Krokeischen Stein in der Ortslage von Krokees auf dem
zentralen Platz,
aufgenommen am 07.04.2017
War die Gewinnung von großen Werksteinen in der Antike ein
Problem, so gilt dies im abgesuchten Gelände heute noch.
Auch die Schöpfer des Kunstwerks hatten das Problem keinen
großen Block zu finden zu können, mit dem man die Stele
hätte zieren können. So blieb es bei einem "wilden"
Zusammenwürfeln von teilweise anpolierten Stücken.
|
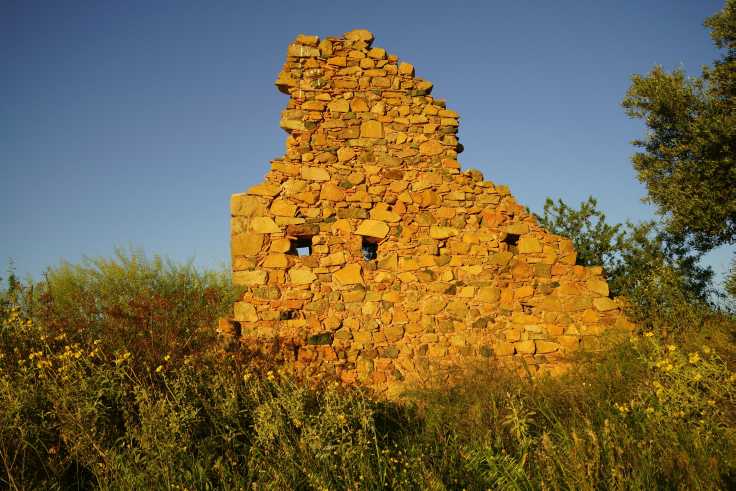
Rest einer Mauer für ein undatiertes Gebäude in der
Morgensonne, dessen Verwendung heute nicht mehr
nachvollziehbar ist. Es steht auf dem höchsten Punkt des
Porphyrberges inmitten eines Olivenhains. Aufgrund der Lage
ist es weithin sichtbar bzw. hat man von dort oben
einen unverstellten, weiten Blick in die hügelige Umgebung
und nach Süden bis zum Meer bei Gythio,
aufgenommen am 07.04.2017
Das aus Porphyr und Andesit erbaute Mauerwerk enthält sehr
dünne Ziegelsteine, wie sie im Altertum hergestellt wurden,
aber ohne die typische Verwendung im Mauerwerk. So kann man
schließen, dass hier die Steine eines ehemaligen antiken
Gebäudes zum Bau mit Holz verwandt wurde. Mit dem Holz im
Mauerwerk könnte eine C14- oder
dendrochronologische Datierung erfolgen.
|

Der basaltische Andesit ohne das porphyrische Gefüge bildet
am Hang rundliche Felsen und auch abgerundete Felsen. Sie
sind die Folge einer Wollsackverwitterung in einem
Feuchtklimat,
aufgenommen am 06.04.2017

Frei liegende Felsen auf der Nordostseite des Hügels mit dem
Porphyr, hier aber aus einem nicht porphyrischen Andesit,
aufgenommen am 06.04.2017
|

Relativ frischer (weil nicht bewachsener) Schurf innerhalb
des Vorkommen des grünen Porphyrs. Das Gestein zerfälllt in
faust- bis kindskopfgroße, scharfkantige Bruchstücke,
aufgenommen am 07.04.2017
|

Anstehender Porphyr an einer der Großterrassen mit vielen
trennenden Klüften, so dass eine Gewinnung von größeren
Gesteinsstücken kaum möglich ist; der Geologenhammer dient
an Größenvergleich,
aufgenommen am 07.04.2017
|

Die frische, kluftarme und porphyrische Variante des
basaltischen Andesits an der Felswand einer Großterrasse mit
dem Geologenhammer als Maßstab,
aufgenommen am 07.04.2017
|

Ein kaum vergrünter Porphyr, bei dem die
Plagioklas-Kristalle noch die Spaltbarkeit aufweisen und die
Grundmasse noch nicht vergrünt ist. Ursprünglich war das
Gestein fast schwarz und die Feldspat-Kristalle weiß;
Bildbreite 10 cm
|
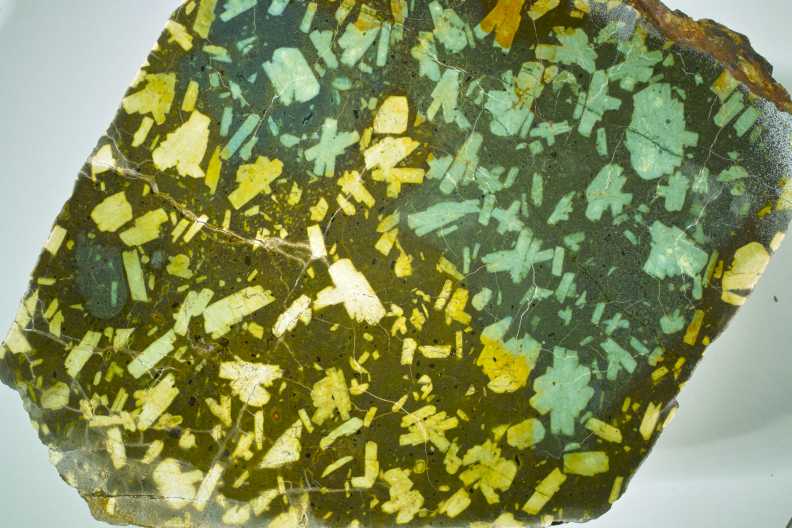
Das Gestein mit dem porphyrischen Gefüge
(geschliffen und poliert). Man erkennt sehr schön die
vom Rand (ehemals Klüfte) aus vordringende Alteration
(Verwitterung) des einst grünen Gesteins als auffällige
Verfärbung in ein helles Braun. Dabei wird das Eisen2+
in Eisen3+ umgewandelt (oxidiert), so
dass die grüne Farbe
verloren geht;
Bildbreite 14 cm
|

Die meisten Bruchstücke im Gelände zeigen die auf der
Außenfläche eine porphyrische Struktur, aber keine grüne
Farbe. Die Verwitterungsschicht ist sehr unterschiedlich
mächtig und kann bei kleinen Stücken das gesamte Stück
durchziehen, so dass kein grüner Porphyr mehr vorhanden ist;
Bildbreite 13 cm
|
Die Verwendung:
Viele Porphyre in Rom, Italien:
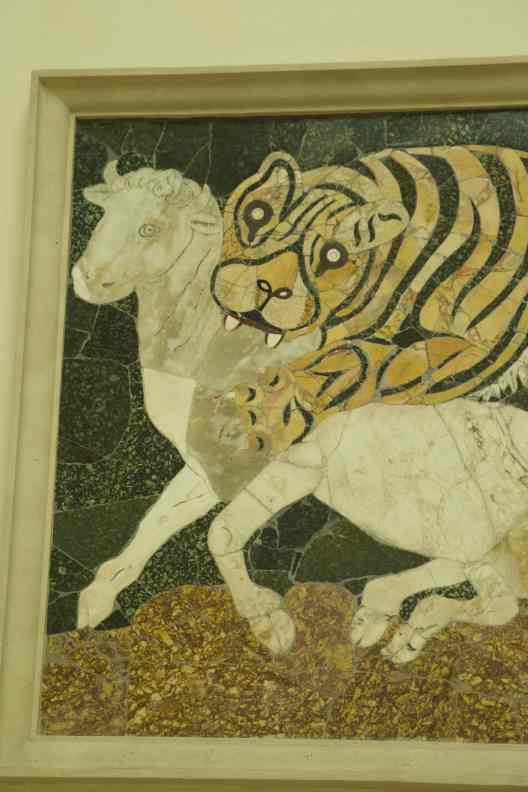
Kapitolische Museen
Im Vorraum zur Gemäldesammlung ist ein ca. 1,5 x 1 m großes
Mosaik an der Wand eingelassen, welches einen Tiger
zeigt, der ein Kalb schlägt. Dabei sind Streifen des Tigers
und der Hintergrund aus dem grünen Prophyr aus Griechenland
gefertigt worden. Ein sehr ähnliches, beeindruckendes Mosaik
ziert das Titelbild des bebilderten Führers, der in vielen
Sprachen verkauft wird!
aufgenommen am 1.6.2012.
|

In der berühmten Kirche Santa Maria Maggiore (St. Maria im
Schnee) findet sich ebenfalls grüner und roter Porphyr. Zur
Kirche aus dem 4. oder 5. Jahrhundert gehört ein 75 m hoher
Turm - der höchste einer Kirche in Rom. Das Gebäude wird von
großen Marmor- und Granitsäulen gestützt.
Über dem Altar wird ein Baldachin von vier großen Säulen aus
rotem Porphyr getragen. Daneben befindet sich das sehr
schlichte Grab des berühmten Baumeisters Gian Lorenzo
BBERNINI (*1598, †1680). Der Kosmatenfußboden aus dem 12.
Jahrhundert ist mit Mosaiken aus Marmor, farbigen
Kalksteinen und Porphyr ausgelegt. Neben viel rotem Porphyr
aus Ägypten ist hier auch grüner aus Griechenland in
erheblichen Anteilen verarbeitet worden: kleine Dreiecke,
Quadrate und kreisrunde Ronden in sehr unterschiedlichen
Größen von rotem und grünem Material im Wechsel. Beim roten
Porphyr erreichen die zahlreichen Ronden (zersägte Säule)
bis zu ca. 1 m Durchmesser, beim seltenen grünen bis etwa 25
cm.
aufgenommen am 31.5.2012..
|
Mosaike mit dem grünem und roten Poprhyre gibt es in folgenden
Kirchen (nach (PAJARES-AYUELA 2002):
- Santa Maggiore, Tivoli
- San Pietro (Chiesa della Carita), Tivoli
- Santa Maria in Trastvere
- Santi Giovanni e Paolo
- Santa Croce in Gerusalemme
- San Clemente


Im Atrium der Kirche San Clemente befinden sich im Boden
zwischen den weißen Marmorbrocken auch zahlreiche
Stücke des grünen Porphyrs aus Griechenland,
aufgenommen von Albert SCHAD aus Rastede am 11.10.2019
- Santi Quattro Coronati
- Santa Maria in Aracoeli
- Vestibül des Casino di Pio IV
- Tempietto di Bramante
- San Clemente
- San Crisogono
- San Lorenzo fuori le Mura

Auch auf dem Petersplatz in Rom wurde grüner Porphyr
als Plastersteine verbaut. Foto von Paul BAYER,
Klagenfurt;
aufgenommen am 04.10.2024
In den Museen des Vaticans in Rom gibt es einen Saal "La Sala degli
Animali" in dem Skulpturen ausgestellt sind, die Tiere aus der
Antike zeigen (der Saal war bei unserem Besuch geschlossen). Hier
wird ein Delphin ausgestellt, der auch aus dem grünen Porphyr
besteht. RIZZI & CASALIS (2003) bilden auf den Seiten 72 - 73
diesen Delphin aus dem grünen Porphyr ab. Das 88 cm lange Kunstwerk
ist aus 2 Stücken zusammen gesetzt. Der Erläuterungstext nennt oben
fälschlich "Serpentino", weiter unten wird lapis lacedaemonium
aufgeführt.
Aachen, Deutschland:


Im Münster von Aachen (Dom) ist in der Ausstattung des steinernen
Verkleidungen des 19. Jahrhunderts im karolingischen Oktogon auch
Porphyr verbaut worden. Nach der Anordnung ist dabei im Fußboden
mehr zufällig als systematisch der Profido verde antico in kleinen
Stückchen verlegt worden (Foto rechts). Neben dem Karlsthron aus
einem einfachen Kalkstein sind dreieckige Stücke aus dem grünen Porfido
verde antico und im Konstrast der rote Profido rosso
antico zwischen dem weißen Marmor eingepasst worden. Der grüne
Porphyr weist alle typischen Merkmale wie Quarzeinschlüsse, zonierte
Feldspat-Kristalle und die größe Härte auf.
Infolge der geringen Helligkeit fallen diese Gesteine im eingebauten
Zustand kaum auf. Die Führer geben in der Regel dazu auch keine
Hinweise;
aufgenommen am 29.04.2012.
Es gibt im Dom-Museum auch zwei kleine Säulen aus grünem Porphyr,
aber dieser stammt aus Ägypten (LORENZ 2012:186ff)

Ein besonders schönes Beispiel einer Fußbodenplatte im Aachener Dom:
Es fällt die kreuzförmige Verwachsung eines zonierten
Feldspat-Kristalls ins Auge. Am rechten und linken Rand sind
oberhalb und unterhalb der Mitte und unten in der Mitte sind
ehemalige Gasblasen mit weißem und grauem Chalcedon gefüllt. Die
Politur ist bereits etwas abgetreten, so dass sich ein leichtes
Relieff gebilet hat. Aber man erkennt auch, dass der Poprhyr
deutlich härter ist als die farbigen Kalksteine der umgebenden
Steine (weißer Marmor aus Carrara, roter Marmor (links) und roter
Kalkstein (rechts); das schwarzweiße Gestein vermag ich nicht
anzusprechen). Besonders am oberen Rand enden die hellen Kratzer im
Marmor am Rand des Porphyrs.
Das Foto vom 25.01.2020 stammt vom Domschweizer Willi Radel
Kloster Lorsch, Deutschland

Der grüne Porphyr als ca. 10 cm, auffallend dicke Platte einer
ehemaligen Wandverkleidung (?) und rechts daneben ein Stück roter
Porphyr in einer Sonderausstellung des Museums in Lorsch, mit dem
berühmten Kloster, aufgenommen am 29.07.2012
Residenz München, Deutschland

Achtung Fälschung!
In der Residenz in München sind zahlreiche Flächen mit einem roten
und seltener auch grünen "Porphyr" verkleidet, der bei näherer
Betrachtung sich als Imitat aus Stuckmarmor (auch bekannt als
Scagliola) heraus stellte, aufgenommen am 25.07.2012

In der Schatzkammer der Residenz ist neben einem sehr flachen
Tragaltar mit einer großen grünen Porphyrplatte (mit auffallend
schmalen Feldspatkristallen) ein sehr großes, mit viel Gold
verziertes Altarciborium des Königs Arnulf von Kärtner aus der Zeit
um 870 - 890 ausgestellt. In dem Unterteil ist eine große,
geschliffene Porpyhrplatte eingearbeitet. Sie zeigt den
"Normaltypus" des Porfido verde antico mit den große, auch zonierten
Feldspatkristallen. Auch diese Platte ist auch nicht poliert. Die
Einpassung in den steinernen(?) Rahmen ist nicht sehr sorgfältig
ausgeführt worden, so dass ein wechselnd breiter, umlaufender Spalt
besteht.
Sigtuna, Schweden
Etwa 50 km nordwestlich von Stockholm liegt Sigtuna am Mälaren-See.
Sie gilt als die älteste Stadt in Schwden mit heute ca. 8.500
Einwohnern. Hier fand man bei ärchälogischen Grabungen einige
Porphyrplatten aus dem grünen Porfido verde antico von
Griechenland. Es handelt sich vermutlich um Platten, die über die
Wikinger, wahrscheinlich aus dem deutschen Sprachraum nach Schweden
kamen. Einige Platten sind infolge von Brandeinwirkungen grau
entfärbt. Der Fundzusammenhang weist auf eine Zeit ins 10. oder 11.
Jahrhundert hin (TESCH 2007, 2008).
Bemerkenswert ist der Fund einer dicken, grünen Porphyrplatte in
einer Kirche mit einem Altar aus dem 16. Jahrhundert in der
Ortschaft Örberga (ein Weiler südwestlich Vadstena bei Motala am
Vättern-See). Dieser wurde seinerzeit mit einer neuen Altarplatte
überdeckt und damit die eingelassene Porphyr-Platte erhalten. Bei
einer Renovierung wurde die Steinplatte in der alten Altarplatte
entdeckt. Ein weiterer Fund aus grünem Porphyr stammt aus einem Grab
des 11. Jahrhunderts in Varnhem (Ort zwischen Skara und Skövde) in
Västergötland (Sten TESCH, persönliche Kommunikation am 04.12.2012).
Trier (Mosel)
Eine der in römischer Zeit bedeutende Stadt war Trier. Hier steht
eine Palastaula, ein kaiserlicher Großbau aus römischer Zeit (um
310), der heute als schlichte evangelische Kirche genutzt wird. In
römischer Zeit war der Innenraum vom Fußboden bis zur Decke
unvorstellbar prachtvoll mit etwa 50 verschiedenen Gesteinen aus dem
gesamten römischen Reich verziert, darunter auch der grüne Prophyr
aus Griechenland. Die Archäologin und Geologin Frau Dr. Vilma
Ruppiene von der Universität Würburg hat diese von Archäologen,
teils vor langer Zeit, gefundenen Steine untersucht und ihre Natur
wie auch die Herkunft geklärt. Ein sehr gut und sehr aufwändig
gemachter Kurzfilm
zeigt die Methode und das Ergebnis einer virtuellen
Wiederherstellung der einstigen Gesteins-Pracht in dem auch für
römische Zeiten riesigen Hallenbau ohne Säulen.
Köln am Rhein, Deutschland
Köln ist berühmt für seine römischen Reste und Funde. Aber es finden
sich nur spärliche Ausstellungsstücke mit dem grünen oder roten
Poprhyr.


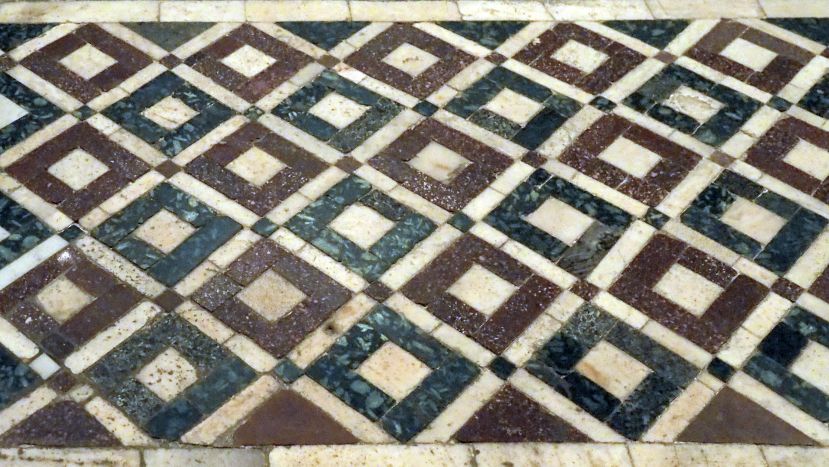
In Dom zu Köln befindet sich in der Stephanskapelle der durch ein
schweres, über 3 m hohes Eisengitter gesicherte Sarkophag des
Erzbischofs von Köln, Gero (*900 †976)
(aufgenommen am 15.12.2012). Im Deckel sind um weiße Marmorquadrate
Einfassungen aus grünem und rotem Porphyr zur Anwendung gekommen, so
dass ein quadratisches Muster zu erkennen ist.
Das Detailfoto rechts zeigt die Oberseite der Deckplatte der
Grabtumba aus grünem Porphyr aus Griechenland und rotem aus Ägypten,
unterbrochen von Stegen und Quadraten aus weißem Marmor. Dabei
handelt es sich um den einzigen erhaltenen Rest des Fußbodens des
Vorgängerbaues des heutigen Doms; aufgenommen am 23.10.2019 von
Albert SCHAD aus Rastede.


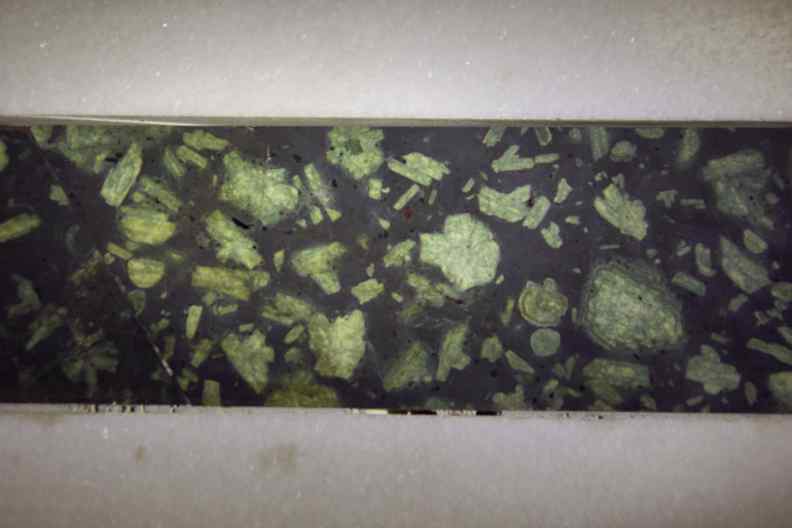
Im Römisch-Germanischen Museum neben dem Dom ist im Kellergeschoss
eine hübsche, rechteckige Platte (etwa 17 x 9 cm, Inventar-Nr.
38,940) aus grünem Porphyr ausgestellt, welches als Salbenreibstein
eines Arztes aus Köln an der Sechtemer Straße (gestorben kurz nach
Mitte des 1. Jahrhunderts) in der römischen Zeit genutzt wurde. Die
Platte aus einem Brandgrab ist nur ca. 1 cm dick, allseits
bogenfömig nach unten abgerundet und oberseits nur geschliffen -
nicht aber poliert.
Im Obergeschoss wurde ein römischer Wandvertäfelung nachempfunden
(Bild in der Mitte), dessen Materialverwendung für Köln nachgewiesen
ist. Dabei wurden neben diversen Marmoren auch 2 Ronden aus rotem
Porphyr symmetrisch eingelassen. In ca. 1 m Höhe ist zwischen weißem
Marmor aus Carrara ein ca. 5 cm breites Band aus grünem Porphyr
montiert worden. Durch geschicktes schräges Ansetzen wird der
Eindruck erweckt, dass das Band aus 3 Teilen besteht. Erst bei
näherem Hinsehen sind die Ansätze zu erkennen (Bild rechts,
aufgenommen am 15.12.2012).
Das Schnütgen-Museum besitzt in der ehemaligen Sakristei der als
Museum genutzten Kirche einen mittelalterlichen Tragaltar aus
norddeutscher Produktion mit vergoldetem Kupfer, Messing und
geschwärztem Silber mit einem Kern aus Eichenholz. Auf der
Unterseite ist ein Evangelistenrelief durch einen Spiegel sichtbar
gemacht. Auf der Oberseite ist ein ca. 7 x 3 cm großes grünes
Porphyrplättchen mittig quer eingelassen. In der neben der Vitrine
aufgehängten Erläuterung wird das Material fälschlich als
"Serpentin" beschrieben.
Ein weiterer, in einem aktuellen Ausstellungskatalog aufgeführter
Tragaltar mit einer großen, grünen Porphyr-Platte war nicht mehr
ausgestellt.
Berlin, Deutschland
Das wissenschaftshistorisch bedeutendste Stück des grünen Porphyrs
befindet sich in der riesigen Gesteinssammlung des Museums für
Naturkunde in Berlin an der Invalidenstraße. Das Stück stammt aus
der Sammlung des sächsischen Bergbaufachmanns Karl Gustav Fiedler
(FIEDLER 1840:326ff) war wohl der erste geologisch versierte
Forscher der die Fundstelle des Porphyrs südlich von Krokees an der
Straße nach Marathonisi, nach der Entdeckung durch einen Franzosen
wenige Jahre vorher, Ende August 1835 besuchte).
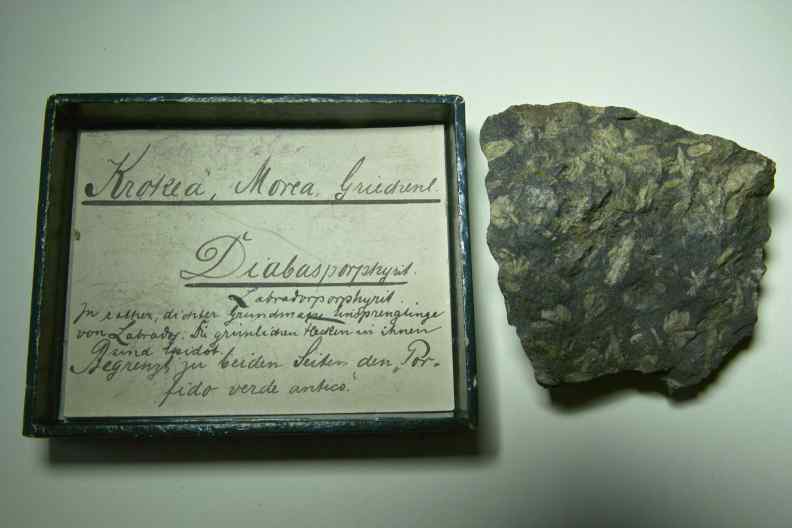
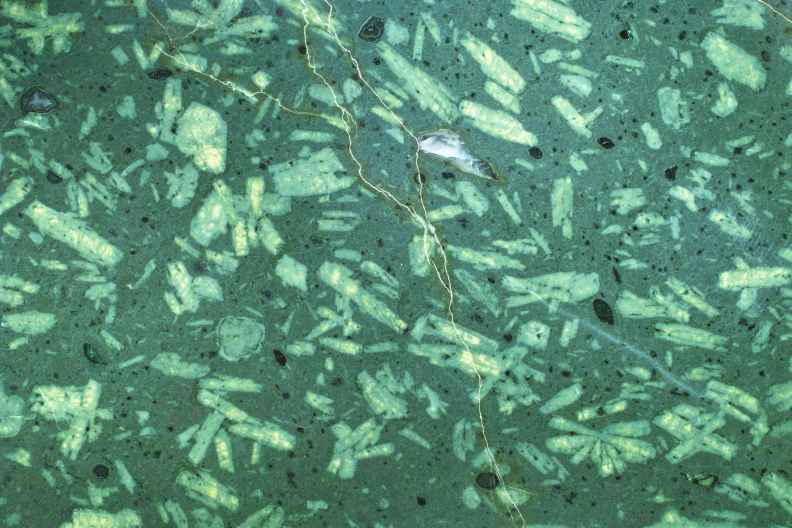
Links: Kleines Bruchstück des Porfido verde antico von Krokaea,
Griechenland, ex. Collection FIEDLER, mit einer Pappschachtel und
dem
von Hand geschriebenen Sammlungszettel aus dem späten 19.
Jahrhundert, Sammlung Nr. 2013-00703 (nicht ausgestellt). Es
handelt sich um
eine Gesteinform mit kleineren Feldspatkristallen,
Bildbreite ca. 14 cm.
Rechts: Vergleichsstück der Gesteinsvariante mit den kleineren
Feldspatkristallen (geschliffen und poliert), gefunden 2015,
geschliffen und
poliert,
Bildbreite 9 cm.
Das Kunstgewerbemuseum in Berlin beherbergt 2 Tragaltäre
- Tragaltar des Adelvoldus aus dem Welfenschatz aus Holz mit
Silberblech und Niello plattiert und etwas Alabaster
(Kunstgewerbemuseum Berlin Inventar-Nr. W8). Die Platte besteht
aus grünem Porphyr in einer quadratischen Form bei ca. 15 x 15
cm - eine außergewöhnlich große Platte mit reichlich kreuzförmig
verwachsenen Feldspat-Kristallen. Der Altar wurde vermutlich in
Braunschweig im 11. Jahrhundert hergestellt.
- Tragaltar mit Bergkristallsäulen aus dem Welfenschatz
(Kunstgewerbemuseum Berlin Inventar-Nr. W9). Der längliche
Tragaltar aus Holz ist mit teilvergoldetem Silberblech und
Niello plattiert und beiderseits seitlich mit 6 kleinen runden
Säulchen verziert. Das Kunstwerk wurde in Niedersachen im 1.
Dritel des 12. Jahrhunderts gefertigt. Die ca. 15 x 10 cm große
Altarplatte besteht aus rotem Porphyr.
Der Katalog zu einer Ausstellung (LAMBACHER 2010) zusammen mit dem
Dom-Museum Hildesheim geht auf die Altarsteine nicht näher ein;
darin sind aber 4 Tragaltäre mit rotem und grünem Porphyr
beschrieben und abgebildet.
Freiberg, Deutschland
In der riesigen Sammlung der TU Freiberg liegt in der
Gesteinssammlung eine schöne geschliffen und polierte Platte aus
grünem Porphyr.

Sie ist beschriftet mit: Andesit. "Porfido verde antico"
(Diabasporphyit), Lebesova, Pellepones, Griechenland.
St. Petersburg, Russland

In der weltberühmten Eremitage (Museum) in St. Petersburg befinden
sich einige Tische in Pietre-Dura-Technik, die sowohl den grünen
als auch den roten Porphyr als kleine Gesteinsplatten enthalten.
Aber es ist merkwürdig, dass es keine Kunstwerke gibt, die
ausschließlich aus dem grünen Porphyr bestehen.
Hildesheim, Deutschland
Im Domschatz von Hildesheim befindet sich ein Tragaltar mit einer
Platte aus rotem Porphyr:
- Tragaltar vom Anfang des 11. Jahrhunderts aus dem Hildesheimer
Domschatz aus Holz mit teilvergoldetem Silber (Dom-Museum
Hildesheim Nr. DS 26) mit einer länglich, rechteckigen Platte
aus rotem Porphyr von ca. 18 x 5. Die Platte weist im Bereich
1/4 der Länge einen Riss auf
 Tragaltar aus der 2. Hälfte des 12.
Jahrhunderts (Dommuseum Hildesheim Nr. DS 25)
Walross-Elefenbein, Emaille, vergoldetes Kupferblech auf einem
hölzernen Kern mit einer Platte aus dem grünen Poprhyr aus
Griechenland als Altarstein; in der Erläuterung des
(Metropolitan) Museums (in New York) fälschlich als "Serpentin"
bezeichnet.
Tragaltar aus der 2. Hälfte des 12.
Jahrhunderts (Dommuseum Hildesheim Nr. DS 25)
Walross-Elefenbein, Emaille, vergoldetes Kupferblech auf einem
hölzernen Kern mit einer Platte aus dem grünen Poprhyr aus
Griechenland als Altarstein; in der Erläuterung des
(Metropolitan) Museums (in New York) fälschlich als "Serpentin"
bezeichnet.
Darmstadt, Deutschland
Im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt befindet sich ein Tragaltar
mit einer Platte aus grünem Porphyr:
- Tragaltar (ca. 22 x 12 x 7 cm) aus dem späten 11. Jahrhundert
vom Niederrheim, hergestellt aus Holz mit einer figürlichen
Verkleidung aus Walroßzahn und Bronzefüßen. Die Oberseite ist
mit einer länglichen, rechteckigen Platte aus grünem Porphyr von
ca. 15 x 5 cm (EBERT-SCHIFERER 1996:54).
Saalburg, Deutschland
In dem Nachbau eines Kohortenkastells werden zahlreiche Funde aus
dem Kastell wie auch der Umgebung ausgestellt. In einer Vitrine mit
kosmetischen Werkzeugen und Gefäßen liegt je eine kleine Platte des
grünen Porphyrs aus Griechenland und des roten Poprhyrs aus Ägypten.
Dies belegt, dass selbst in Kastellen am Limes (Grenze) solche
Gesteine Verwendung fanden.
Oldenburg, Deutschland
Im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg
(Niedersachsen) befindet sich ein Tragaltar mit einer ovalen Platte
aus grünem Porphyr:
- Tragaltar aus dem 11. Jahrhundert aus vermutlich westfälischer
Herstellung, gefertigt Walrosszahn, welches wohl einst vergoldet
war. Auf der Oberseite ist eine ovale ("Zweirund") Platte aus
grünem Porphyr eingelassen. Die geschliffene Platte weist links
einen Riss auf (Inventarnummer LMO 3.575).

gesehen von Jörg LIEBE.
Baesweiler, Deutschland
Bei eine Grabung der ehemaligen Via Belgica von Kön nach
Boulogne-sur-mer im Herzen von Baesweiler wurde eine 1 cm dicke und
etwa 8 x 6 cm große Platte aus dem griechischen Prophyr gefunden
(AEISSEN 2015).

Platte des grünen Poprhyrs von Baesweiler,
Foto freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Archaeonet GbR,
Zafer Görür.
Wien, Österreich

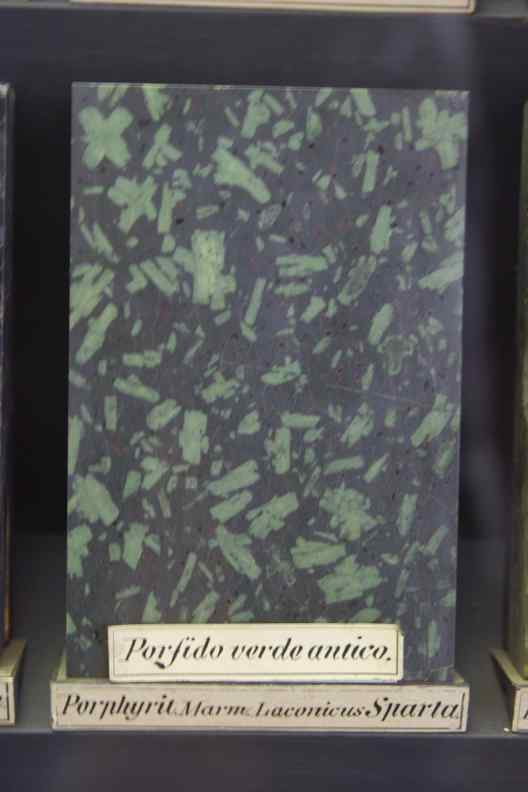 Das Naturhistorische Museum mit seinen sehr
großen Sammlungen am Burgring besitzt in seinen
Gesteinssammlungen zahlreiche geschliffene und polierte, etwa
handgroße Platten des grünen Porphyrs von Krokees. Die alte
Beschriftung des Stückes lautet: "Porfido verde antico.
Porphyrit. Marm. Lacionicus Sparta". Diese Belegstücke stammen
wie die anderen in der Virtine im Saal 1 zum größten Teil aus
römischen Bauten in Rom.
Das Naturhistorische Museum mit seinen sehr
großen Sammlungen am Burgring besitzt in seinen
Gesteinssammlungen zahlreiche geschliffene und polierte, etwa
handgroße Platten des grünen Porphyrs von Krokees. Die alte
Beschriftung des Stückes lautet: "Porfido verde antico.
Porphyrit. Marm. Lacionicus Sparta". Diese Belegstücke stammen
wie die anderen in der Virtine im Saal 1 zum größten Teil aus
römischen Bauten in Rom. - Im Domschaft des Stephans-Doms befindet sich ein mit Gold
verziertes Reliquiar, in dessen Innern sich hinter Glas ein ca.
25 cm hoher, quaderförmigere grüner Porphyr befindet. Das
Gestein gleicht den Säulen in Aachen; sogar eine mit Epidot
ausgekleideten Kluft ist zu sehen.
- In der Schatzkammer der Hofburg in Wien steht ein ca. 70 cm
hoher Tabernakel mit einem Ostensorium für einen Partikel vom
Kreuz Christi, hergestellt 1711 in Rom (Nr. 165), der aus
reichlich rotem Porphyr besteht.
London, Großbritannien
- Westminster Abbey:
In der durch die Krönungen bekannten Westminster Abbey befindet
sich ein Kosmaten-Fußboden (unter der Verwendung von grünem und
rotem Porphyr; um 1267 verlegt) nach italienischem Vorbild
vor dem Hochaltar. Den sieht man beim Besuch aber kaum, weil die
Absperrung an den unteren Stufen gestellt wird. Es kann hier
kein Foto gezeigt werden, da das Fotografieren verboten ist und
durch viele Personen überwacht wird. Der Fußboden wurde 2011
restauriert und wohl kaum bekannt.
Neben dem Hochaltar steht auch der Sarkophyg von König Henry III
(1207 - 1272) aus einem Kalkstein (?), der mit einfachen
Mosaiken nach Kosmatenart verziert ist, die im unteren Teil
weitgehend entfernt sind (auf der Seite der englischen Wikipedia
ist ein Foto zu sehen, aber wegen des Blitzes kann man die
Gesteinsnatur der Platten kaum erkennen). Darin sind rechts und
links 2 quadratische Platten (ca. 20 cm Seitenlänge, auf den
Ecken stehend) aus grünem griechischen Porphyr und in der Mitte
eine runde Platte (ca. 20 cm Durchmesser) aus dem gleichen
Material eingelassen. Diese, etwa 1,5 cm dicken Platten (die
Ränder sind wenig bearbeitet) bestehen aus dem dunklen, mit
schmalen Feldspat-Leisten durchsetzten Material und sind
auffallend eben bei einer nahezu perfekten Politur. An den
beiden Schmalseiten waren zusammen weitere 4 Platten (ca. 15 x
20 cm) aus dem ägyptischen roten Porphyr eingelassen Vermutlich
sind auf der nicht für Besucher zugänglichen bzw nicht
sichtbaren Front- und Oberseite des Sarkophags weitere Platten
verarbeitet worden.
Darüber steht ein weiterer Sarkophag (vermutlich die Frau), die
auf der Rückseite (nicht sichtbar) eine Platte aus dem roten
ägyptischen Porphyr von ca. 1,3 x 0,4 m trägt. Das brekziöse
Material ist glänzend poliert, etwas wellig (typisch für diese
Gesteinsvariante, die eine unterschiedliche Härte besitzt) und
von 3 Rissen durchzogen. Auch hier ist die Frontseite und
Oberseite (?) vermutlich mit weiteren Platten geziert.
Gegenüber dem Grab von König Richard II. befindet sich eine
namenlose Nische mit einem kleinen Sarkophag,in dessen Oberseite
eine ca. 15 cm messende, runde Scheibe aus grünem griechischem
Porphyr in einem kleinteiligen und stark beschädigten Mosaik
eingebaut ist.
- Ein Stück an einer Jungfrau in der Andacht im Victoria and
Albert-Museum in London (A I-11927) (WARREN 1969:133) -
nicht gesehen.
Eine römische Amphore soll sich in der Northwick Collection
(Captain Spencer-Churchill) befinden (WARREN 1969:133).
Canterbury, England:
Mosaik in der Kapelle von St. Thomas in der Kathedrale von
Canterbury (PAJARES-AYUELA 2002:22).
Venedig, Italien



Die Erbauer der Scoula Grande di San Rocco in Venedig hatten sehr
reichlich grünen und auch roten Porphyr zur Verfügung. In der aus
weißem Marmor bestehenden Außenfassade des Palastes der größten
Bruderschaft Venedigs aus dem 16. Jahrhundert sind geschätzt etwa
50 polierte Platten bis zu einer Größe von ca. 45 x 45 cm
eingelassen. Die ovale Platte im Bild rechts hat eine Höhe von ca.
15 cm und befindet sich rechts neben dem Eingang.
Der 44 x 17 m umfassende, steinerne Fußboden im Obergeschoß unter
den prachtvollen Deckengemälden besteht aus perfekt geschliffenen
Einlegearbeiten aus Marmor usw. unter reichlicher Verwendung
ebenfalls von rotem und grünem Poprhyr. Das Gebäude dürfte den
größten Bestand an grünem Porphyr überhaupt besitzen (aufgenommen
am 25.06.2016).

Schale aus dem grünen Porfido Verde Antico in San Marco (Foto Jörg
LIEBE).

In dem Palast Ca d´Oro in Venedig ist zwischen dem weißen Marmor
grüner und roter Porphyr eingesetzt (Foto Jörg LIEBE).
Ravenna, Italien


Das unscheinbare achteckige Battistero Neoniano in Ravenna stammt
aus dem 5. Jahrhundert und ist innen reich mit Mosaiken und an den
Wänden zahlreichen Porphyrplatten bestückt, darunter auch
reichlich grünem Porphyr als Einlegearbeit und auch als große
Platten, die aus kleinen Stücken zusammen gesetzt sind
(aufgenommen am 26.06.2016). Die Größe und Machart der Platten,
deren Einfassungen und Größe erinnern an die in der Hagia Sophia
in Istanbul.


Auch die außen schlichte Backstein-Kirche San Vitale (erbaut 526 -
547 weist einen beeindruckenden Schmuck aus Porpyhr auf.
Insbesondere der Fußboden ist unter der Verwendung von rotem und
grünem Porphyr verlegt worden. Darunter sind Rotae eingelassen,
die aber aus Einzelstücken zusammen gesetzt wurden (aufgenommen am
26.06.2016). Auch hier zeigt es sich, dass es von dem Material aus
Griechenland nur ganz wenige Stücke gibt, die 50 cm übersteigen.


In der Kirche Sant´Appolinare Nuovo (erbaut 493 - 496) befinden
sich auf zwei Säulen aus Calcit die behauenen und nicht
geschliffenen Kapitelle aus dem grünem Porphyr aus Griechenland.
Sie tragen heute keine Last mehr, so dass vermutet werden kann,
dass sie früher einem anderen Zweck oder an anderer Stelle
standen. Infolge der Dunkelheit und der randlichen Aufstellung in
der Kirche ist das Gestein der beiden Kapitelle schwer erkennbar
(aufgenommen am 26.06.2016).
Florenz, Italien

Vasenförmige Urne mit Bronze von 1728 im Museo delle Argenti des
Palazzo Pitti in Florenz. Das zugehörige Schild (nicht im Foto)
weist das Material fälschlich als "Serpentino" aus. Es handelt
sich aber zweifelsfrei um den grünen Poprhyr aus Griechenland.
Aufgenommen von Dr. Jörg LIEBE im Mai 2015.
Tuscania, Italien:
Grüner Porphyr und Roter Porphyr im Mosaik im Türrahmen der
Kirche San Pietro (PAJARES-AYUELA 2002:38ff).
Bari, Italien:
Grüner Porphyr im Mosaik im Chor der Basilika di San Nicola
(PAJARES-AYUELA 2002:21).
Ostia, Italien:
Opus sectile als Wandmosaik mit grünem Porpyhr der Porta Marina
(PAJARES-AYUELA 2002:143f).
Monte Cassino, Italien:
Das sehr alte Kloster liegt zwischen den Städten Rom und Neapel.
Im Bodenmosaik ist auch grüner Porphyr verarbeitet worden. Es ist
ein Wunder, dass der Boden des in dem im 2. Weltkrieg zerstörten
Klosters überlebt hat.


Kosmatenarbeit mit grünem Porphyr (Ronde) und rautenförmigem roten
Porphyr in einem
Kalkstein und weißem Marmor im Boden des Klosters Monte Cassino,
aufgenommen am 01.11.2018 von Judith RÖSSLER.
Bajae, Golf von Neapel, Italien:
In der antiken Stadt finden sich im Fußboden auch Platten des grünen
Porphyrs.

2012 gesehen und fotografiert vom Archäologen Dr. Hans-Otto SCHMITT
aus Gelnhausen.
Knossos, Kreta, Griechenland:
Als Rohmaterial im "Gesteinslager" bzw. der "Werkstatt" von Knossos,
Kreta, Griechenland (WARREN 1969:133). Bilder davon finden sich im
Internet.
Veliko Tarnovo, Bulgarien

Im Archäologischen Museum in der alten Stadt Veliko Tărnovo in der
Mitte von Bulgarien befinden sich in den Vitrinen mehrere Platten,
flache Steine und Tesserae zusammen mit Marmor aus Grabungen. Dies
ist nicht verwunderlich, denn die Römer haben einst auch in
Bulgarien (Provinz Thrakien) regiert, aufgenommen von Helga LORENZ
am 06.09.2017.
Duff Hounse, Banff, Schottland

In einer Vitrine im Duff House (ein Schloss aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts, nordwestlich von Aberdeen gelegen) steht eine Vase
aus dem grünen Porphyr zusammen mit anderen Antiken aus Stein und
Keramik. Man beachte den abgebrochenen Rand daneben. Aufgenommen
von Helga LORENZ am 06.05.2018.
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen im Albertinum

In der provisorischen Depotausstellung der antiken Kunstwerke
befindet sich eine große, runde italienische Deckel-Vase des 17.
Jahrhunderts (Hase5 150/393) aus dem grünen Poprhyr aus
Griechenland. Vasen mit Deckel, und besonders große, dieser Zeit
aus dem grünen Gestein sind höchst selten, da Werksteine in der
Größe kaum zur Verfügung stand. Da die Herkunft damals nicht mehr
bekannt war, kann das Stück nur aus römischen Spolien gefertigt
worden sein.
Aufgenommen am 05.07.2019
Schleusingen, Musuem in der Bertholdsburg
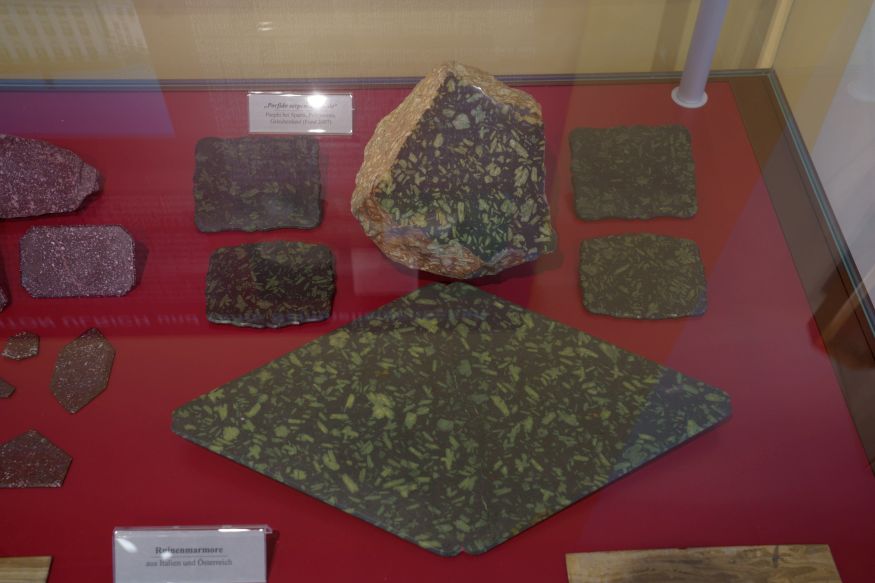
Das Museum mit einer sehr eindrucksvollen, wohlsortierten und
recht alten Mineralien- und Gesteinssammlung beinhaltet auch das
Rohmaterial von Tabakdosen. Darunter sind auch zahlreiche Scheiben
und Rohstücke aus dem grünen Porphyr ausgestellt. Die hier
abgebildete, polierte Scheibe in Rautenform hat die geschätzte
Maße von etwa 25 x 16 cm,
aufgenommen am 05.07.2019
Etzel, Friedeburg, Krs. Wittmund, Niedersachsen:
Bei einer Kirchengrabung in dem kleinen Ort Etzel (zwischen
Friedeburg und Wilhelmshaven, südwestlich von Wilhelmshaven
gelegen) im Herbst 1974 wurden im Brandschutt aus dem 12.
Jahrhundert vor der Chorstufe grüne Porphyr-Platten-Stücke
gefunden, die man nach einer Untersuchung, einem mitelalterlichen
Tragaltar zusprach (Haiduck, H. in SCHWARZ & SCHWARZ
1975:135f).
Oldenburg, Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte, Niedersachsen:
In der Sammlung des Mittelalters befindet sich ein kleiner
Tragaltar aus Walrosszahn mit Resten einer Vergoldung aus dem 11.
Jahrhundert. In der Oberseite ist eine ovale (eigentlich ein
Zweirund) Platte aus dem grünen Porphyr eingelassen. Der
vermutlich aus einer westfälischen Werkstatt stammende Tragaltar
(Reliquienschrein) wurde 1908 beim Abbruch der Kirche in
Friesoythe gefunden und gehört zur Pfarrgemeinde St. Marien
Friesoythe.
Unbekannter Fundort, vermutlich in Österreich:

In der Gesteins-Sammlung von Philipp STASTNY befindet sich ein
Ackerlesestein eines kleinen Poprhyr-Plättchens von etwa 4 x 2,5 x
0,5 cm aus der Umgebung von Wien. Es zeigt deutliche Sägeriefen
und ist nicht geschliffen oder poliert. Wie man an Farbe, Textur
und den zonierten, ehemaligen Feldspäten sehen kann, stammt das
Material für das Plättchen eindeutig aus Krokees. Ob es eine
römische Spolie ist oder der Rest einer mittelalterlichen
Zweitverwendung ist, kann nicht mehr festgestellt werden. Möglich
wäre auch, dass es sich um ein Bruchstück einer Platte aus einem
Tragaltar handelt.
Gurk, Schatzkammer Gurk, Kärnten, Österreich:
Einst in der Sammlung des Diözesanmuseums in Klagenfurt, befindet
sich der so genannte "Gurker Tragaltar" seit 2014 in der
"Schatzkammer Gurk" im Propsteihof des Gurker Doms im Stift Gurk
(etwa 50 km westlich von Graz gelegen). Der Tragaltar wurde 1895
im Sepulcrum des spätmittelalterlichen Altartisch in der
Hauskapelle des Gurker Domkapititels in Klagenfurt gefunden wurde.
Es wird angeführt, dass der nur 5 cm hohe, sehr einfach
rechteckige Tragaltar um 1220 bis 1230 in Salzburg hergestellt
wurde (FILLITZ 1998:28 (kleines Textbild), 192 (Katalogbild), 577
(Text)). Darin wird die relativ große Platte von etwa 22 x
15 cm aus dem grünen griechischen Porphyr mit einer Grenze aus
unterschiedlichen Varianten fälschlich als "Serpentin"
beschrieben, eine Fehlbestimmung von Gesteinen im
historisch-archäologischen Umfeld, welches selbst in der neueren
Literatur nicht selten vorkommt.
(den Hinweis gab Philipp STASTNY)
Bulgarien, Sofia:

In der Sammlung des Archäologischen Nationalmuseums in der
Hauptstadt Sofia befinden sich 4 kleine Plattenstücke aus grünem
Porphyr; sie gehörten zu einer Wandverkleidung oder waren im Boden
verlegt. Nach der englischen Beschriftung wurden diese in einer
Palast-Aula gefunden und der Ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts n.
Chr. zugeordnet. Die Beschreibung im Museum ist aber mit "grünem
Marmor" falsch, denn es handelt sich eindeutig um den grünen
Porphyr aus Griechenland;
aufgenommen von Helga LORENZ am 23.05.2021.
Iraklion, Kreta, Griechenland:
Im Archäologischen Museum in Iraklion wird ein großer Rhyton in
einem Stahlgestell gezeigt, der aus dem Palast von Zakros stammt
(ZEZZA & LAZZARINI 2002:259 Abb. 2). Das etwa 50 cm hohe Gefäß
wurde aus einem Stück gefertigt und stammt aus der Zeit von 1.500
bis 1.450 v. Chr.
Privatsammlungen, Deutschland:
- Im bekannten und weitläufigen barocken Schloss Weißenstein bei
Pommersfelden bei Erlangen in Oberfranken stehen in einem Zimmer
2 größere Gefäße aus grünem Porphyr (vermutlich 17. oder 18.
Jahrhundert), die nicht fotografiert werden dürfen. Es wurde
auch kein Foto zur Verfügung gestellt.
- In einer Privatsammlung in Nordrhein-Westfalen befindet sich
ein Gefäß aus grünem Porphyr mit Deckel. Das drehrunde Gefäß ist
innen ausgebohrt, aber nicht hinterschnitten und hat einen
Durchmesser von etwa 30 cm. Das topfähnliche, von Hand polierte
Gefäß stammt aus dem Italien des 18. oder 19. Jahrhunderts.
- .
Auktionshaus Gorny & Mosch Gießener Münzhandlung
GmbH
 (Foto GM, mit Genehmigung)
(Foto GM, mit Genehmigung)
bietet auf der Auktion 316 - Saal-Auktion
- 16.12.2025 mit dem Los 141 einen Frosch aus Porfido
verde antico an. Das äußerst ungewöhnliche und wohl einzigartige
Stück stammt aus der römischen Kaiserzeit des 1. - 3. Jahrhundert n.
Chr. Die Maße betragen: Länge 22cm, Breite 16,5cm, Höhe 11cm. Die
Augen sind in weißem und schwarzem Stein eingelegt. Das Stück ist
sehr gut poliert und zeigt schön die ehemaligen Feldspatkristalle in
einer Matrix, also ganz typisch der grüne Porphyr aus Griechenland.
Möglicherweise stand das Kunstwerk einst im Garten der Villa
Hardiana bei Rom.
Weitere Gesteine mit einem porphyrischen
Gefüge finden Sie hier:
Literatur:
AEISSEN, M. (2015): Die Via Belgica im Herzen von Baesweiler.- in
Archäologie im Rheinland 2015, S. 125 - 127, 3 Abb., [Theiss
Verlag].
BEUDANT, F. S. (1826): Lehrbuch der Mineralogie.- deutsch von Karl
Friedrich Alexander Hartmann, 852 S.,10 ausklappbare
lithographische Tafeln im Anhang, [F. A. Brockhaus] Leipzig.
BORGHINI, G. [eds.] (1989): Marmi antichi.- Materialia
della cultura artistica 1, 342 S., sehr viele farb. Abb.,
Ministerio per i beni culturali ambientali. Instituto centrale per
il catalogo e la documentazione [De Luca Edizionie d´Arte S.p.A.]
Roma.
DANNHEIMER, H. (2006): Porfido rosso, Porfido verde
und Verde antico. Exotische Steine aus dem
frühmittelalterlichen Bayern.- Bayerische Vorgeschichtsblätter
Jahrgang 71, 283 - 291, 1 Abb., Tafeln II -
III, [Verlag C. H. Beck] München.
DEER, J. (1959): The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period
in Sicily.- Dumbarton Oaks Studies „V“, 188 S., dazu 33
unpaginierte Seiten Tafeln mit 220 SW-Abb., [Harvard University
Press] Cambrindge, Mass.
DELBRUECK, R. (1932): Antike Porphyrwerke.- Studien zur
spätantiken Kunstegschichte Band 6, mit 122 Textabb., 245
S., 112 unpag. Tafeln, im Auftrag des Deutschen Archäologischen
Instituts, [Verlag Walter de Gruyter] Berlin – unveränderter
Nachdruck von L´ERMA di Bretschneider 2007.
DELESSE, A. (1852): Untersuchungen über den rothen Porphyr der
Alten und über den rothen egyptischen Syenit.- In´s Deutsche
übertragen von G. Leonhard, 32 S., 1 colorierte Tafel im
Stahlstich, [J. B. Müller Verlagshandlung] Stuttgart.
DEL BUFALO, D. (2013): Porphyry. Red Imperial Porpyhry Power and
Religion. Rosso Imperiale Potere e Religione.- 300 p., sehr viele
farb. Abb., [Umberto Allemandi & C.] Turin.
EBERT-SCHIFFERER, S. (1996): Hessisches Landesmuseum
Darmstadt.- 128 S., zahlreiche farb. Abb., [Fondation Paribas]
ohne Ort.
FEES, I. [Hrsg.] 2005: Die Höfe - dein Denkmal. Zur karolingischen
Burg und salischen Königspfalz bei Dreihausen.- 118 S., zahlreiche
SW-Abb., Zeichungen, Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen,
[Druckhaus Marburg] Marburg.
FIEDLER, K. G. (1840): Reise durch alle Theile des Königreiches
Griechenland im Auftrag der Königl. Griechischen Regierung in den
Jahren 1834 - 1837.- Erster Theil, 858 S., 6 Abb., [Friedrich
Fleischer] Leipzig.
FILLITZ, H. [Hrsg.] (1998): Geschichte der Bildenden Kunst in
Österreich Band 1 Früh- und Hochmittelalter.- 580 S., zahlreiche
Abb., [Prestel/VM] München.
FRATTARI, A. & STENICO, F. (2001): Porphyr.
Architektur und Technik.- zahlreiche farb. Abb., technische
Zeichnungen und Skizzen, [gruppo editoriale faenza editrice
s.p.a.] Faenza RA (Italien).
GRANT, L. & MORTIMER, R. [eds.] (2002): Westminster Abbey. The
Cosmati Pavements.- Courtauld Research Paper No. 3, 141
p., 42 figs., 1 Plan/Foto ausklappbar, [Ashgate Publishing Ldt.]
Alderhot.
HERRMANN, O. (1914): Gesteine für Architektur und Skulptur.- 2.
Aufl., 119 S., [Verlag von Gebrüder Borntraeger] Berlin.
HUCKENRIEDE, R. & DÜRR, S. (1975): Geologische und
Kulturgeschichtliches zu einigen verschleppten Gesteinen in
Hessens Boden (Devon-Kalke, Muschelkalk, Lakonischer Porfido verde
antico).- Geologica et Palaeontologica 9, S. 125 - 139, 1
Tafel, Fachbereich Geowissenschaften der Philipps-Universität [N.
G. Elwert Verlag] Marburg.
JACOBSHAGEN, V. [Hrsg.] (1986): Geologie von Griechenland.-
Beiträge zur Regionalen Geologie der Erde Band 19, 363 S.,
112 Abb (davon 2 mehrfach gefaltet in Umschlagtasche), [Verlag
Gebrüder Borntraeger] Berlin – Stuttgart.
JENSCH, J.-F. (2013): Bestimmungspraxis Rhombenporphyre.- Der
Geschiebesammler 46, Heft 2-3, S. 47 - 103, 35 Abb., 3
Tab., 18 Tafeln, 1 Karte, [Dr. Frank Rudolf Verlag] Wankendorf.
KLEMM, R. & KLEMM, D. D. (1993): Steine und Steinbrüche im
alten Ägypten. 465 S., 484 Abb., 16 Farbtafeln mit 96
Einzeldarstellungen, [Springer-Verlag] Berlin.
KÖNIG, R. [Hrsg.] (1973): C. Plinius Secundus d. Ä. Naturkunde
Buch XXXVI Die Steine.- S. 44 - 47, [Artemis & Winkler] (lag
als Kopie vor)
KOUTSOVITIS, P., KANELLOPOULOS, C., PASSA, S., FONI, K., TSAPARA,
E., OIKONOMOU, G., XIROKOSTAS, N., VALLIANTOU, Κ. & MOUXION,
Ε. (2016): Mineralogical, Petrological and Geochemical Features of
the unique Lapis Lacedaemonius (Krokeatis Lithos) from Laconia,
Greece: Approach on Petrogenetic Pprocesses within the Triassic
Volcanic Context.- Bulletin of the Geological Society of Greece,
vol. L, Proceedings of the 14th Intern. Congress,
Thessaloniki, 10 pag., 5 fig., 2 tab.
LAMBACHER, L. [Hrsg.] (2010): Schätze des Glaubens.
Meisterwerke aus dem Dom-Museum Hildesheim und dem
Kunstgewerbemuseum Berlin.- Ausstellungskatalog, 160 S.,
zahlreiche farb. Abb., [Verlag Schnell & Steiner GmbH]
Regensburg.
LAZZARINI, L. (2006): Poikiloi lithoi, versiculores maculae: i
marmi colorati della Grecia antica. Storia, uso, diffusione, cave,
geologia, caratterizzazione scientifica, archeometria.- 296 S.,
viele Abb. [Fabrizio Serra Editore] Pisa.
LEGNER, A. [Hrsg.] (1975): Monumente Annonis. Köln und Siegburg.
Welt und Kunst im hohen Mittelalter. Eine Ausstellung des
Schnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche vom 30.
April bis 27. Juli 1975.- 248 S., 12 Seiten Farbabbildungen im
Anhang, zahlreiche SW-Abb., [Greven & Bechtold] Köln.
LORENZ, J. A., OKRUSCH, M., REICHERT, C. & ROSMANITZ, H.
(2011): "Porfido verde antico" im Odenwald. Der Tragaltar vom
Gotthardsberg.- Beiträge zur Archäologie in Unterfranken 7/2011,
S. 175 - 194, 11 Abb., 4 Tafeln (davon 1 in Farbe auf S. 171),
Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege [Verlag Dr.
Faustus] Büchenbach.
MALGOUYRES, P. & BLANC-RIEHL, C. (2003): Porpyhre. La pierre
pourpre des Ptolémées aux Bonaparte.- 208 S., zahlreiche, meist
farb. Abb., Réunion des Musées Nationaux, Paris.
MEHLING, G. [Hrsg.] (1993): Naturstein-Lexikon für Handwerk
und Industrie.- 4. Aufl., 668 S., 16 Farbtafeln, zahlreiche Abb.
im Text, [Verlag Georg D. W. Callwey] München.
MIELSCH, H. (1985): Butmarmore aus Rom im Antikenmuseum
Berlin.- 71 S., 7 Abb., 24 farb. Tafeln im Anhang, Staatliche
Museen Preußischer Kulturbesitz, [Passavia Druckerei GmbH] Passau.
MURAWSKI, H. (1992): Geologisches Wörterbuch.- 9. Aufl., 254 S.,
82 Abb., 7 Tab., [Ferdinand Enke Verlag] Stuttgart.
OKRUSCH, M. & MATTHES, S. (2009): Mineralogie. Eine Einführung
in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde.-
8. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 658 S., 438
Abb., davon 133 in Farbe), zahlreiche Tab., [Springer Verlag]
Berlin.
PARASKEVOPOULOS, G. M. (1965): Über die Entstehungsbedingungen des
Andesits "pofido verde antico" im südöstlichen Zentral-Peloonnes.-
Neues Jahrbuch Mineralogische Abhandlungen Jahrgang 103,
Heft 3, S. 293 - 304, 4 Abb., 3 Tab., Tafel 22 - 23,
Stuttgart.
PAJARES-AYUELA, PALOMA (2002): Cosmateque Ornament. Flat
Polychrome Geometric Patterns in Architecture.- 320 p., 569
illustrationes, 377 in colour, [Thames & Hudson Ltd.]
London.
PE-PIPER, G. & PIPER, D. J. W. (2002): The ingneous rocks
of Greece. The anatomy of an orogen.- Beiträge zur regionalen
Geologie der Erde Band 30, 288 figs., 11 tab., [Gebrüder
Borntraeger] Berlin- Stuttgart.
PHILIPPSON, A. (1892): Der Peloponnes. Versuch einer Landeskunde
auf geologischer Grundlage. Nach Ergebnissen eigener Reisen.- 642
S., mit einer geologischen und einer topographisch-hypsometrischen
Karte mit Isohypsen, einer Profiltafel und 41 Profilskizzen im
Text, [Verlag von R. Friedländer & Sohn] Berlin.
RICCI, F. M. & CASALIS, L. (2003): Vaticano la Sala Degli
Animali nel Museo Pio-Clementino.- 127 S., sehr viele farb. Abb.,
Musei Vaticani [FMR] Milano (Italien).
RUPPIENÉ, V. (2015): Natursteinverkleidungen in den Bauten der
Colonia Ulpia Traiana Gesteinskundliche Analysen,
Herkunftsbestimmungen und Rekonstruktionen.- Xantener Berichte
Grabung – Forschung – Präsentation Band 28, 368 S., 199
Abb., 106 Tab., Katalog, Landschaftsverband Rheinland,
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum, [Verlag Philipp
von Zabern] Darmstadt.
SCHOFIELD, L. (2009): Mykene. Geschichte und Mythos.- 211 S., 65
Farb- und 58 Schwarzweißabb., [Verlag Philipp von Zabern] Mainz.
SCHMIDT, R. (2020): Edle Steine für Tabatieren. Die
Schmucksteinsammlung des Herzogs Anton Ulrich von Sachsen-Meinigen
(1687-1763).- Sonderveröffentlichung Naturhistorisches Museum
Schleusingen, 280 S., sehr viele, farb. Abb.
SCHWARZ, W. & SCHWARZ, H. (1975): Ostfriesische Fundchronik
1974.- Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und
vaterländische Altertümer zu Emden. 55. Band, S. 115 -
140, 3 Tafeln, [Verlag Ostfriesische Landschaft] Aurich.
SEPP, J. C. & Filius (1776): Marmora et Adfines Aliquos
Lapides Coloribus Suis.- 200 S., 570 handcolorierte Abb. auf
Tafeln, 2023 Nachdruck des Taschen-Verlags in einem Schuber.
TESCH, S. (2007): Tidigmedeltida sepulkralstenar i Sigtuna -
heliga stenar från Köln såväl hallkult som mässa i stenkyrka.-
Situne Dei 2007, S. 45 - 68, 13 figs.,
TESCH, S. (2008): Laddade stenar.- in På väg mot Paradiset (ed.
Anders Wikström 2008), kv. Humlegården 3, Sigtuna 2006.
Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museum Nr. 33, p.144 - 50,
5 figs.
TREGENZA, L. A. (1958): Einsame Berge zwischen Nil und Roten
Meer.- 250 S., 27 Abb. auf Kunstdrucktafeln, 1 Karte im Text [F.
A, Brockhaus] Wiesbaden.
TOMIO, P. & FILIPPI, F. (1996): Das Porphyr-Handbuch.- 252 S.,
sehr viele meist farb. Abb., Tab. und Zeichnungen, [e.s.Po.
s.c.ar.l.] Albiano (Trento).
WARNEKE, T. F. (2020): Porphyr im karolingischen Herrenhaus.-
Archäologie in Deutschland Heft 03 Juni-Juli 2020, S. 55 - 56, 2
Abb., [wbg] Darmstadt .
WARREN, P. (1969): Minoan Stone Vases.- Cambridge Classical
Studies, 280 p., 633 b&w photos on 120 plates, 328 drawings,
[Cambrindge University Press] Cambridge UK.
ZEZZA, U. & LAZZARINI, L. (2002): Krokeatis Lithos (Lapis
Lacedaemonius): Source, history of use, Scientific
Characterization.- p. 259 264, 11 fig., 3 tab..
Zurück zur Homepage
oder zurück an den Anfang der Seite

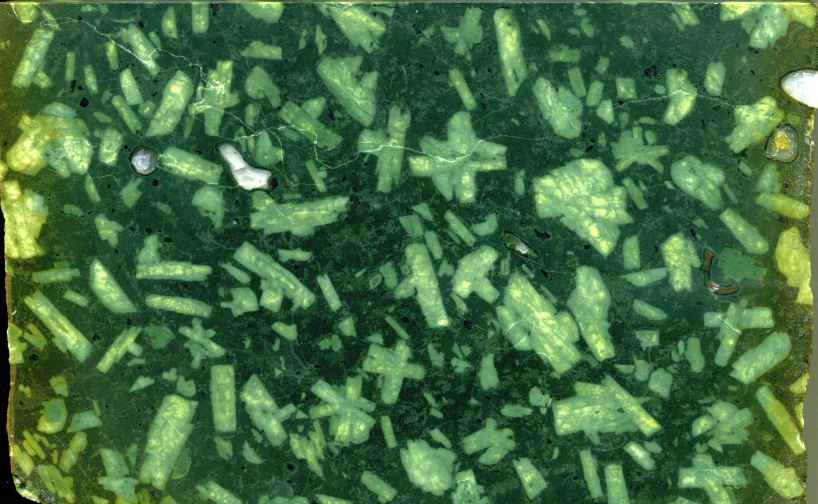
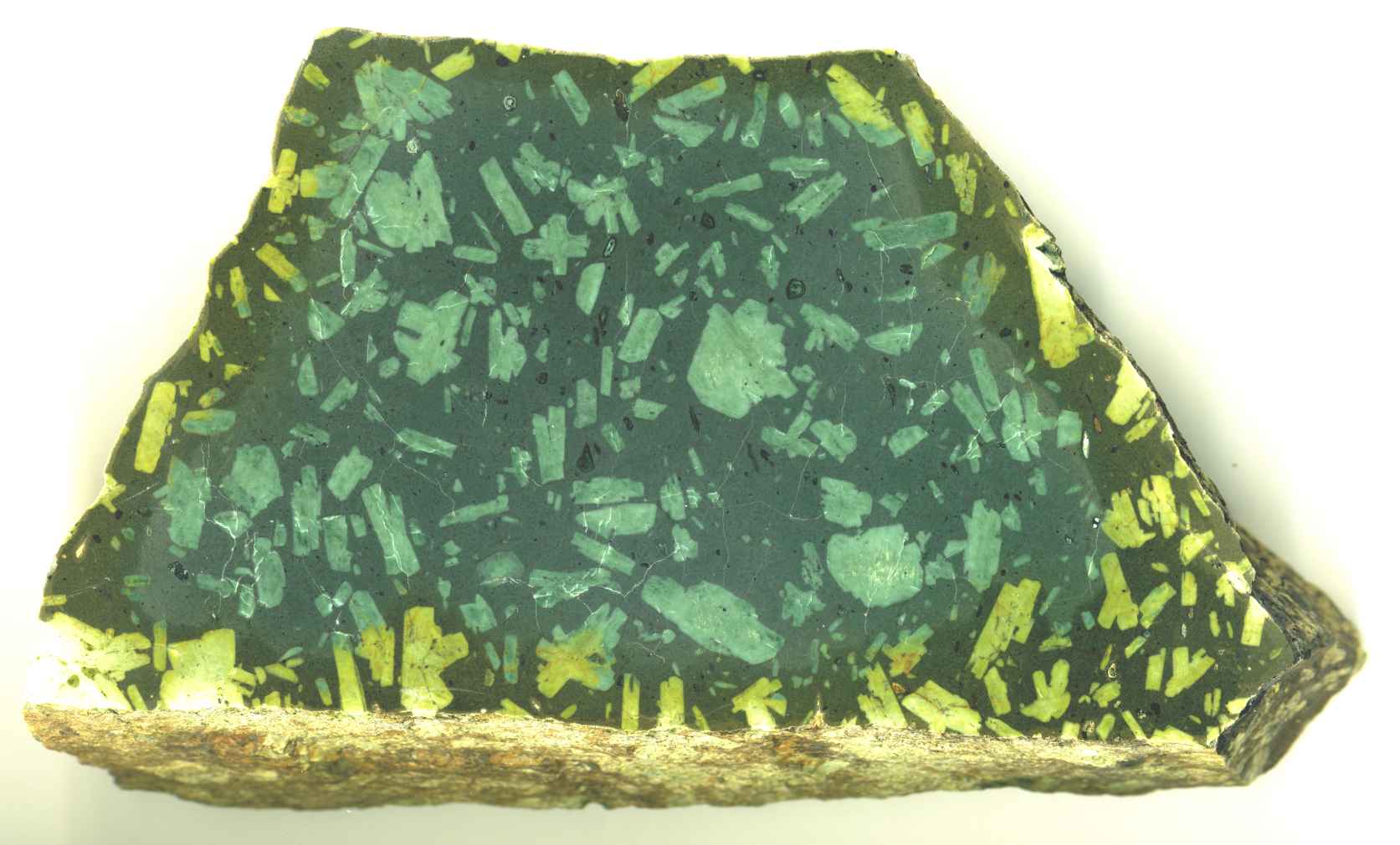

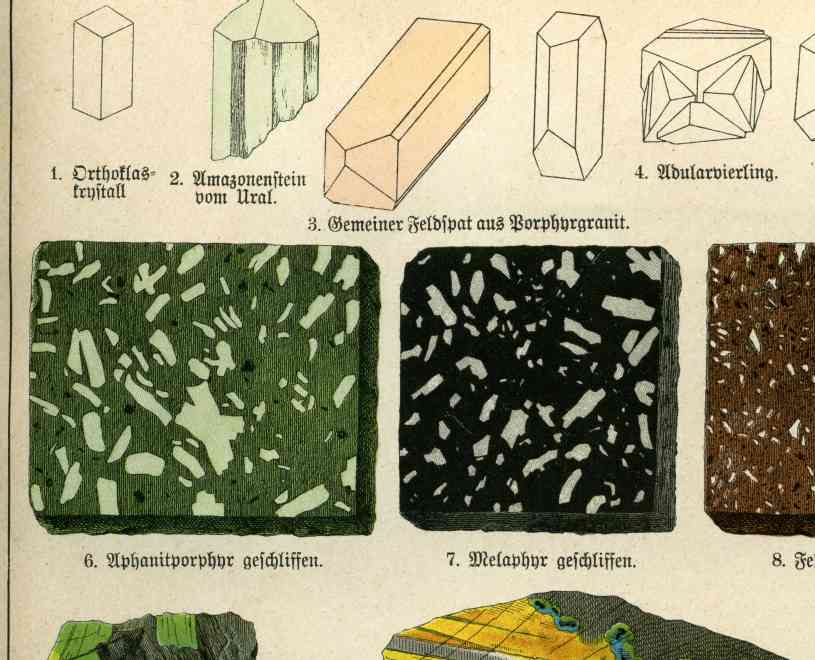




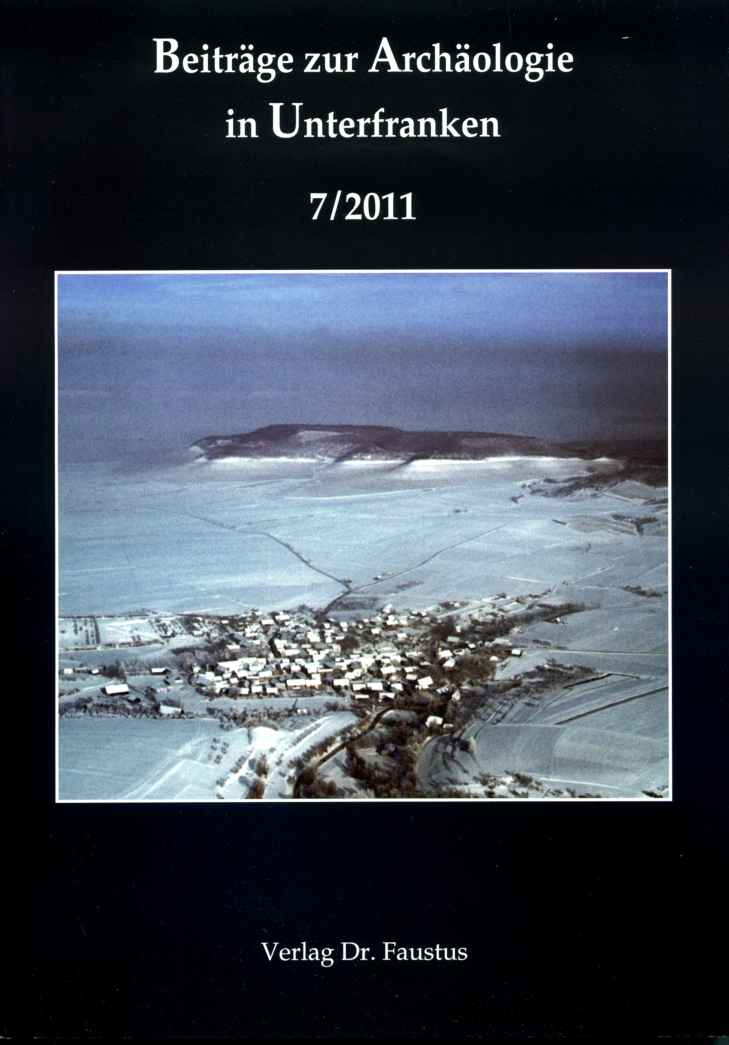


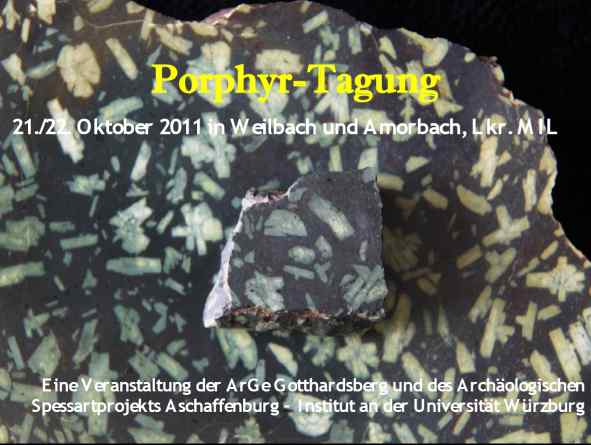






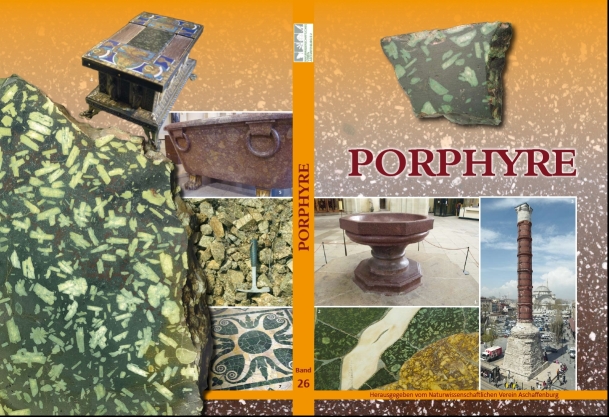
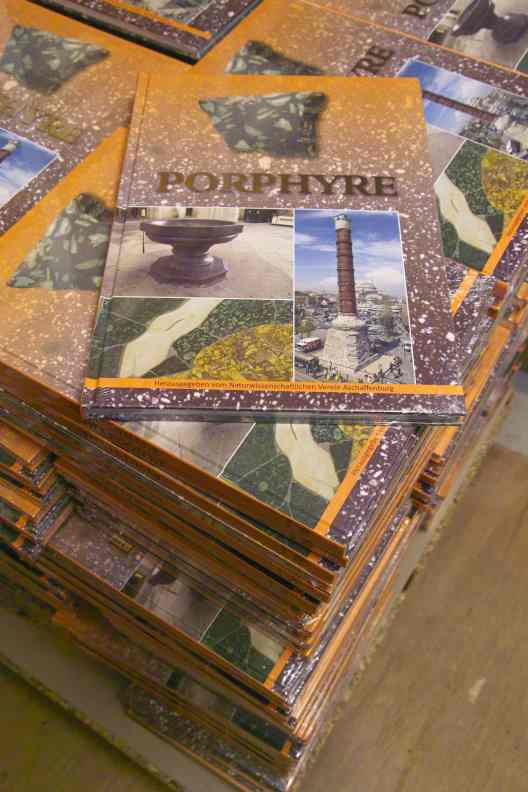
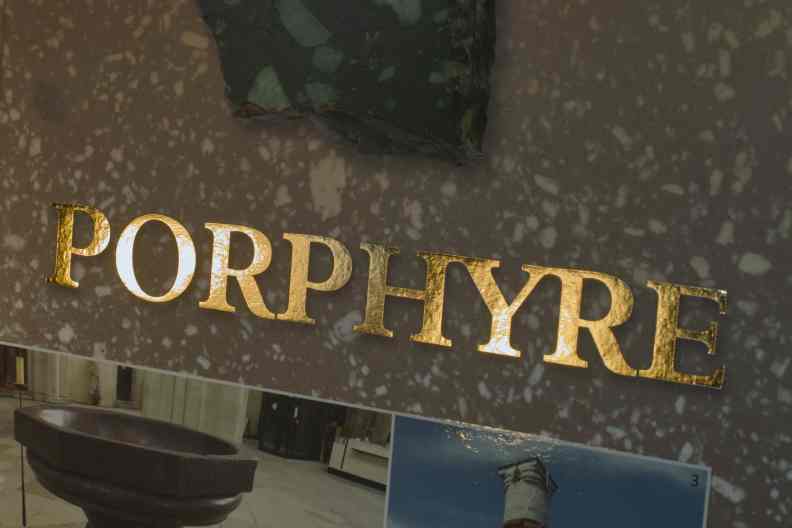




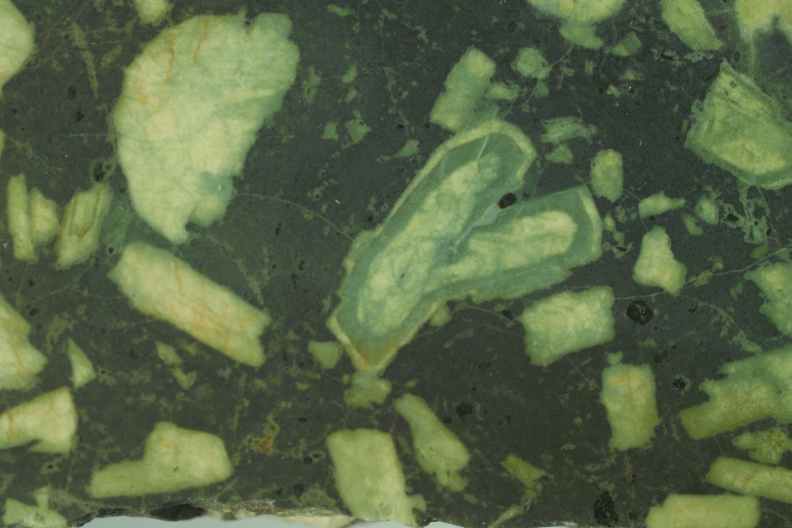











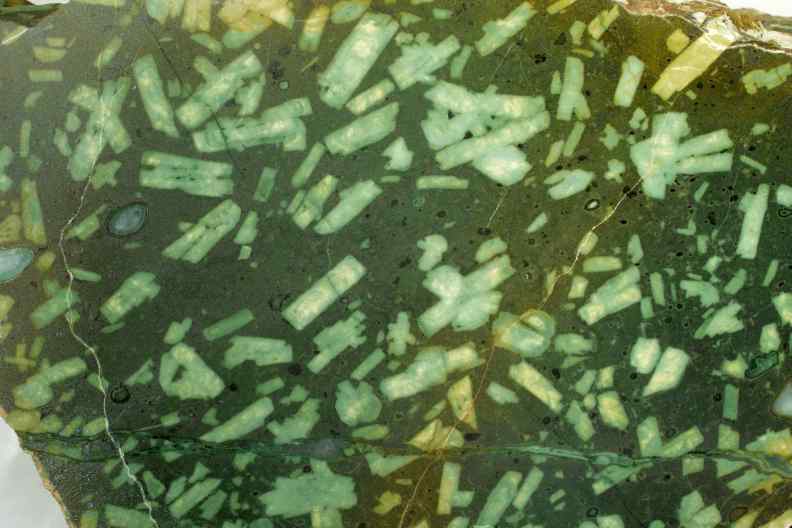



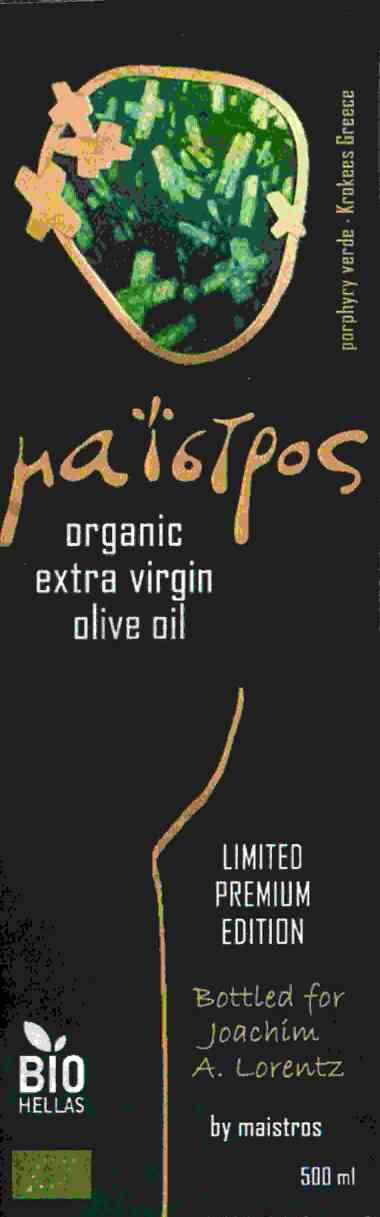
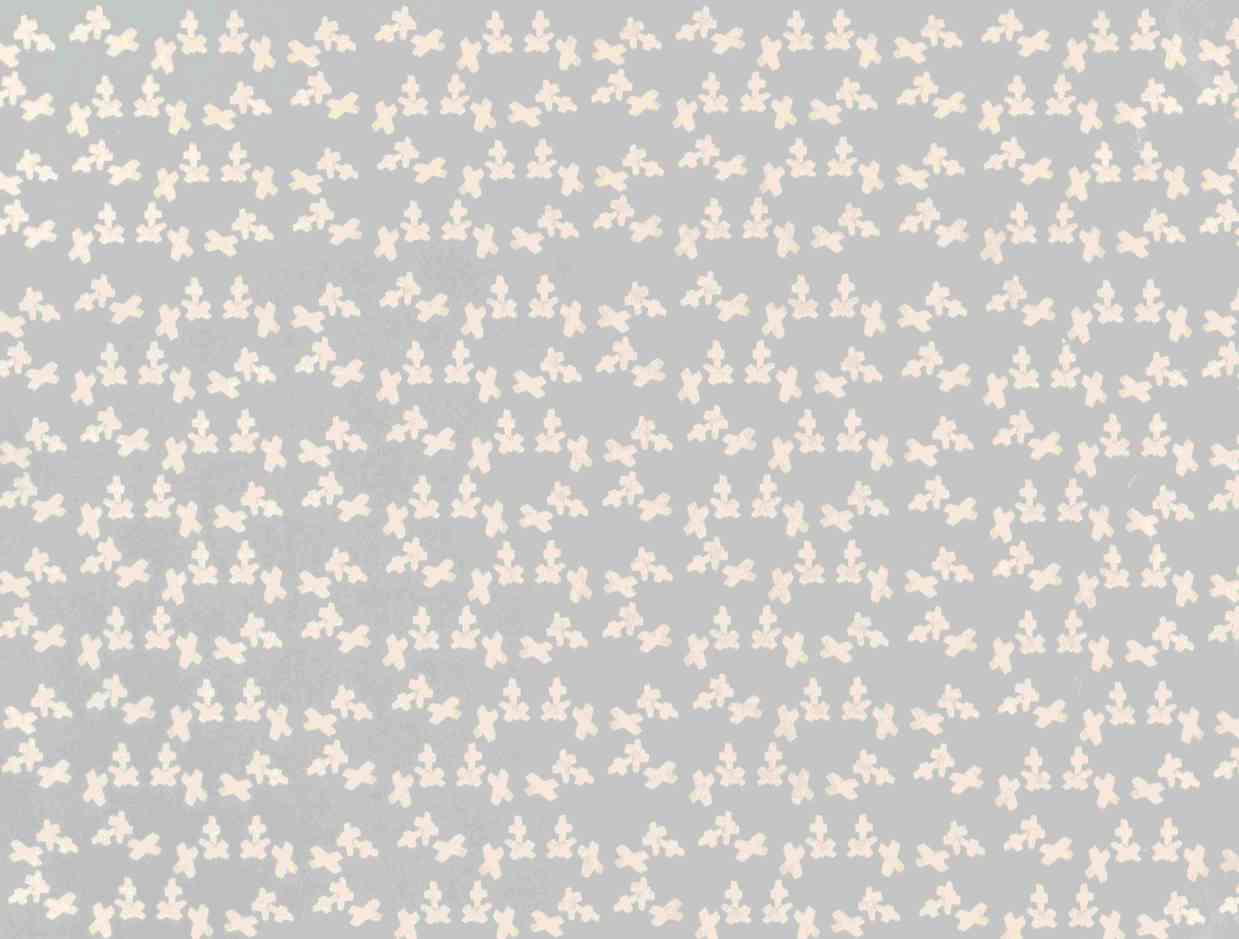






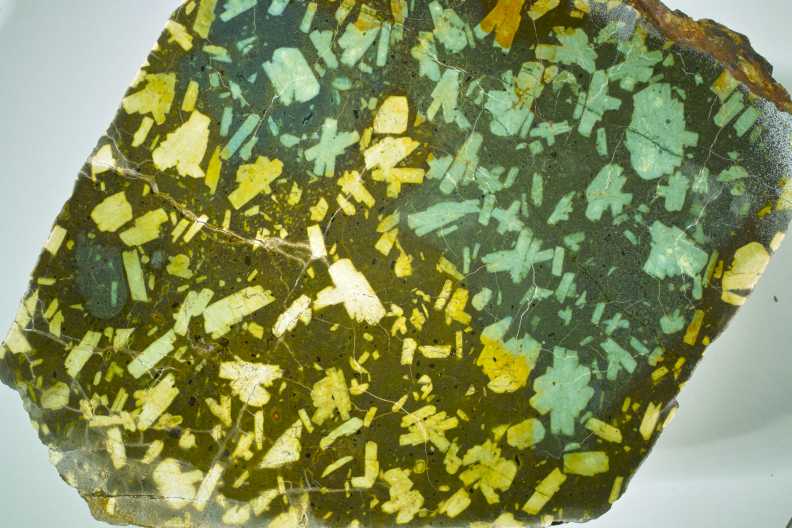

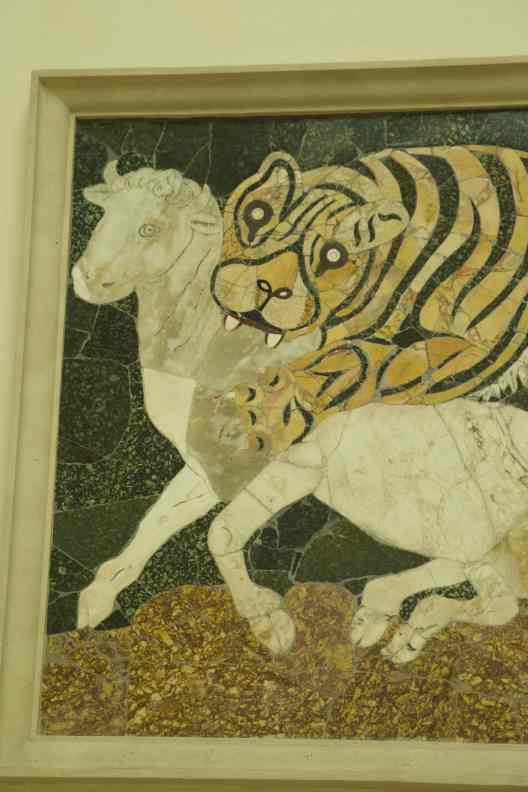










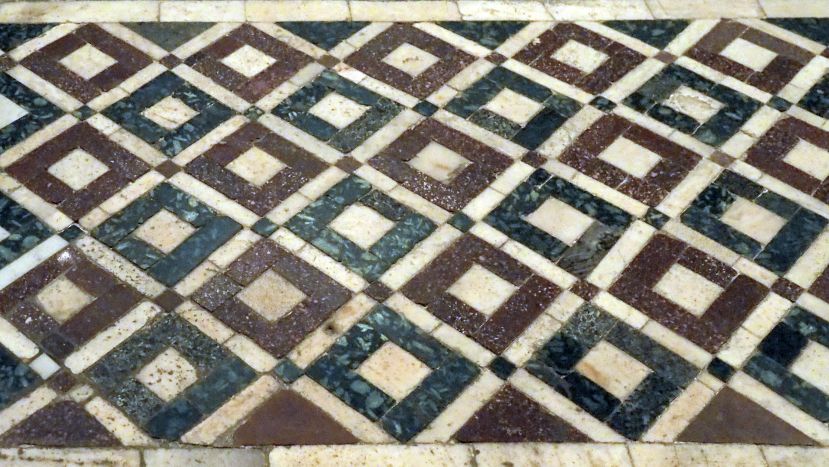


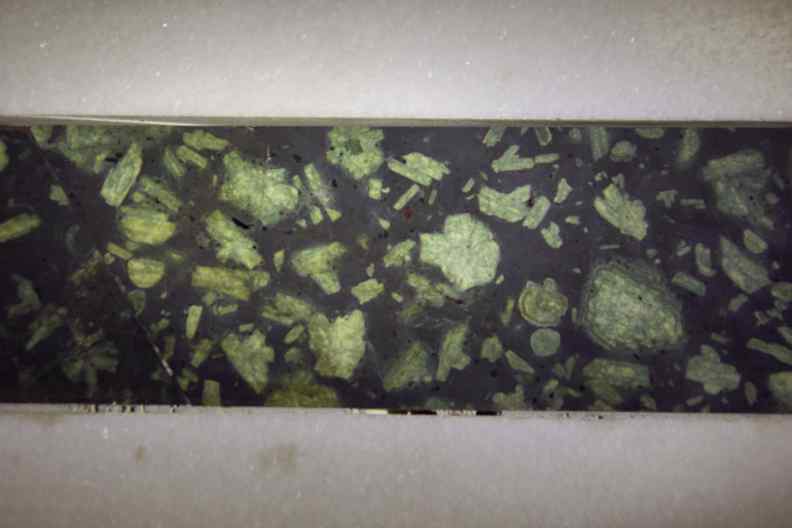
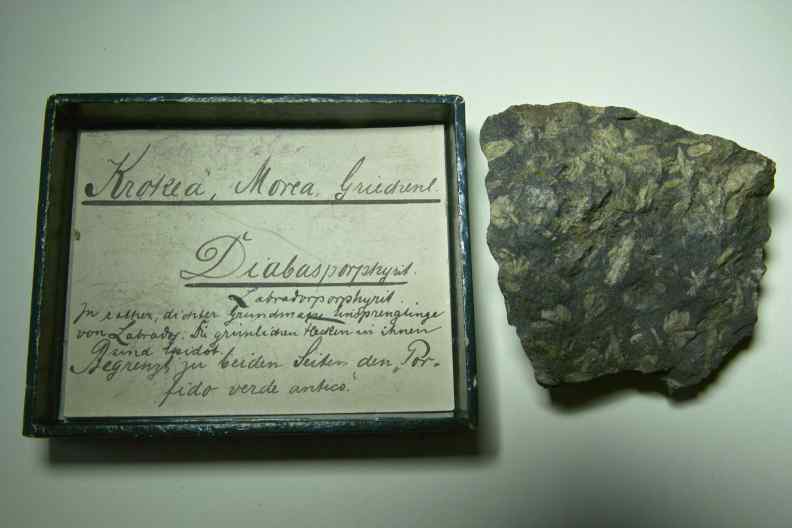
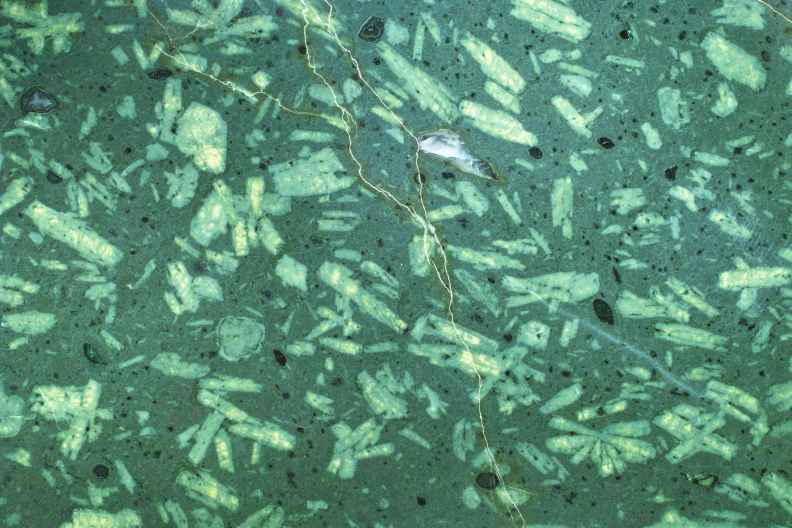
 Tragaltar aus der 2. Hälfte des 12.
Jahrhunderts (Dommuseum Hildesheim Nr. DS 25)
Walross-Elefenbein, Emaille, vergoldetes Kupferblech auf einem
hölzernen Kern mit einer Platte aus dem grünen Poprhyr aus
Griechenland als Altarstein; in der Erläuterung des
(Metropolitan) Museums (in New York) fälschlich als "Serpentin"
bezeichnet.
Tragaltar aus der 2. Hälfte des 12.
Jahrhunderts (Dommuseum Hildesheim Nr. DS 25)
Walross-Elefenbein, Emaille, vergoldetes Kupferblech auf einem
hölzernen Kern mit einer Platte aus dem grünen Poprhyr aus
Griechenland als Altarstein; in der Erläuterung des
(Metropolitan) Museums (in New York) fälschlich als "Serpentin"
bezeichnet. 
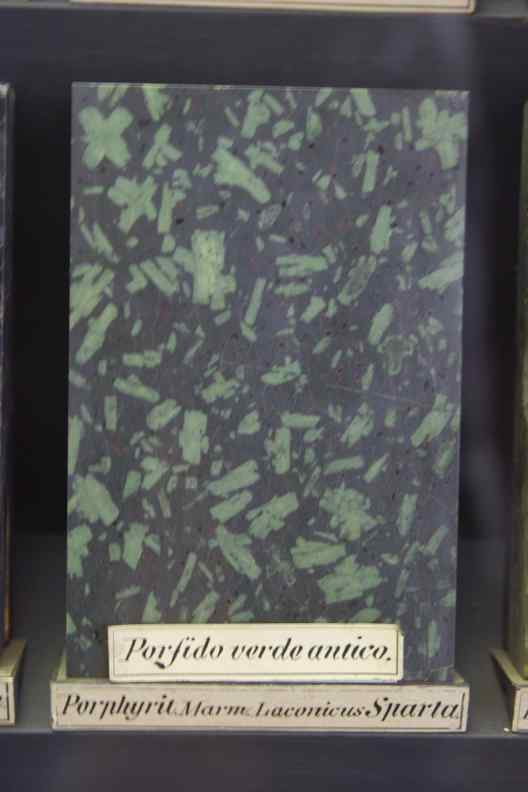 Das Naturhistorische Museum mit seinen sehr
großen Sammlungen am Burgring besitzt in seinen
Gesteinssammlungen zahlreiche geschliffene und polierte, etwa
handgroße Platten des grünen Porphyrs von Krokees. Die alte
Beschriftung des Stückes lautet: "Porfido verde antico.
Porphyrit. Marm. Lacionicus Sparta". Diese Belegstücke stammen
wie die anderen in der Virtine im Saal 1 zum größten Teil aus
römischen Bauten in Rom.
Das Naturhistorische Museum mit seinen sehr
großen Sammlungen am Burgring besitzt in seinen
Gesteinssammlungen zahlreiche geschliffene und polierte, etwa
handgroße Platten des grünen Porphyrs von Krokees. Die alte
Beschriftung des Stückes lautet: "Porfido verde antico.
Porphyrit. Marm. Lacionicus Sparta". Diese Belegstücke stammen
wie die anderen in der Virtine im Saal 1 zum größten Teil aus
römischen Bauten in Rom. 






 (Foto GM, mit Genehmigung)
(Foto GM, mit Genehmigung)