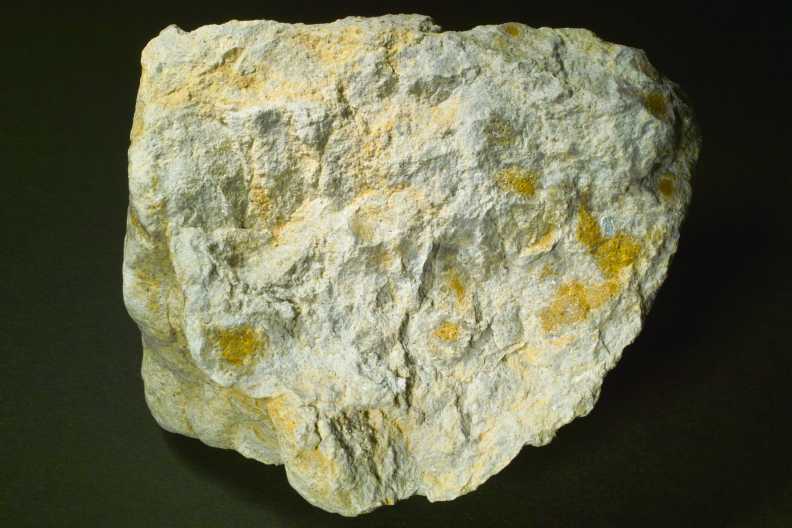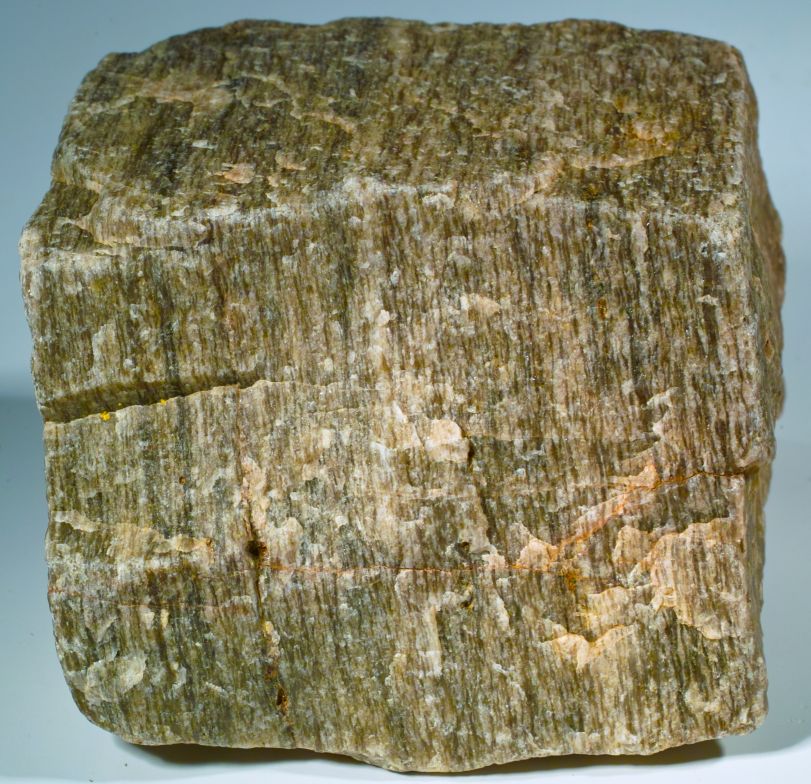Die Kies- und
Sandgruben im Maintal - auch Fundstellen für Mineralien und
Gesteine?
Ja!
Und auch echtes Gold - aber nur in winzigsten
Mengen.


Links: In Babenhausen entstand eine neue
Kiesgrube mit einer Aufbereitung.
Dafür suchte Fa. Schumann & Hardt Mitarbeiter,
aufgenommen am 20.05.2021.
Rechts: "Seligenstädter Main-Kiesel" - Kieselsteine als
Drageemischung zum Essen;
Bildbreite 8 cm.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Die Kiesgrube der Fa.
Volz und Herbert zwsichen Dettingen und Hörstein: links am
07.04.2002 und 24.12.2015

Die Kiesgrube der Fa.
Weber (Miltenberger Industriewerk)
Sand- und Kieswerke Fritz Weber GmbH & Co. Werk Großostheim.
aufgenommen am 30.04.2011
Wichtiger Hinweis:
Vorsicht an Wänden und Schüttkegeln, denn sie können plötzlich
rutschen. Auch an den Absetzteichen für das Wasser besteht die
Gefahr, dass man im Schlamm einsinkt!
Leider wurde in diesen Kiesgruben die Aufbereitung so gebaut, so
dass man nach der Aufgabe das Material durch den Brecher laufen
lässt, so dass keine ungebrochenen Überkornhalden mehr entstehen.
Für den Sammler von Mainschottern bedeutet dies, dass man nur im
Bereich der Wände ungebrochene Kieselsteine sehen kann.
Zusammenfassung
In den meist flächenreichen Kiesgruben können bei entsprechenden
Verhältnissen die vielflätigen Gesteine, Fossilien und Mineralien
in unterschiedlich großen Stücken gefunden werden, die oberhalb
der Lage vom Main und seinen Nebenflüssen aufgenommen und hier
mehr oder weniger gerundet und zerkleinert abgelagert wurden.
Lage
Kies- und Sandgruben gibt es von Wertheim dem Main folgend bis
nach Mainz, besonders in der Nähe der Ortschaften Miltenberg,
Obernau, Großostheim, Niedernberg, Stockstadt, Kleinostheim,
Mainhausen, Babenhausen, Alzenau, Langen, Frankfurt, ......
Hier sollen bespielhaft zwei der vielen Kiesgruben aufgeführt
werden:
- Die Kiesgrube der Fa. Volz & Herbert in Hörstein (Alzenau
Gewerbegebiet Süd). Die Zufahrt ist am leichtesten von der
Ausfahrt der Bundesautobahn A45, Anschlussstelle Karlstein,
vorbei an der markanten DEA-Tankstelle und dann der
Beschilderung folgen (bitte Verbotstafeln beachten!) und weiter
vorbei an Lidl und Aldi bis zur Schranke der Kiesgrube (siehe
Okrusch et al. 2011, S. 281, Aufschluss Nr. 261).
- Die Kiesgrube der Fa. Weber (Miltenberger Industriewerke)
liegt nahe am Flugplatz bei Großstheim bzw. dessen Ortsteil
Ringheim. Die Zufahrt liegt beschildert an der Straße vom
Kreisel am Flughafen nach Ringheim.
Geologie
Unter einer geringmächtigen Bodenbedeckung von ca. 0,5 - 4 m
beginnt ein lehmiger, sehr zäher Kies, der nach 1,5 m in den
gewünschten ton- und lehmfreien Kies übergeht. Der
Grundwasserspiegel liegt innerhalb der Mainniederungen bei ca. 3-4
m unter der Geländeoberfläche. Diese pleistozänen Ablagerungen des
Maines aus wechsellagernden Sanden und Kiesen, oft schräg
geschichtet, sind hier ca. 6-7 m mächtig:

aufgenommen am 19.08.2008
Unter ihnen folgen pliozäne Tone und Sande, leicht erkennbar an
der gelblichen bis grauen Färbung und an der darin vorkommenden
Braunkohle (Lignit). Stellenweise wurden auch so große Holzmengen
sedimentiert, so dass diese als Braunkohlen-Lagerstätten abgebaut
wurden. Ein Teil der Seen zwischen den Ortschaften Großwelzheim,
Kahl, Alzenau und Großkrotzenburg sind dabei entstanden. Die Kohle
wurde im Kraftwerk des RWE bei Großwelzheim verstromt. Infolge der
Kleinheit der Vorkommen und der strukturellen Verhältnisse
(Trinkwassergewinnung, Überbauung, forstliche Nutzung usw.) ist
ein Abbau der noch vorhandenen Vorräte realitätsfern.
Infolge der gestiegenen Niederschläge ist der Grundwasserspiegel
in den letzten Jahren um etwa 1 m angestiegen.
Historie der
Fa. Volz
Die Gewinnung von Sand und Kies hat in der Region lange Tradition.
Früher wurde das Material von Hand gewonnen und mit Pferdewagen
abgefahren. Später wurde mit Baggern und LKW, dann in großen
Anlagen mit Schwimmbaggern und Förderbändern gearbeitet, wobei das
Gestein auch gesiebt und gewaschen wird. Die meist mit Grundwasser
gefüllten Seen wurden lange Jahre als Müllkippen genutzt,
teilweise aber auch zur Schwimmbädern eingerichtet. Auch finden
sich Mehrfachnutzungen, z. B. für Freizeitangler, Windsurfer usw.
Die Kiesgrube der Fa. Volz und Herbert in Hörstein wurde ca. 1990
begonnen, nachdem sich der Betrieb in Kahl nicht mehr ausdehnen
konnte. Man kann aber insgesamt auf eine 100 jährige Tradition
zurückblicken. Die Firma produziert und liefert Sand, Kies, Böden
für den Gartenbau, Recycling-Materialien - z. B. für den Wegebau,
Schotter, Brechsande und Steine für die Gartengestaltung. Seit dem
Sommer 2008 auch einen Fertigbeton bereits ab 150 kg für
Selbstabholer, wenn man beispielsweise eine Gartenmauer oder einen
Weg damit befestigen will.

Die Betonmischanlage für Fertigbeton in kleinen Mengen am
26.07.2008
Mineralien und
Gesteine
Der Kies besteht im Bereich der Überkornhalden (siehe Bild unten)
aus folgenden Bestandteilen, wobei der Buntsandstein bei weitem
überwiegt (ca. 60-70%):


Überkornhalden der Kiesgrube, rechts am 15.12.2007 in der
winterliechen Nachmittagssonne
- vielfältiger
(Bunt)-Sandstein mit Tongallen, Schrägschichtungen,
konglomeratischen Stücken, Bleichungen, Arkosen, ....
- Kalke des Keupers
und des Muschelkalkes (z. T. mit Muscheln, Brachiopoden,
Ammoniten, Saurier-Knochen, Fischschuppen,
Kieselschwämmen, ...)
- Radiolarite - die
schwarzen, oft weiß geäderten Leitgerölle der Mainschotter
- verkieselter
Zechstein-Dolomit, selten auch als Konglomerat
- meist braune
Hornsteine, teils auch mit Fossilien (Steinkerne oder
Abdrücke von Seeigel, Brachiopoden, Kieselschwämme,
...)
- verschiedenfarbiger
Chalcedon (gebändert bis zum gebänderten Achat!) - aber
wegen der Rissigkeit ungeeignet zum Herstellen von
prähistorischen Steinwerkzeugen
- grauer, weißer,
trüber und rissiger Quarz, teils mit Glimmer, selten mit
Turmalin, Granat, Hämatit, u. a. ....

faustgroßer,
abgerollter aber völlig klarer Bergkristall! Infolge der
Reste der Streifung auf den Prismenflächen kann man die
Pyramidenflächen noch erahnen und die einstige Größe
rekonstruieren.
- Basalte, Phonolith,
Rhyolithe, ....
- Gneise,
Glimmerschiefer, Quarzite, Amphibolite, Diorit, .....
- fossile, verkieselte Hölzer, ohne
weitergehende Untersuchungen fast immer mit dem Namen Dadoxylon
zu benennen:


Verkieseltes
Holz als typische Gerölle aus den Mainschottern,
Bildbreite 15 cm.
- pleistozäne
Fossilien vom Mammut, Pferd, Wollnashorn, Ren, Elch, ....
(meist als Zähne, Geweihstücke oder größere
Knochen(-reste)).
- Konkretionen des
Kieses und der Sande mit Mn-Fe-Oxiden aus dem Grenzbereich
zwischen Grundwasser und Atmosphäre
- Fulgurite (sehr
dünnwandige Blitzeinschlagröhren aus Quarzglas
(Lechatelierit) im Sand - leider sehr schwer zu bergen!)
- Schwermineralsande
mit Magnetit, Hämatit, Rutil, Spinell, Staurolith, Granat,
Turmalin, ...
- Süßwasserkalke
- weißer Baryt
- gut gerundeter,
weißer Marmor (aus dem Spessart)
- Steine, die man ohne
weitere Untersuchungen keiner Art einfach zuordnen kann
- grauer bis
gelblicher, sehr feinkörniger Ton mit Quarzsand aus dem
Liegenden unter den abzubauenden Kiesschichten, zum Teil
mit Ligniten (schwarz und oft reich an Pyrit/Markasit, der
kaum haltbar ist und aus diesem Grund ist das Holz auch
kaum zu erhalten)
- Neu ist der sichere
Nachweis von Gold.
- Vivianit!

Blauer Viviant in einem Tonstein aus der Kiesgrube Volz und
Herbert, Bildbreite 2 cm, gefunden am 11.06.2011
- aber Achtung(!): Man
achte auf Ziegelbruch, gebrochenen Straßenbelag,
Natursteine von "Überallher", Beton, Terrazzo, "Marmor",
Baustellenabfälle, Schotter und Aushub von anderen
Baustellen aus einem ca. 25 km großen Umkreis ... und
sichere weitere Produkte des Menschen durch Verschleppung
und Recycling von Baustoffen. So fand ich beispielsweise
einen ca. 10 cm großen, braunen bis gelblichen Opal aus
dem Basalt von Dietesheim/Steinheim im Bauaushub von
Mühlheim a. Main
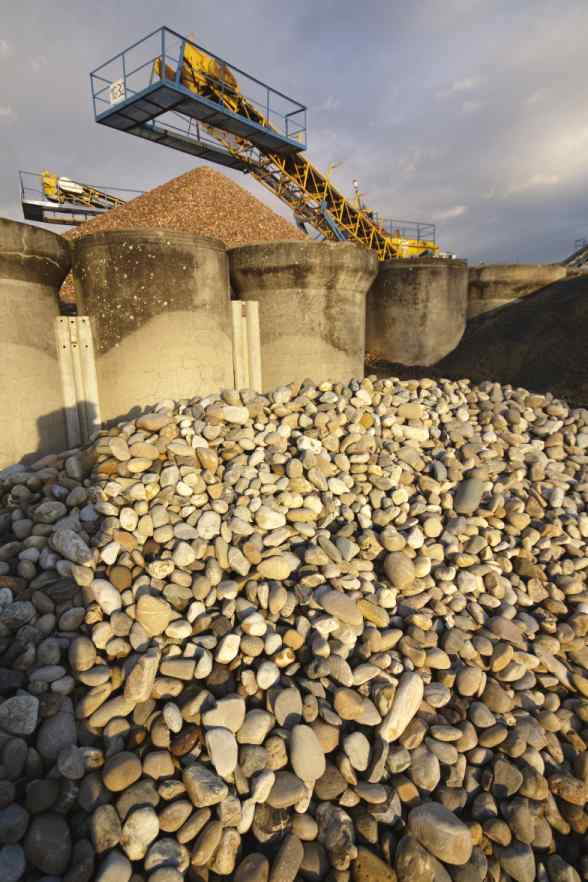
Aber es werden auch Zierkies von anderen Lagerstätten
bevorratet .....
Manche der hier aufgeführten Arten wurden in den ca. 35 Jahren
unterscheidlich intensiven Sammelns nur ein einziges Mal gefunden.
Die Korngröße reicht vom Ton über Sand bis zu mehreren Tonnen
schweren Driftblöcken aus Sandstein, Diorit, verkieselter
Zechstein-Dolomit und Gneis, die in die Gartengestaltung in der
Umgebung der Kiesgruben Verwendung finden.
Die Fundmöglichkeiten sind nach längeren Regenperioden am besten.
Es lohnt sich in der Regel nur die Geröllhalden abzusuchen, da
hier das Überkorn vor dem Brechen zwischengelagert wird.

Basaltisches Gestein mit reichlich Olivin, der heraus
gewittert die Pockennarbige Oberfläche erzeugt. Das Stück
stammt vermutlich aus der Heldburger Gangschar. Gefunden
1969 in den Mainschottern bei Dettingen, als der Main
begradigt wurde,
Bildbreite 9 cm
|

Gut gerundeter und gebänderter Quarzit (metamorph) aus dem
Mainbett beim Ausbaggern der Flussrinne gewonnen und in
Dettingen 1971 aufgesammelt,
Bildbeite 11 cm
|

Der "Kieselstein" schlechthin: Abgerollte Quarze mit einem
hohen Rundungsgrad aus dem Flussbett des Mains und 1971
Mainufer bei Dettingen aufgelesen. Der Ursprung ist der
Spessart, der Odenwald und die Kristallingebiete am Oberlauf
des Mains, also Frankenwald, Fichtelgebirge oder Oberpfälzer
Wald,
Bildbreite 12 cm
|

Toniger Sandstein unbekannter Herkunft aus dem Mainschotter
von Dettingen und gefunden 1969. Hier zeigt es sich, dass
man ohne mikroskopischen Befund nicht entscheiden kann, ob
das Gestein aus der Natur stammt oder einen anthropogenen
Hintergrund hat,
Bildbreite 10 cm
|
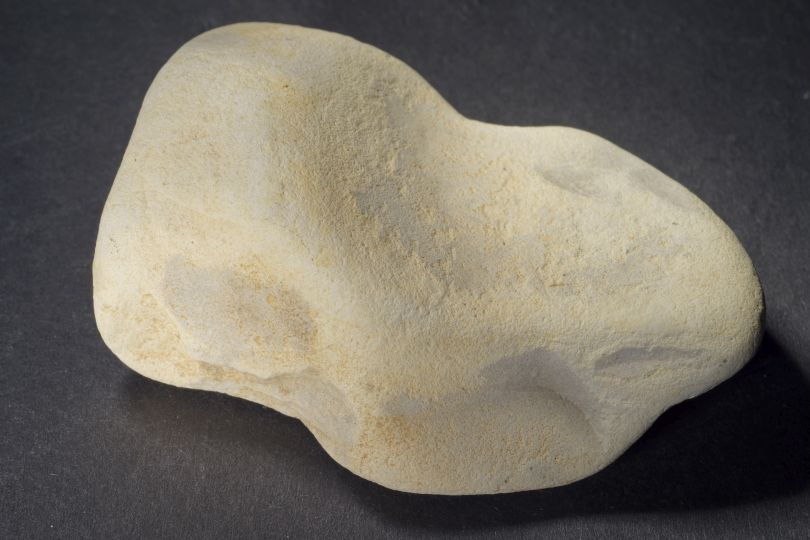
Ungewöhnlicher Flint (Feuerstein) mit einer weißlichen
Verwitterungsrinde; gefunden 1971 in der ehemaligen
Kiesgrube Schultz zwischen Dettingen und Kleinostheim,
Bildbreite 9 cm
|

Relativ großer, gut gerundeter Kieselstein aus einem grauen
Quarz-Geröll. Das Stück stammt sicher aus dem Spessart (oder
Odenwald), gefunden 1974 in der ehemaligen Kiesgrube W.
RACHOR zwischen Kleinostheim und Dettingen,
Bildbreite 15 cm
|
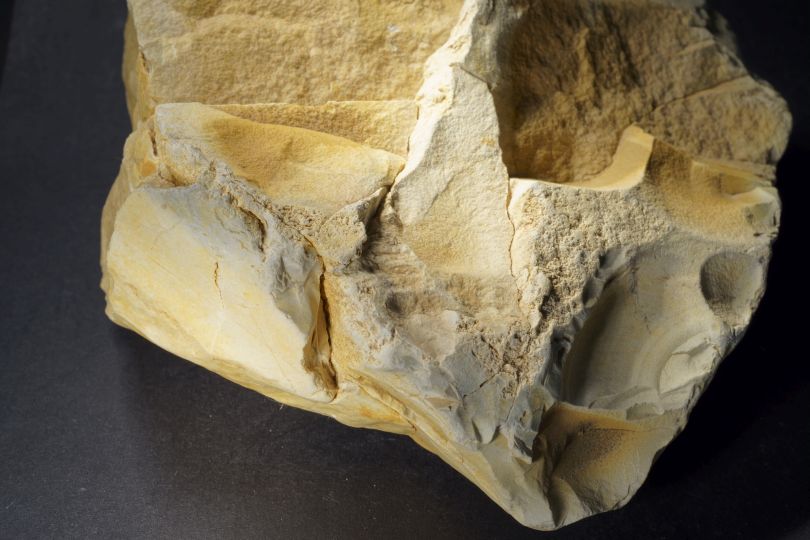
Quarzit als verkieselter Zechstein-Dolomit aus der
ehemaligen Kiesgrube Schultz zwischen Dettingen und
Kleinostheim. Das größere Stück wurde hier 1974 gefunden,
Bildbreite 13 cm
|
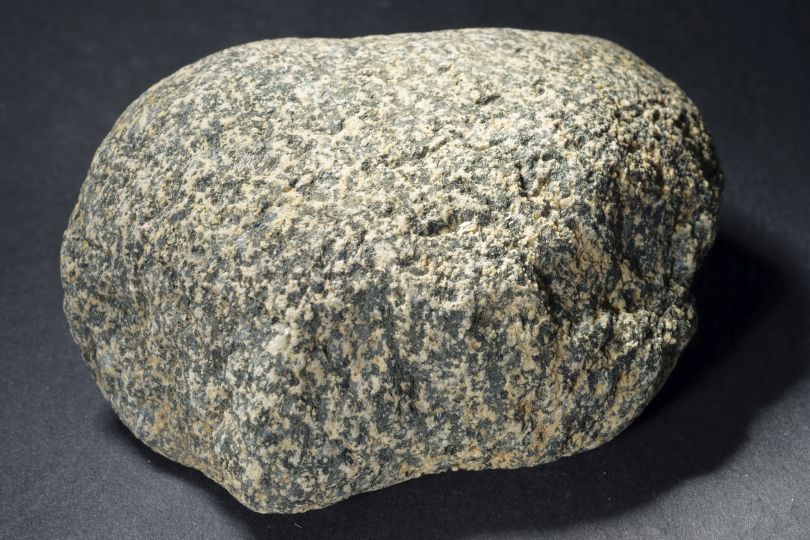
Gut gerundeter Amphibolit aus dem Kristallin des Spessarts
(oder Odenwalds) aus der ehemaligen Kiesgrube der Fa.
Wilhellm RACHOR zwischen Dettingen und Kleinostheim,
Bildbreite 10 cm
|

Gut abgerollte, verschiedenfarbige Quarz-gerölle aus der
Kiesgrube W. Rachor in Kleinostheim. Solche Quarze sind sehr
betsändig und können über mehrerehundert Kilometer in einem
Fluss transportiert werden. Die aus dem Main findet man,
wenn auch dann kleiner, noch in Holland,
Bildbreite 11 cm
|

Vulkanisches, basaltisches Gestein mit einer ganz typischen
Verwitterungsrinde und den Grübchen wo die leicht
zersetzlichen Olivin-Körner fehlen. Solche Gesteine kommen
auch aus der Oberpfalz zu uns. Gefunden 1973 im Kies der
Kiesgrube Rachor bei Kleinostheim,
Bildbreite 12 cm
|

Rissiger, gut gerundeter Gneis, vermutlich aus dem
Spessart-Kristallin (Rotgneis-Komplex) mit einem gering
mächtigen Quarz-Gang (rechts am Stück zu sehen) aus der
Kiesgrube RACHOR zwischen Dettingen und Kleinostheim;
gefunden 1974,
Bildbreite 8 cm
|

Geröll auf weißem Quarz mit reichlich dünnnadeligen
Turmalin-Kristallen (Schörl) aus dem Kristallin des
Spessarts. Solche Gesteine kommen um Aschaffenburg vor.
Ausgelesen 1987 aus dem Überkorn der Kiesgrube Volz &
Herbert zwischen Hörstein und Dettingen,
Bildbreite 9 cm
|
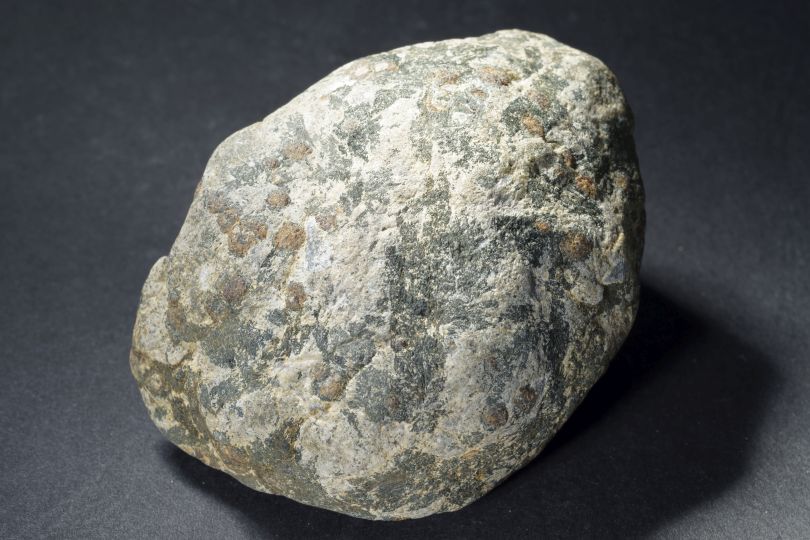
Ein ganz seltenes und auffallendes Gestein:
Granat-Amphibolit mit unbekannter Herkunft. Das Geröll wurde
1975 aus dem Überkorn der Kiesgrube Rachor zwischen
Dettingen und Kleinostheim aufgelesen,
Bildbreite 10 cm
|

Eine Brekzie mit einer kalkigen Bindung, sehr wahrscheinlich
aus den Kalkgebieten mainaufwärts oberhalb von
Marktheidenfeld. Gefunden 1971 in der Kiesgrube Rachor
nördlich von Kleinostheim,
Bildbreite 11 cm
|

Ein nicht bekanntes, kieseliges Gestein mit zahlrichen
Klüften, in denen sich schwarzes Manganoxid abgeschieden
hat. Gefunden 1972 im Kies der Kiesgrube Rachor bei
Kleinostheim. Hier ist es nicht möglich, eine Herkunft im
Main-Einzugsgebiet anzugeben,
Bildbreite 8 cm
|

Zwei Kieselschwämme als verkieselte Fossilien aus dem
Kalkstein den Kalkvorkommen im Main-Einzugsgebiet oberhalb
von Wertheim. Diese hartenFossilien sind meist länglich und
besitzen eine achsiale Bohrung, die oft leichter verwittert
und so ein Loch hinterlässt. Die Gesteinsaufbau ist - dort
wo man es erkennen kann - schwammig, wie man in dem rechten,
weißen Stück sehen kann. Gefunden 1972 in der Kiesgrube
Rachor bei Kleinostheim,
Bildbreite 10 cm
|

Ortstein. Eine durch Eisenhydroxide erzeugte, harte
Verkittung des örtlichen Kieses, meist an der (früheren)
Grenze zwischen Grundwasser und der Atmosphäre und damit die
Grenze zwischen dem reduzierenden Grundwasser und der
oxidierenden Luft. 1973 gefunden im Kies der Kiesgrube
Rachor bei Kleinostheim. Das Stück wurde zum Erhalt mit
einem Kunststoff
gefestigt,
Bildbreite 10 cm
|
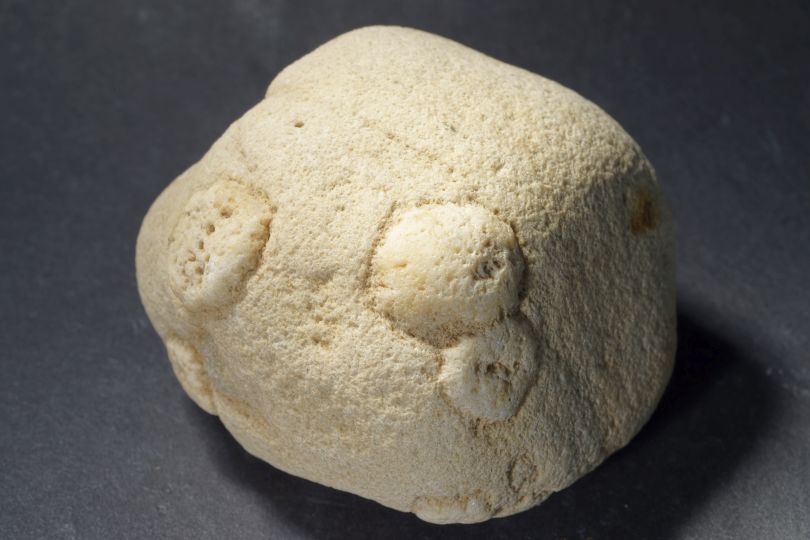
Eine andere Art des "Kugelsandsteins", bei dem im Sandstein
(hier kieselige) Konkretionen gebildet wurden, die etwas
härter sind als der normale Sandstein, und so etwas
hervorstehend heraus präpariert werden. Gefunden 1972 im
Kies der Kiesgrube Rachor südlich von Dettingen,
Bildbreite 9 cm
|

Gangfömige, pegmatoide Masse aus reichliche Muskovit, Quarz
und etwas Feldspat ohne akzessorische Mineralien wie
Turmalin. Das Stück stammt aus der Mömbris-Formation des
Spessarts und wurde 1971 in der Kiesgrube Rachor bei
Kleinostheim gefunden,
Bildbreite 11 cm
|

Bänder von Eisenhydroxid (Goethit) im Sandstein des
Buntsandsteins aus Spessart oder Odenwald, gefunden 1971 in
der Kiesgrube Rachor bei Kleinostheim,
Bildbreite 8 cm
|

Bröseliger Rhyolith (Quarz-Porphyr) welches man dem
Vorkommen von Sailauf zuordnen kann. Gefunden 1971 in der
Kiesgrube der Fa. Rachor nördlich von Kleinostheim,
Bildbreite 10 cm
|
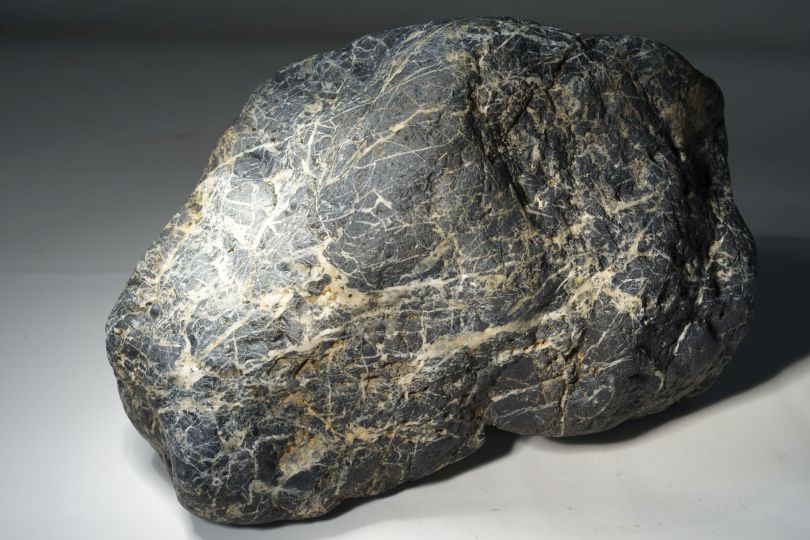
Außergewöhnlich großes Stück eines Kieselschiefers aus dem
Mainschotter von Großostheim, gefunden 2016. Diese markanten
Gesteine mit der auffallenden Kombination aus schwarzem
Gestein mit weißen Adern sind Bestandteil aller jungen
Mainschotter (Leitgeröll).
Bildbreite 20 cm
|

Flaches Stück eines Radiolarit (anderer Name für
Kieselschiefer) mit weißen Rissfüllungen aus Quarz aus der
Kiesgrube Weber in Großostheim, gefunden 2019. Unter dem
Mikroskop in einem Dünnschliff hat man grundsätzlich die
Möglichkeit noch Radiolarien zu sehen. Die schwarze Farbe
des Gesteins resultiert aus dem Gehalt an organischem
Kohlenstoff
Bildbreite 12 cm
|
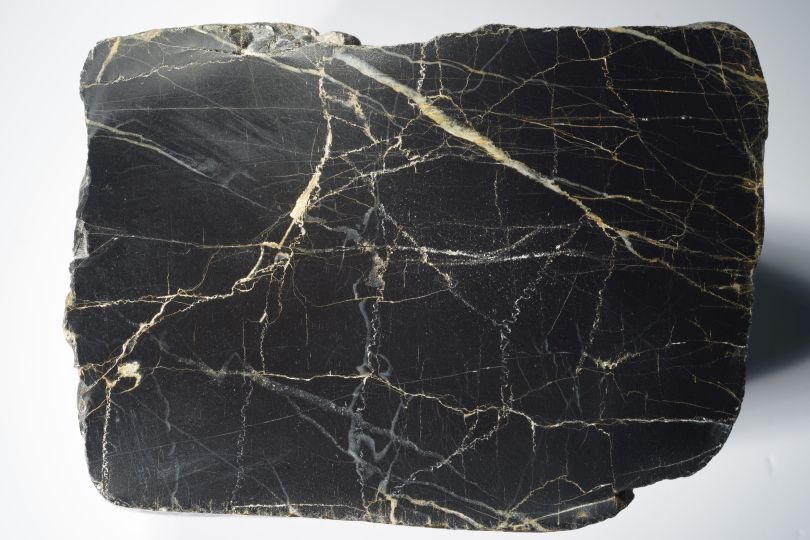
Lydit (anderer Name für Kieselschiefer) aus dem
Main-Schotter, angeschliffen und poliert. Man sieht darin
die sehr kleinstückige Zerlegung des Gesteins und die
Ausfüllung durch weißen Quarz, gefunden 1999 in der
Kiesgrube der Fa. Volz & Herbert zwischen Hörstein und
Dettingen,
Bildbreite 10 cm
|
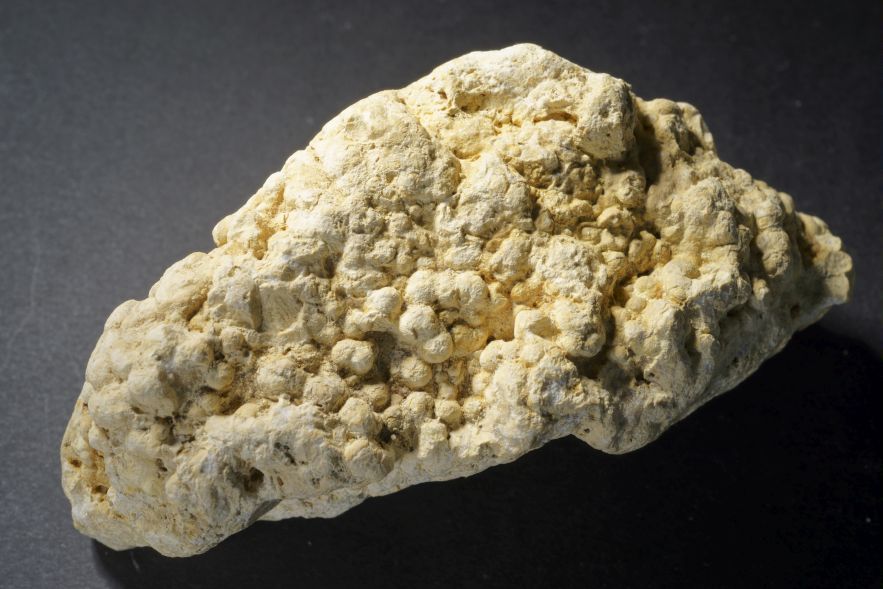
Kalkoolith (auch als "Rogenstein" bezeichnet) als Geröll aus
der Kiesgrube Volz & Herbert; gefunden 2019,
Bildbreite 9 cm
|
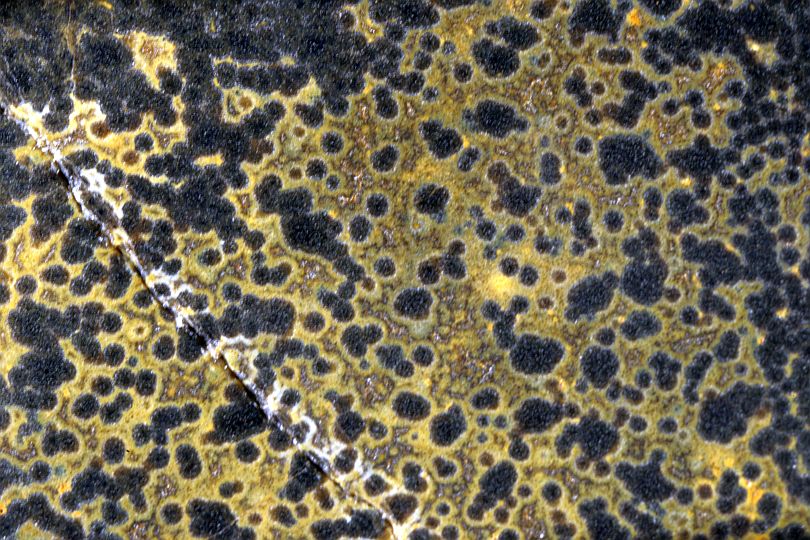
Von außen ein Kieselholz, aber innen gar nicht nach einem
Holz aussehend. Es handelt sich um Prototaxites,
einem merkwürdigen Gewächs aus dem Devon. Hier stellt sich
die Frage nach der Herkunft, denn im heutigen Einzugsgebiet
des Mains gibt es kein terrestrisches Devon.
Bildbreite 7 mm
|
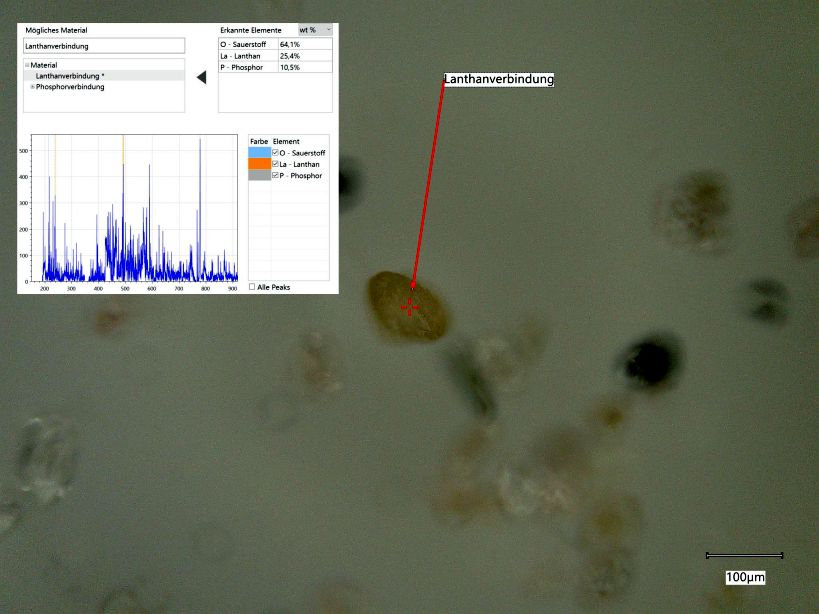
Aus einem Schwermineralkonzentrat stammt dieses 0,1 mm
große, runde braune Korn von Monazit-(La). Der U-Gehalt
liegt unter der Nachweisgrenze des Analyse-Verfahrens. Die
anderen Körnchen sind Zirkon und ein schwarzer Ilmenit;
Bildbreite 1 mm.
|
Grundsätzlich könnte man alle Gesteine aus dem Einzugsgebiet des
Mains oderhalb der jeweiligen Fundstelle finden - theoretisch. In
der Praxis reduzieren sich die Funde auf relativ wenige Gesteine,
die aufgrund der Eigenschaften einen mehr oder minder langen
Transport überstehen. Weiche Gesteine werden zerrieben (Löss,
Kalksinter, Marmor, Baryt, ...), andere sind zu selten (durch die
"Verdünnung" mit den anderen Gesteinen; hier wären der Eklogit,
Spessartit, usw. anzuführen), kommen natürlich kaum in kleinen
Stücken vor (Diorit, ...) oder werden leicht aufgelöst (Gips,
...), so dass sie im Geröllspektrum fehlen.

Beispiel für ein Gestein, welches bisher noch nicht am Untermain
aufgefunden wurde:
Auffallend schwerer Eklogit aus grünem Omphacit (Klinopyroxen) und
braunrotem Granat (Pyrop) von der Fundstelle Silberbach bei
Konradsreuth bei Hof (Typlokalität für Omphacit), gefunden von
Karlheinz GERL, Oberkotzau;
Bildbreite 9 cm.
Gold
Wäscht man eine größere Masse an Sand und Kies durch, so erhält
man die dunkle Schwermineralfraktion aus Hämatit, Magneit,
Ilmenit, Granat, Staurolith und anderen Mineralien. Das Verfahren
ist sehr anstrengend, kann im Winter nicht ausgeführt werden und
die Ausbeute liegt im Bereich von µg.


Darunter auch etwas gediegen Gold, wie im Bild rechts zu sehen
ist. Die Flitter sind nur 0,1 mm groß!.
Der Gehalt ist sehr klein und hat selbst im Mittelalter nicht für
ein Waschen ausgereicht. Details zu dem Goldfund können Sie hier nachlesen.
aufgenommen am 01.06.2008

Das Gold kommt wahrscheinlich aus dem Fichtelgebirge; hier ist die
Korngröße deutlich größer (Sammlung A. MOHRHARD, Aschaffenburg).


Wer sich über die Herkunft des Goldes informieren will, dem sei
das Goldmuseum in Goldkronach bei Bayreuth wärmstens empfohlen.
Links ist das alte
Forstgebäude zu sehen, in dem das Museum eingerichtet wurde.
Rechts sieht man eine Lupe vor einem Stück Quarz, in dem etwas von
dem mm-großen
Gold als Berggold zu sehen ist.
aufgenommen am 28.12.2008
Es ist am Oberlauf des Mains Gold in Gramm-Mengen Gold gefunden
bzw. gewaschen worden, dass man daraus Medaillen geprägt hat:


2020 wurden 60 Medaillen mit einem Gewicht von etwa 5,5 g geprägt,
so dass das etwas mehr als ein früheren
Dukat entspricht (~3,5 g). Der Feingehalt beträgt 920, was 92,05 %
Au entspricht. Weiter sind 7,26 % Ag,
0,030 % Pd und 0,011 Pt enthalten. Die restlichen 0,649 % sind
wahrscheinlich Cu, Fe und andere Elemente
wie Hg, die nicht analysiert wurden. Der Durchmesser liegt bei
22,3 mm und die Dicke bei 1 mm. Die Stempel
wurden von Victor HUSTER aus Baden-Baden gestaltet.
Literatur
[Anon.] (1966): Aus der Geschichte der RWE-Betriebsverwaltung
Dettingen und ihrer Vorgängerin, der "Gewerkschaft Gustav".- Unser
Kahlgrund Heimat Jahrbuch für den Landkreis Alzenau, S. 134 - 143,
Alzenau.
[Anon.] (1999): 100 Jahre Firma Volz: Vom Einmann-Betrieb zum
kompetenten Partner der Bauwirtschaft.- Main-Echo vom Donnerstag,
19. August 1999, S. 19, [Main-Echo & Kirsch] Aschaffenburg.
ALTMEYER, H. (1964): Reste devonischer Algenbäume als
Rheingerölle.- Der Aufschluss 15, S. 209 - 212,
Heidelberg.
ALTMEYER, H. (1964): Zur Bestimmung verkieselter Hölzer aus
Rheingeröllen bei Köln.- Der Aufschluss 15, S. 287 - 291,
Heidelberg.
ALTMEYER, H. (1989): Über weitere Rheingerölle.- Aufschluss 40,
S. 197 - 200 Heidelberg.
Autorenkollektiv (1936): Die nutzbaren Mineralien, Gesteine und
Erden Bayerns.- II Band Franken, Oberpfalz und Schwaben nördlich
der Donau, 509 S., [Verl. R. Oldenbourg und Piloty & Loehle]
München.
Autorenkollektiv (1986): 400 Millionen Jahre Wald.- Aktuelle
Geo-Information der Freunde der Bayerischen Staatssammlung für
Paläontologie und historische Geologie, 64 S., München.
Autorenkollektiv (1998): 100 Jahre RWE 70 Jahre RWE Dettingen 40
Jahre VAK.- Karlsteiner Geschichtsblätter 8, November 1998, 36 S.,
[Kolb-Druck] Karlstein.
BEISER, V. (2021): Sand. Wie uns eine wertvolle Ressource durch
die Finger rinnt.- 315 S., ohne Abb., [oekom Verlag] München. (in sicher interessantes wirtschafts- und
gesellschaftspolitiches Buch über den Rohstoff Sand, aber die
deutsche Übersetzung krankt daran, dass kein Geo- oder/und
Mineraloge lektoriert hat; es sind zahlreiche Fehler enthalten,
die vermutlich bereits im amerikanischen Original enthalten sind
und dann noch weitere "Übersetzungsfehler", die aufgrund der
Fachfremdheit eingebaut wurden)
EIKAMP, H. (1976): "Blitzröhren" - Bildung von Sand- und
Felsfulguriten.- Aufschluss 27, S. 225 - 227, Heidelberg.
GARUTT, W. E. (1964): DAS MAMMUT.- Die neue Brehm Bücherei, Band 331,
140 S., Wittenberg-Lutherstadt.
Gewerkschaft Gustav & Geschichtsverein Karlstein a. Main
(2004): 100 Jahre Gewerkschaft Gustav.- Karlsteiner
Geschichtsblätter Ausgabe 9, August 2004, 56 S.,
zahlreiche SW-Abb., [Kolb Offsetdruck] Karlstein.
HARDER, H. (1993): Zur Entstehung von verkieselten Hölzern.-
Aufschluss 44, S. 23 - 31, Heidelberg.
HEINRICH, A. (1984): Eine neue Skelettrekonstruktion des
Wollnashorns Coelodonta antiquitatis BLUMENBACH im Museum
Bottrop.- Aufschluss 35, S. 391 - 394, Heidelberg.
HOSELMANN, C., LAUPENMÜHLEN, T., BOHATY, J., RADKE, G., WEBER, G.,
& WEIDENFELLER, M. (2018): Field Trip C (27 September 2018):
Fluviatile und äolische Ablagerungen im Rhein-Main-Gebiet, DEUQUA
Spec. Pub., 1, 29–52, 20 Abb., 1 Tab.,
https://doi.org/10.5194/deuquasp-1-29-2018.
KLEIN-PFUEFFER, M. & MERGENTHALER, M. [Hrsg.] (2017): Frühe
Main Geschichte Archäologie am Fluss.- 288 S., sehr viele farb.
Abb., Knauf Museum Iphofen [Nünnerich-Asmus Verlag & Media
GmbH] Mainz.
KRÜGER, F. J. (1977): Ein Flintgeröll mit Nasenmarken.- Aufschluss
28, S. 401 - 402, Heidelberg.
KÜHNE, W. G. (1983): Gold für uns aus der Kiesgrube.- Aufschluss 34,
S. 215 - 218, Heidelberg.
LOGA, S. v. (2023): Schätze des Rheins Rheinkiesel,
Halbedelsteine, Fossilien, Gold und Eiszeitknochen am Rhein
finden.- 157 S., sehr viele farb. Abb. als Fotos, Grafiken
und Karten, [Eifelbildverlag] Daun.
LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte
Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 12 - 13, 17, 32 - 33, 36 - 37,
40, zahlreiche Abb..- in Karlsteiner Geschichtsblätter Ausgabe 12,
64 S., Hrsg. vom Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH]
Karlstein.
KÜHNE, W. G. (1985): Paläontologische Silexforschung I, ein
Programm.- Aufschluss 36, S 239 - 243, Heidelberg.
LORENZ, J. & WEIS, T. (2008): Gediegen Gold aus den
Mainschottern am Unterman.- Der Aufschluss 59, S. 213 -
219, 4 Abb., 2 Tab., [VFMG] Heidelberg.
LORENZ, J. & JUNG, J. (2009): Die Mainkiesel. Quarz,
Sandstein, Gold und Fulgurite. Ein Beitrag zu den Sedimenten des
Maines und seiner Zusammensetzung, der Herkunft und wie man daraus
den früheren Mainlauf ableiten kann.- Spessart Monatszeitschrift
für die Kulturlandschaft Spessart 103. Jahrgang, Heft
6/2009, S. 3 - 29, 85 Abb., [Main-Echo GmbH & Co KG]
Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 767ff.
LORENZ, J. (2022): Die Konkretionen im Spessart und am Untermain.
Ortsteine, Raseneisensteine, Lösskindel, Hornsteine, Ooide.- in
LORENZ, J. A. & der Naturwissenschaftliche Verein
Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen & Mangan. Erze,
Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten des
Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,
S. 61 - 132, 105 Abb., 7 Tab.
LORENZ, J. [Hrsg.] (2023): Aus Holz wurde Stein: Fossiles und
„versteinertes“ Holz aus Wetterau, Vogelsberg, Spessart, Rhön und
Franken - über 250 Jahre Forschungen.- Mitteilungen des
Naturwissenschaftlichen Museums Aschaffenburg, Band 31, 430 S.,
1.281 meist farb. Abb., 23 Tab., Naturwissenschaftlicher Verein
Aschaffenburg e. V., [Helga Lorenz Verlag] Karlstein a. Main.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 62, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,
Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei
Joh. Walch] Augsburg.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen
zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- 336
S. München 1967
PAULI, P. & JUNG, J. (2018): Als der Main Berge formte. Vier
Erhebungen am Flussufer im Ost- und Südspessart haben eine
besondere Vergangenheit – Das Himmelreich bei Kreuzwertheim könnte
der nächste dieser Umlaufberger werden.- Spessart
Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft am Main 112.
Jahrgang, Heft Januar 2018, S. 14 - 20, 10 Abb., 1 Tab.,
[Main-Echo GmbH & Co KG] Aschaffenburg.
PÄTZ, H., RASCHER J. & SEIFERT, A. (1986): Kohle - ein Kapitel
aus dem Tagebuch der Erde.- 150 S., Frankfurt.
PROBST, E. (1986): Deutschland in der Urzeit. Von der Entstehung
des Lebens bis zum Ende der Eiszeit.- 479 S., München.
PROPACH, G. (2023): Zerbrechen von Geröllen beim Transport im
Fluss.- Journal of Applied and Regional Geology ZDGG Zeitschrift
der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 174(4),
p. 791 - 796, 6 figs., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung]
Stuttgart.
RENFTEL, L.-O. (1995): Verbreitung und Ausbildung pliozäner
Ablagerungen in der Umgebung von Hanau.- Jber. wetterau. ges.
Naturkunde 146 - 147, S. 55 - 70, Hanau.
RÜCKER, E. (1974): Erinnerungen an das Braunkohlenbergwerk in
Großwelzheim.- Unser Kahlgrund Heimat Jahrbuch 19, S. 90 -
92, Alzenau.
RÜCKER, E. (1980): Torfstich vor 150 Jahren in Großwelzheim, Kahl
und Emmerichshofen.- Unser Kahlgrund Heimatjahrbuch 25, S.
86 - 89, Alzenau.
RÜCKER, E. (1982): Kahl am Main im Wandel der Jahrhunderte.- Hrsg.
von der Gemeinde Kahl am Main, 544 S., [D. Steiner] Kahl.
RUTTE, E. (1987): Rhein.Main.Donau. Wie - wann - warum sie wurden.
Eine geologische Geschichte.- 154 S. Sigmaringen
SEIDENSCHWANN, G. (1980): Zur pleistozänen Entwicklung des
Main-Kinzig-Kahl-Gebietes.- Rhein-Mainische Forschungen Heft 91,
194 S., Frankfurt
SEIDENSCHWANN, G., GRIES, H. & THIEMEYER, H. (1995): Die
fluvatilen Sedimente in den Baugruben des Wohnparks Mühlheim
zwischen Ebertstraße und Offenbacher Straße in Mühlheim/Main.-
Jber. wetterau. ges. Naturkunde 146 - 147, S. 71 - 86,
Hanau.
STÜRMER, W. (1959): Untersuchungen an Kieselschiefer-Geröllen des
Maines.- Nachr. Naturw. Museum Aschaffenburg 63, S. 1 -
25, 5 Tafeln, Aschaffenburg.
TYROFF, H. (1978): Fossile Kieselhölzer im Maintal von Weilbach
bei Flörsheim.- Aufschluss 29, S. 287 - 297, Heidelberg.
Kiesgrube Fa.
Weber bei Großostheim
In der Kiesgrube in unmittelbarer Nähe zum Flughafen bei
Großostheim werden die Kiese mittels eines Schwimmbaggers
abgebaut. Man fördert bis aus einer Tiefe von 22 m dann tertiäre
Sande und Kiese ab. Diese werden in einer aufwändigen Aufbereitung
zu verschiedenen Klassierungen verarbeitet.


Der ca. 350 t schwere Schwimmbagger fördert weitgehend
automatisiert den Kies aus dem See. Der 8 m³ fassende Greifer
schüttet den Rohkies
auf einen Rost, über den die großen Steine und Tonbrocken
ausgesiebt werden,
aufgenommen am 05.07.2013.

Der Rohkies wird über Förderbänder zur Aufbereitung gebracht,
aufgenommen am 03.07.2020
Der Abbau stellt auch bis zum Grundwasserspiegel Wände frei, die
aber aufgrund der geringen Bindung im Kies keine lange Standzeit
haben. Unter dem Ackerboden sind sandige Tonsteine aufgeschlossen,
die sehr scharf abgegrenzt in den Sand und dann Kies übergehen
(siehe das Foto vom Würgeboden unten).
Der frei gelegte Kies zeichnet sich durch einen hohen Anteil
(geschätzt 95 %) an Sandsteingeröllen aus. Kristalliengesteine
fehlen fast völlig (der Spessart kann nichts geliefert haben und
die Kristallingebiete Oberfrankens sind 300 km mainaufwärts).
Vulkanische Gesteine wie Basalt stammen wohl größtenteils aus dem
nahen Odenwald, von der Heldburger Gangschar und vielleicht auch
aus der Oberpfalz, die vielen Kieselschiefer bezeugen einen
pleistozänen bis holozänen Schotterkörper des Mains. Selten finden
sich Stücke aus verkieseltem Holz. Kalkgerölle aus dem Muschel-
und Keuperkalk sind nicht sehr häufig und kaum angelöst.
Kieselsteine aus kristallinem Quarz sind in kindskopfgroßen
Stücken zu sehen, aber auch selten.
Bemerkenswerte Beobachtungen und Funde aus der
Kiesgrube:

Der Kies ist stellenweise sehr reich an Geröllen und ein
typisches Produkt eines extremes Kaltklimates während des
Hochglazials der würmzeitlichen Vereisung. Tonanteile und
organische Stoffe oder Reste fehlen völlig;
aufgenommen am 30.04.2011
|
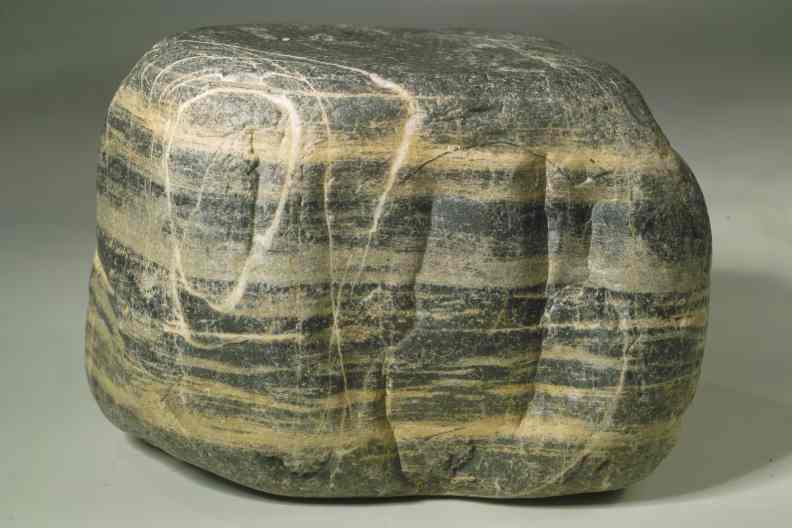
Kieselschiefer - oder ein dunkler Hornstein?
Bildbreite 7 cm
|

Flint als Geröll mit der typischen Farbe, dem typisch
muscheligen Bruch und dem Glanz auf den Bruchflächen,
gefunden am 25.08.2013
Bildbreite 10 cm, |

Ungebrochener Kies, hauptsächlich aus Sandsteingeröllen
bestehend,
aufgenommen am 30.04.2011
|
 Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit
einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am
Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,
Bildbreite 6 cm,
Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit
einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am
Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,
Bildbreite 6 cm,
gefunden am 14.06.2012.
Das ist der einzige Fund eines solches Mainachats, die aus
dem Oberlauf des Mains bekannt sind. Die als
"Mainachate" bekannten Gerölle stammen ursprünglich aus dem
Grenzkarneolhorizont des Buntsandsteins im Raum Bayreuth -
Kulmbach und Kronach in Oberfranken (SCHEIDER 2005).
|

Über dem reinen Schotter sind Sandlagen mit Tropfen- und
Würgeböden angeschnitten, die das Periglazial der Region
bezeugen. Über dem Sand befindet sich eine Tonschicht, die
tropfenförmig in den Sand eingedrungen ist,
aufgenommen am 30.04.2011
|

Eisdriftblöcke bis zu einem Gewicht von ca. 1 t bestehen
vorwiegend aus schlecht gerundeten Buntsandstein-Felsen, die
in den Schotterkörper eingestreut sind. Diese Steine werden
ausgehalten, an zentraler Stelle aufgeschüttet und zur
Gartengestaltung verwandt,
aufgenommen am 30.04.2011.
|

Der Inbegriff für einen Kieselstein: Quarz. Das weiße Geröll
stammt entweder aus dem Odenwald oder aus den Regionen der
Kristallingebiete Oberfrankens,
Bildbreite 7 cm

Bildbreite 9 cm
|

Vulkanische Gesteine, wie z. B. Basalte, kommen aus der
Heldburger Gangschar oder der Oberpfalz mit dem Main in den
Schotterkörper. In der Regel sind diese stark verwittert und
manche können mit der Hand zerbröselt
werden,
Bildbreite 11 cm
|

Solche Kalksteine aus den Muschelkalk- und Keupergebieten
oberhalb von Marktheidenfeld werden im Grundwasser des
Kieses angelöst und die Ionen sind der Grund für das "harte"
Trinkwasser aus der Niederterrasse des Mains,
Bildbreite 15 cm
|

Kieselschiefer kommen ausschließlich im Frankenwald vor und
sind das Vorzeigegeröll der jungen Mainschotter. Es handelt
sich bei den auch als Radiolarit zu bezeichnenden Gestein um
ehemaligen Ozeanboden. Die gelbliche Färbungist eine Folge
von Eisenhydroxiden, die im Grundwasser ausgefällt wurden,
Bildbreite 15 cm
|

Brauner Hornstein, hier ein verkieselter Muschelkalk mit der
Erhaltung von Schalen und den geschlossenen Muscheln bzw.
Brachiopoden die jetzt als leere Hohlräume zu sehen sind,
Bildbreite 13 cm
|

90° zur einstigen Flussrichtung angeschnittene, mit feinem
Sand gefüllte und etwa 2 m breite Rinne im Kies,
aufgenommen am 23.08.2013
|

Dichter Hornstein, der die unterschiedlich porösen Lagen
nachzeichnet,
Bildbreite 13 cm
|

Sehr großes Stück (4 kg) speckiger Horstein mit einigen
Vertiefungen, in denen farblose Quarz-Kristalle gebildet
wurden,
Bildbreite 15 cm
|

Halber Stamm-/Astabschnitt eines fossilen Holzes aus den Sedimenten
des Mains,
Bildbreite 12 cm
|

Frisch gebrochenes Stück Holz
(verkieselt), welches vom Vorbrecher auf dem
Schwimmbagger zerkleinert worden ist; Sammlung Julius
KAPELLER, Hörstein
Bildbreite 13 cm
|

Weißes Quarzgeröll mit schwarzem Turmalin als
typischerBestandteil metamorpher Quarze; das Herkunftsgebiet
liegt vermutlich im Odenwald,
Bildbreite 7 cm
|

Rundlicher Kieselschwamm in einer schaligen
Hornsteinkonkretion,
Bildbreite 10 cm
|

Im Rahmen einer Führung durch den Großostheimer Forstwirt
Toni Schwanzer konnten die Besucher auch kaltzeitliche
Kiesablagerungen, Erosionsdiskordanzen, gradierte
Schichtungen und Rinnen anschauen. Anhand von Plänen wurde
die Rekultivierung der Kiesgrube in den nächsten Jahren
erläutert. Der Betriebsleiter, Herr Willi SCHLEGEL beschrieb
die Kiesgewinnung. Die Kinder hatten Spaß bei der Suche nach
besonderen Steinen. Anschließend gab es im benachbarten
Ziegenhof der Familie ZAHN leckeren Ziegen-Käse zur Probe.
Aufgenommen am 01.07.2017
|

Rhyolith aus einem bisher nicht bekannten Vorkommen
innerhalb des Einzugsgebiets des Mains. Das Gestein mit dem
porphyrischen Gefüge besteht aus weißlich alterierten
Feldspäten, Quarz und der Grundmasse, die von
mineralisierten Rissen durchzogen ist.
Bildbreite 6 cm
|

Sandstein mit Rissfüllungen aus weißem Quarz,
Bildbreite 12 cm
|

Typische Knollen aus Flint (Silex) mit einer weißlichen
Rinde und dem braunen Innern (Konkretion) aus der Kiesgrube
der Fa. Schumann & Hardt bei Babenhausen,
gefunden am 02.12.2017
Bildbreite 9 cm
|
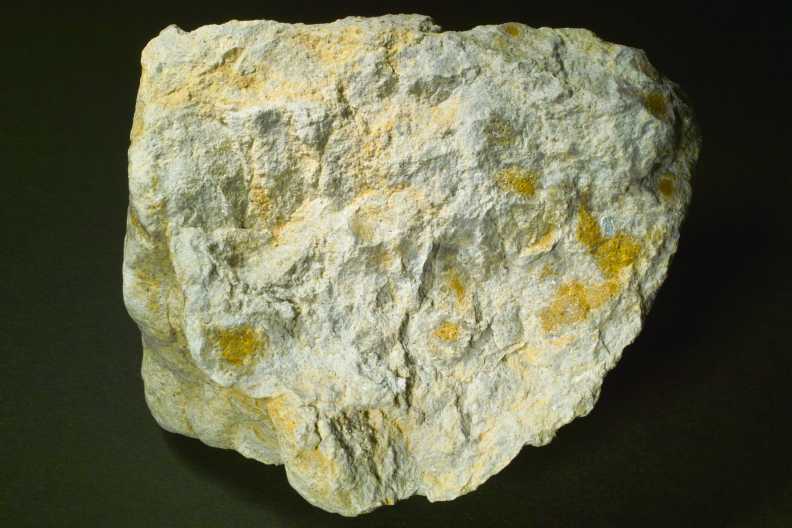
Tertiärquarzit (frische Bruchfläche durch den Vorbrecher)
aus einem nicht bekannten Vorkommen Mainaufwärts,
Bildbreite 11 cm
Auch wenn man denkt, dass kaum noch Neunachweisemöglich
sind, wird man doch hin und wieder für Ausdauer belohnt.
|

Dünne Lage einem Manganoxids auf einem Sandsteingeröll aus
der Grenzzone des Grundwassers und der Atmosphäre,
Bildbreite 12 cm
|

Konkretion eines Eisenhydroxids mit dem Sand und Kies, mit
stellenweise ausgesparten Teilen, so dass der heraus
gefallene Sand Löcher erzeugt. Solche Bildungen entstehen
durch Migration von Eisenionen im Wasser und anschließendem
Fällen, so dass der Porenraum zwischen den Sandkörnern
ausgefüllt wurde,
Bildbreite 13 cm
|

Es ist nicht immer einfach, einen Stein zu bestimmen. Hier
liegt ein gut gerundete Schlacke mit Holzkohle vor. Aber
stammt das aus der Natur? In dem Fall sicher nein, denn so
etwas ist sehr selten und im Einzugsgebiet des Mains extrem
unwahrscheinlich bzw. gar nicht vorstellbar. Lange kann so
ein weicher Stein auch nicht transportiert worden sein. Ein
Stein, der durch Verschleppung in die Kiesgrube gelangte,
Bildbreite 10 cm
|

Abgerolltes Stück Diorit - ein sicher seltenes Stück, dann
der Diorit neigt bei der Verwitterung zur Vergrusung, so
dass es nur wenige Gerölle gibt.
Bildbreite 12 cm
|
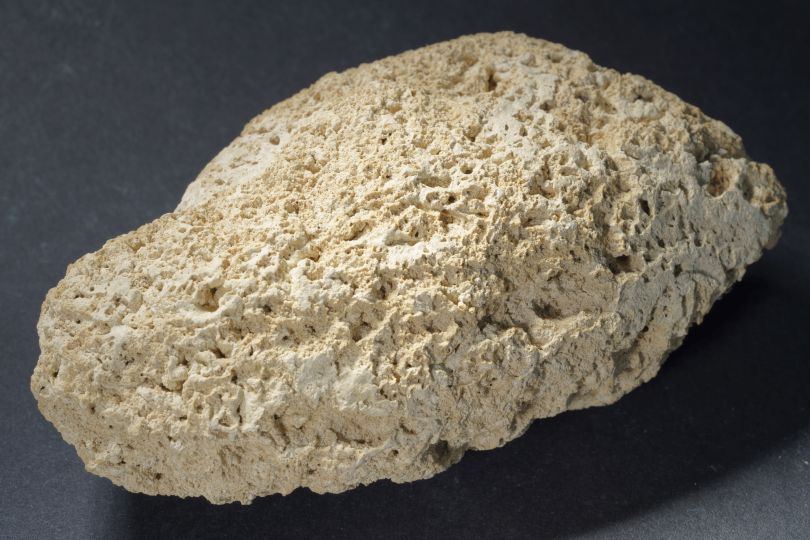
Im trockenen Zustand leichter und sehr weicher Kalktuff als
Süßwasserkalk aus dem Geröllspektrum des Mains, ein sicher
ganz seltenes Gestein. Das mainaufwärts nächste bekannte
Vorkommen ist heute Triefenstein,
Bildbreite 13 cm
|


Hornstein mit einem Achatband: oben roh, unten geschliffen,
Bildbreite 8 cm
|

Pegmatit mit reichlich Plagioklas,
Bildbreite 8 cm
|

Auf dem ersten Blick denkt man an einen Tertiär-Quarzit.
Unter dem Mikroskop offenbart sich dann einen Struktur, die
an einen verkieselten Vulkanit erinnert,
Bildbreite 11 cm
|

Rundliches, an der Oberfläche glattes, durch Fe-haltige
Sickerwässer bräunlich gefärbtes Geröll aus einem typsichen
Tertär-Quarzit, gefunden in der Kiesgrube der Fa. Weber
2020. Eine Unterscheidung zu den ähnlich aussehenden
Sandsteinen des Buntsandsteines ist nur nach einer
mikroskopischen Bemusterung möglich,
Bildbreite 10 cm
|
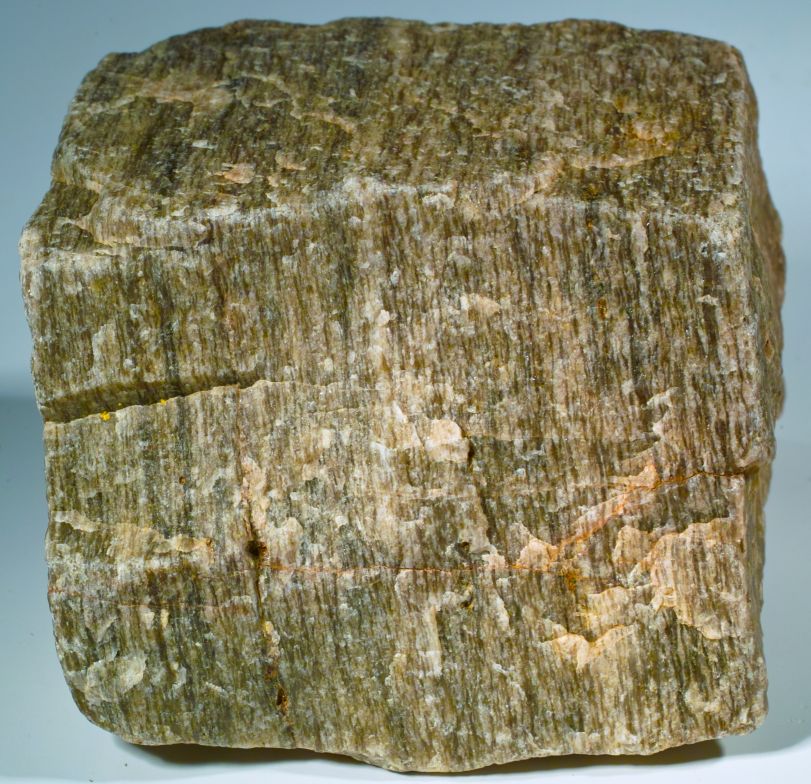
Eigenartiger Quarzit ohne Glimmerschüppchen, aber mit
Magnetit,
Bildbreite 6 cm
|

Sandstein mit zahlreichen Löchern,
Bildbreite 5 cm
|

Ein weiteres Beispiel für einen seltenen Stein, der nicht
natürlichen Ursprungs ist:
Straßenaufbruch aus Asphalt mit eingeschlossenen
Schotterbruchstücken aus einem grauen Kalkstein. Unter dem
Mikroskop erkennt man dann noch Quarzsand als Bestandteil im
Asphalt.
Bildbreite 10 cm
Solche Stücke gelangen durch Verschleppung in die Kiesgrube.
Man muss also immer kritisch prüfen, ob wirklich ein
Naturstein vorliegt oder ob der Stein eingeschleppt wurde -
insbesondere dort wo LKW-Verkehr vorhanden ist.
|

Teil eines einst etwa 30 cm großen, weißen und gut
gerundeten Gerölls mit einen schwarzgrauen Innern aus einem
vulkanischen Gestein. Die kaolinitisch alterierte, weiche
Rinde entstand vermutlich im Tertiär durch Verwitterung des
Gesteins. Es wurde ein Stück abgesägt und geschliffen,
Bildbreite 18 cm |

Zerklüfteterer Sandstein mit zahleichen Füllungen aus weißem
Quarz,
Bildbreite 13 cm
|

Weißlich alterierter Rhyolith mit zahlteichen, ebenfalls
weißen Quarz-Gängchen. Solche Gesteine sind aus Sailauf und
Eichenberg im Spessart bekannt,
Bildbreite 8 cm
|

Der klassische Kieselstein: Ein gut gerundeter, weißer
Quarz, vermutlich aus einem Kristallingebiet,
Bildbreite 7 cm
|

Ein Gestein aus (verwitterten) Feldspat-Körnern im Quarz
ohne Glimmer; solche Gesteine sind als Feldspat-Lagen-Gneise
aus dem Spessart bekannt,
Bildbreite 8 cm
|

Chalcedon aus dem Karneol-Dolomit-Horizont des
Buntsandsteins im Spessart. Das ist ein sehr unscheinbarer
Fund,
Bildbreite 6 cm
|

Ein ungewöhnlich großer, weißer Quarz von etwa 70 kg Gewicht
in der Überkornhalde der Kiesgrube, wo er auf eine
zukünftige Verwendung in einem Garten bereit liegt;
aufgenommen am 14.06.2020
|

Kieselig gebundenes Konglomerat mit runden Gneis-Geröllen
unbekannter Herkunft,
Bildbreite 6 cm
|

Problematikum: Ein von Quarz durchzogenes, rissiges Gestein
ohne dass man das aufgrund seiner Feinkörnigkeit ansprechen
könnte,
Bildbreite 7 cm
|
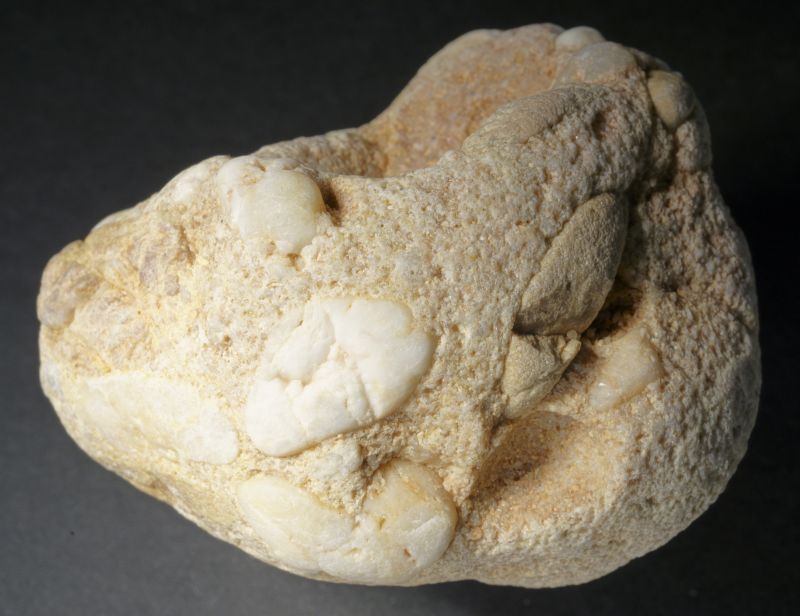
Sandstein-Konglomerat mit großen, weißen und gut gerundeten
Quarzen, wie man das aus dem Mittleren Buntsandstein
(Volpriehausen-Basissandstein),
Bildbreite 8 cm
|
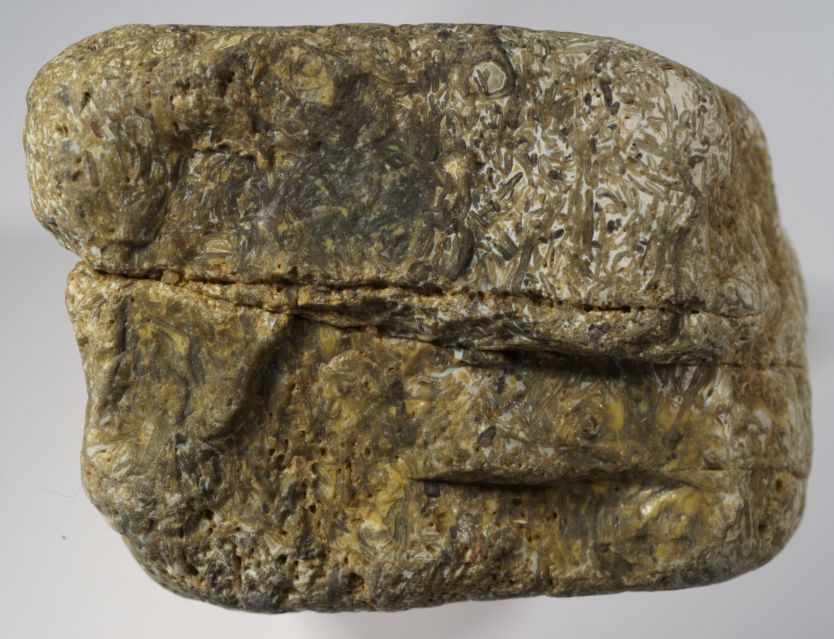
Hornstein als verkieselter Kalkstein mit den Resten von
vermutlich schalenbildenden Organismen,
Bildbreite 5 cm
|

Feuerstein aus den Kalkgebieten im Main-Einzugsgebiet mit
den typischen Schlagmarken und der weißlichen
"Verwitterungsrinde",
Bildbreite 6 cm
|
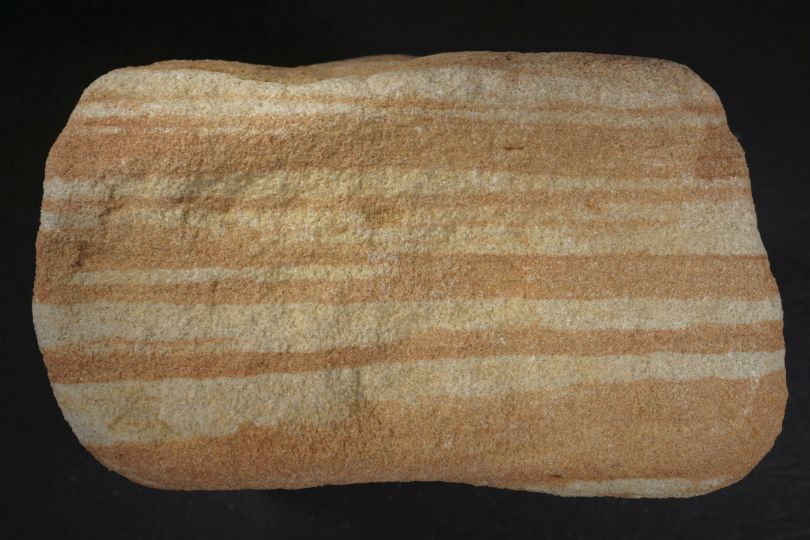
Typischer Sandstein, das häufigste Geröll in den Kiesgruben
am Untermain,
Bildbreite 9 cm
|

Ein zerbrochener Tonstein mit einem Riss, in dem etwas
Pflanzenmaterial für eine Entfäbung sorgte,
Bildbreite 8 cm
|

Stark gerundeter, flintähnlicher Hornstein mit zahlreichen
Schlagmarken in der Oberfläche,
Bildbreite 7 cm
|
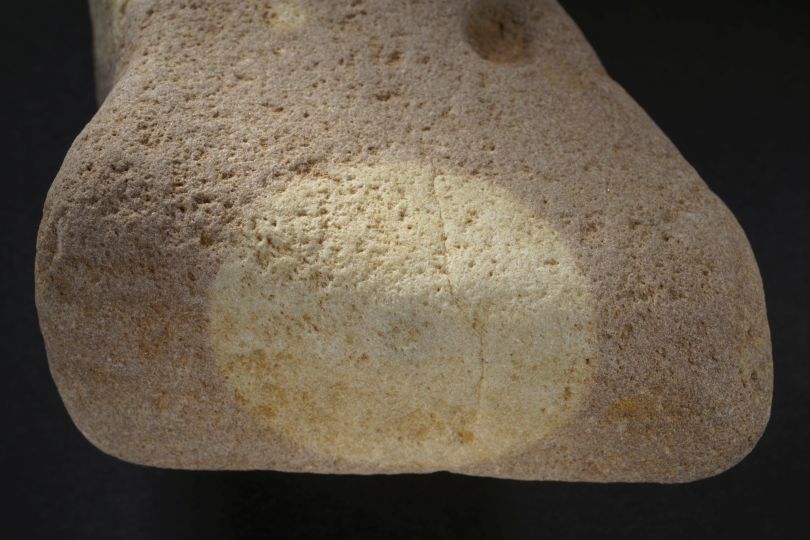
Kugelrunder, weißer Reduktionshof im Sandstein,
Bildbreite 9 cm
|

Schalig-glaskopfartiger Goethit verkittet und färbt Gerölle
aus der Kiesgrube Weber bei Großostheim. Und wie entsteht
das Loch im Kies? Nun, dort wo sich das Loch befand, war
eine Siderit-Konkretion; diese wurde gelöst und teils in
Goethit verwandelt, so dass der Hohlraum im Kies entstand -
siehe LORENZ (2022:94),
Bildbreite 10 cm
|

Sand. Bei einem leichten Regen spülte wenig Wasser den Sand
an den Böschungen ab und erzeugte Sandhaufen in der
Kiesgrube Akazienhof bei Babenhausen,
aufgenommen am 27.07.2021
|

Problematikum eines visuellen "Sandsteins"(?) mit einer
eigenartigen Bänderung. Dabei handelt es sich um ein
Prototaxites (LORENZ 2023:327ff). Gefunden im August 2021
bei Regenwetter,
Bildbreite 11 cm
|
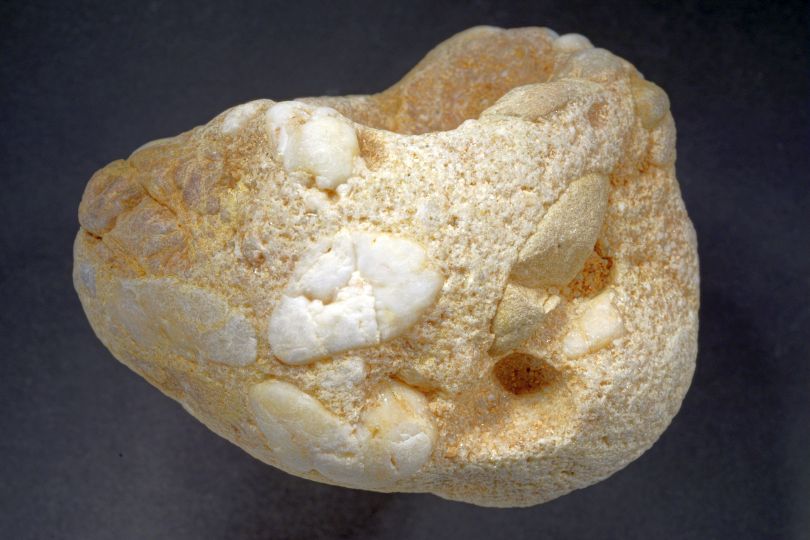
Konglomerat mit weißen, gut gerundeten Quarzgeröllen in
einer Sandmatrix,
Bildbreite 8,5 cm
|
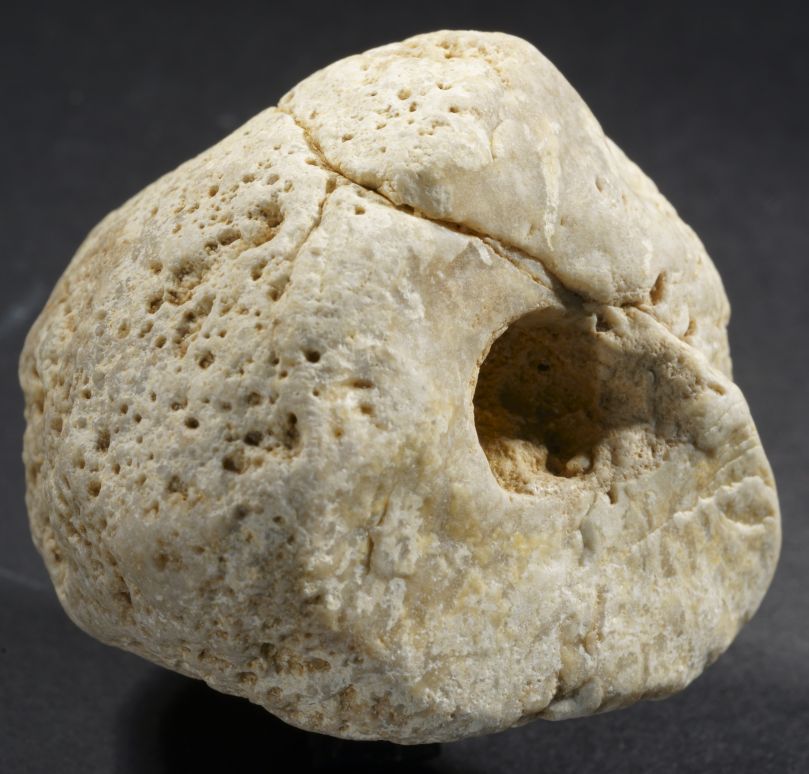
Verkieselte Koralle aus den Kalkgebieten Frankens. Diese
Hornsteine sind sehr beständig und auch zäh, so dass diese
in den Rheinschottern der Niederlande noch gefunden werden
können,
Bildbreite 7 cm
|
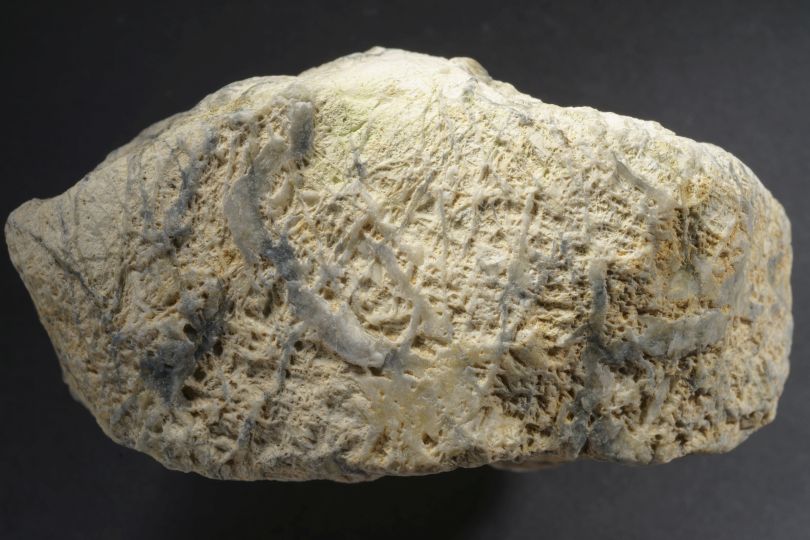
Extrem verwitterter Mylonit, der von vielen Rissen
durchzogen ist. Diese sind mit Chalcedon gefüllt und werden
aufgrund der Härte beim Transport im Kies herauspräpariert,
Bildbreite 9 cm
|
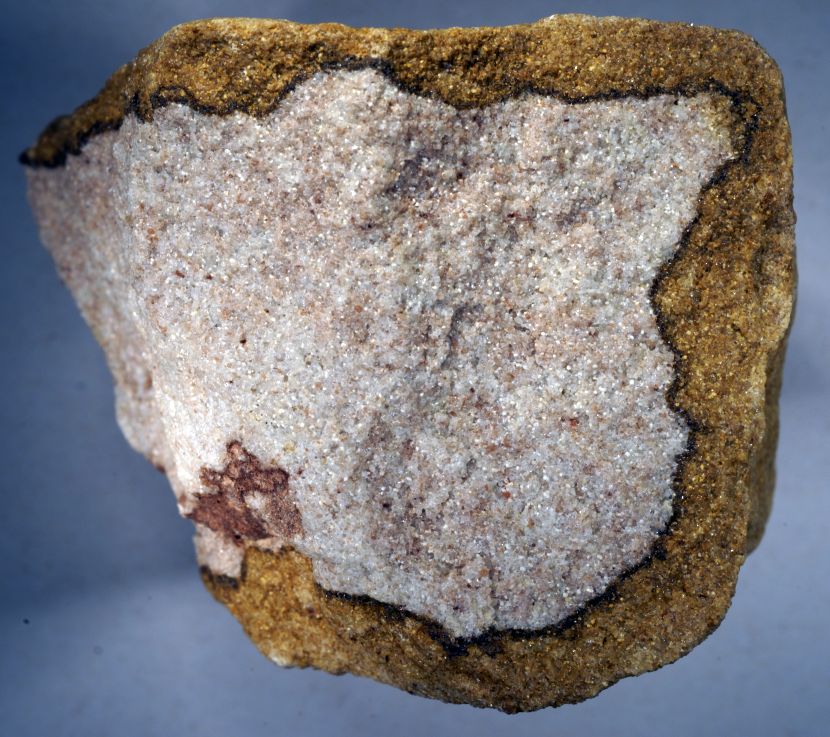
Heller Sandstein, von außen mit Eisenhydroxiden gefärbt,
Bildbreite 9 cm
|

Bruchstück eines Sandsteins mit dem Spurenfossil Skolithos.
Dabei handelt es sich um die Grabgänge von Lebewesen, die im
Sediment lebten,
Bildbreite 10 cm
|
cm.JPG)
Mit ringförmigen Eisenhydroxiden durchsetzter Sandstein als
scheibenförmiges Gerölle aus dem Mainschotter von
Großostheim,
Bildbreite 21 cm
|
cm.JPG)
Und noch ein Fund eines Sandstein-Gerölls mit dem
Spurenfossil Scolithos,
Bildbreite 6 cm
|

Kieselschiefer mit einer Verwerfung im Kleinmaßstab,
Bildbreite 6 cm
|

Sandstein mit einem Harnisch,
Bildbreite 7 cm
|

Kieselschieferbrekzie mit weißem Quarz,
Bildbreite 10 cm
|

Feinkörniger Quarz mit einem Quarzgang aus weißem Quarz,
Bildbreite 10 cm
|

Kieselkalk mit dem Rest einer Koralle, gefunden im Dezember
2022 in der Kiesgrube der Fa. Weber bei Großostheim.
Bildbreite 3,5 cm
|

Längliches Trachyt-Geröll aus dem Mainschotter - siehe auch
Detailfoto rechts,
Bildbreite 7,5 cm
|

Ausschnitt aus dem Foto links: Zersetzte Sanidin-Kristalle
in der von dunklen Bestandteilen durchsetzten Grundmasse;
Bildbreite 1,5 cm |

In den Schrägschichtungskörpern der Mainsande befinden sich
kryoturbate Würgestrukturen, etwa 2 m unter der Oberfläche.
Sande in der Kiesgrube der Fa. Schumann & Hardt,
Babenhausen,
aufgenommen am 27.02.2023
|
cm-2023.JPG)
Größeres, wenig abgerolltes Stück eines Pegmatits aus
Spessart oder Odenwald. Der Kalifeldspat ist
schriftgranitisch mit dem Quarz verwachsen. Dieser führt nur
wenig weiß verwitterter Plagioklas, dazu etwas Muskovit,
aber keinen Granat oder Turmalin;
Bildbreite 17 cm.
|

Rissiges Kieselschiefer-Geröll mit eisenreichen (roten)
Lagen und ohne die sonst so typischen weißen Adern aus
weißem Quarz. Quer zur Schichtung gesägt, geschliffen und
poliert,
Bildbreite 11 cm.
Das aus Quarz bestehende Gestein ist ungemein hart und nur
schwer zu bearbeiten.
|

Ein gut gerundeter Stein, weiß, schwer und ohne besondere
Merkmale. An der Oberfläche sind kleine Amphibol-Stängelchen
unter dem Mikroskop zu sehen. Erst der Anschlag mit dem
Hammer offenbart, dass es sich um ein basaltisches Gestein
handelt, welches an der Oberfläche weißlich verwittert ist
(Kaolinitisierung);
Bildbreite 15 cm
|
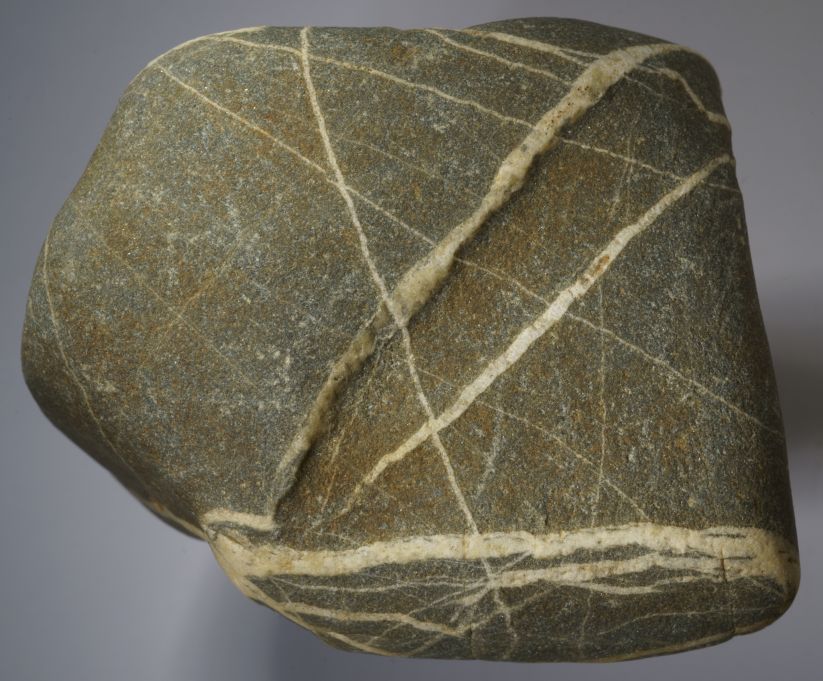
Geröll einer unscheinbaren Grauwacke (Gestein des Jahres
2023) mit den weißen Kluftfüllungen aus Quarz, die eine
Zeitstellung der Abfolge ermöglicht;
Bildbreite 7 cm
|

Konglomerat aus reichlich Kieselschiefer;
Bildbreite 7 cm
|
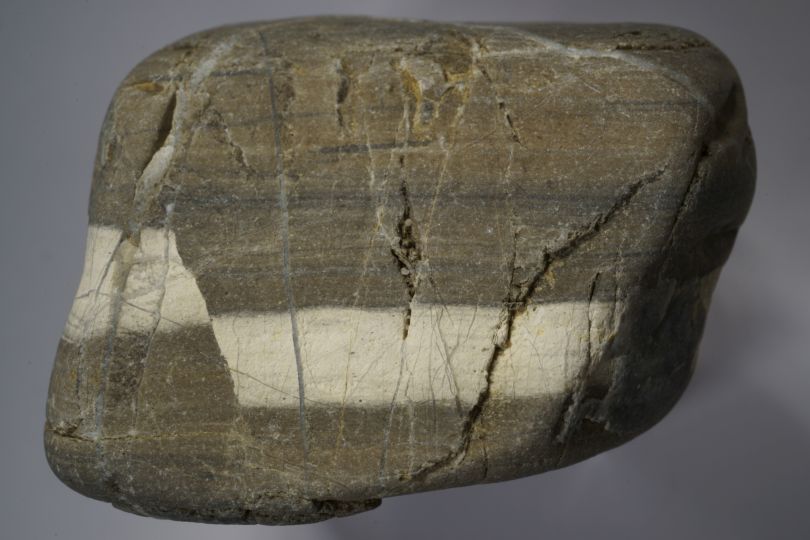
Graubrauner Quarzit mit einer weißen Lage, die um dessen
Dicke versetzt ist;
Bildbreite 5 cm
|

Steine suchen in Begleitung eines Kamerateams vom
Bayerischen Rundfunk aus Würzburg: Der 6jährige Elias
SCHRECK aus Karlstadt wird nach seinen Eindrücken gefragt,
nachdem er neben den üblichen Geröllen auch noch fossiles
Holz fand;
aufgenommen am 20.08.2023
|

Gneis-Geröll mit weißen, gewellten Quarzadern;
Bildbreite 6 cm
|

Dichter Hornstein mit vielen Schlagmarken;
Bildbreite 4,5 cm
|

Ovales Sandstein-Geröll mit einem Überzug aus Goethit, der
lackartig glänzt, aber an den höchsten Punkten ist der
Goethit abgeplatzt. Das Stück würde man bei unbekannter
Herkunft einer Wüste zusprechen;
Bildbreite 6 cm.
|

Ringförmiges Geröll einer rissigen Konkretion aus einem
feinkörnigen Kalkstein, durchzogen von weißen Adern aus
Calcit und Resten von fleckigem Eisenhydroxid. Gefunden in
der Kiesgrube der Fa. Weber in Großostheim;
Bildbreite 4,5 cm.
|

Weißer Quarz als Spaltenfüllung in einem glimmerhaltigen
Sandstein. Die schwarzen Punkte sind ein Manganoxid;
Bildbreite 8 cm.
|

Bruchstück eines braunen Siderits ("Toneisenstein" einer
Konkretion) mit den Resten einer Oxidationsrinde aus Goethit
- links an dem Stück im Foto;
Bildbreite 7 cm.
|

Schalige Goethit als Konkretion aus dem Sand mit noch Resten
des entfärbten Sands in schwach gebundener Form im Innern.
Gefunden in der Kiesgrube der Fa. Schumann & Hardt am
Akazienhof bei Babenhausen;
Bildbreite 6 cm.
|

Merkwürdiges, stark gefalteter, hellweißer Muskovit- und
Feldspat-führender Quarzit als längliches Geröll aus dem
Mainschotter von Großostheim. Die größeren Körnchen bestehen
aus einem Kalifeldspat;
Bildbreite 12 cm.
|

Quarzitisches Sediment mit weißen, parallelen Adern aus
Quarz, welches im anstehenden Gestein Quarz-Klüfte sind. Der
Quarz besteht aus senkrecht zur Kluft stehenden Kristallen;
Bildbreite 9 cm.
|
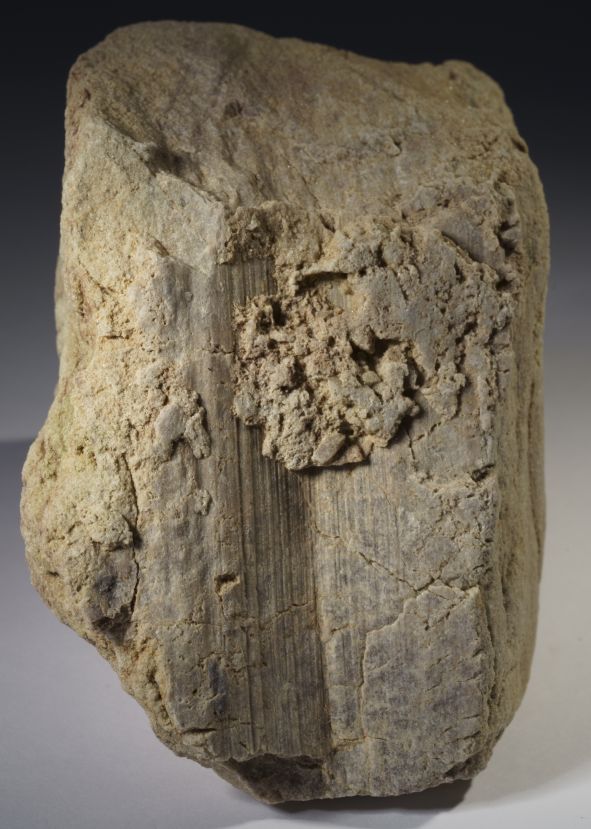
Harnisch mit einer typischen Streifung und Resten einer
verkieselten Reibungsbrekzie auf dem kieseligen Sandstein;
Bildbreite 7 cm.
|
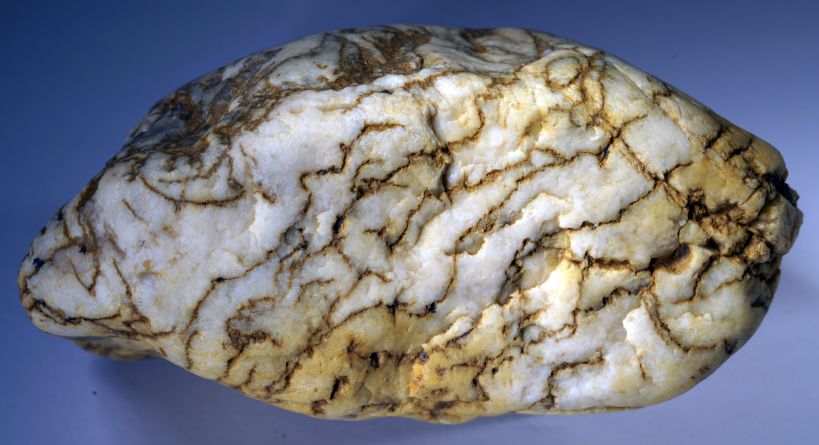
Gebändertes Quarz-Geröll mit Suturen, nachgezeichnet von
braunem Eisenhydroxid aus dem Sediment. Die Herkunft des
weißen Gesteins ist unbekannt;
Bildbreite 8 cm.
|

Heller, feinkörnig-kieselig gebundener Sandstein mit
Belastungsmarken, möglicherweise ausgelöst im noch
unverfestigten Sand durch ein früheres Erdbeben;
Bildbreite 17 cm.
|

Für die 2026er Ausstellung in Messel schaufeln Mitarbeiter
aus Messel Kies in einen Anhänger. Dazu wurden Fotos der
kaltzeitlichen Sedimente in den Kieswänden erstellt. Ein
Team des Hessischen Rundfunks begleitet die Vorarbeiten und
der Beitrag wird im Januar 2026 gesendet;
aufgenommen am 17.11.2025
|

Goethit einer plattigen Konkretion mit Schrumpfrissen, in
denen auch Lepidokrokit und Reste des Siderits finden sind;
Bildbreite 2 cm.
|

Gebänderter Hornstein mit Schlagzwirbeln;
Bildbreite 5,5 cm
|
|
Tag der offenen Tür 2025



Der Tag der offenen Tür am 24.08.2025 war geprägt von einem blauen
Himmel mit weißen Wolken. Es kamen sehr viele Besucher und manche
warteten lange geduldig, bis sie eines der Bagger oder Dumper
fahren und bedienen durften. Und Kinder hatten Spaß, denn sie
durften nach Herzenlust im Sand spielen und rutschen. Man ließ die
Anlage vom Schwimmbagger bis zur Aufbereitung laufen und es wurde
in Kleingruppen Führungen angeboten, in denen erklärt wurde, wie
der Sand und Kies aufbereitet wird. In der Fahrzeughalle konnte
ein Infofilm angeschaut werden, dazu wurde Musik, Speisen und
Getränke angeboten.
Es gab auch einen Stand für die Geologie mit den typischen
Geröllen aus dem Kies, dazu fossiles Holz und Knochen bzw. Zähne
vom Mammut, welches vor ungefähr 30.000 Jahren im Maintal lebte.
Im Hintergrund konnte man die Sedimente des Mains erkennen, darin
auch Erosionsdikordanzen und tiefe Rinnen eines natürlichen, stark
mäandrierenden Flusssystems in der letzten Kaltzeit. Dazu gab es
noch ein Poster über Radiolarit bzw. Kieselschiefer als Leitgeröll
des Mains, dazu auch ein etwa 15 kg schweres Stück.
Niedernberg 2023



Am Sonntag, den 30.04.2023 wurde der Kulturweg "Blechkatzen im
Honischland" in Niedernberg mit mehr als 200 Besuchern eröffnet.
Bei blauem Himmel und Sonnen-
schein gab es auf dem 10 km langen Weg Erläuterungen zu den neu
aufgestellten Tafeln. Für die, die bis zum Ende durchgehalten
haben, gab es am Badesee Belegstücke
des Leitgerölls in den jungen Mainsedimenten mit Erläuterungen zur
Calcium-Kompensations-Tiefe, den Kieselschiefer (auch bekannt als
Radiolarit oder Lydit). Dazu gab
es einen Infozettel, auf dem die Entstehung, Alter und Herkunft
vermerkt ist.
Erlebnistag 2013



Am leider wettermäßig nicht sehr schönen Sonntag, den 25.08.2013
wurde von Fa. Weber in Großostheim ein Erlebnistag veranstaltet.
Mehrere hundert Besucher kamen in die Kiesgrube. Den größten
Zuspruch hatten die technischen Geräte, wo Vater und Sohn nach
Wunsch Baggern oder Dumper fahren konnte (mancher Vater schien
mehr begeistert zu sein als die Kinder). In einem eigenen Bereioch
wurden die Produkte vorgestellt.
Joachim LORENZ hatte die Geologie zum Anfassen dabei: Neben den
Geröllen aus Quarz, Basalt, Kalk, Horstein, Flint auch
versteinertes Holz. Als Besonderheit gab es das Schulterblatt, den
ein Stück eines Unterschenkels und einen großen Backenzahn eines
Wollhaar-Mammuts zum Anfassen. Trotz des Regens kamen die Besucher
begeistert und wurden auch über Schwimmbagger, die Aufbereitung
und die Biologie durch den LBV informiert. Am Wasser konnte man
Edelsteine waschen, so dass für Kinder auch gesorgt war. Ein
kleines Kino und der Bereich zum Essen und Trinken rundeten die
Veranstaltung ab.
Kiesgrube der Fa. Weber, Bürgstadt
Die Fa. Weber fördert im Bereich von Bürgstadt ehemalige Mainsande
und darin eingeschuppte Sande aus den Seitentälern bzw. der Hänge
der Sandsteinberge der Umgebung. Sie haben eine völlig andere
Zusammensetzung der Gerölle wie die Mainschotter am Untermain.

Zu den Sanden aus dem Main wird auch der Buntsandstein aus dem
Steinbruch Kirschfurt zur Schotter und zu einem scharfen Sand mit
roter
Farbe gebrochen (links im Bild).
aufgenommen am 18.08.2012

In dem Baggergut aus dem Main sind Schalen von Mollusken (viele
Muschelschalen und wenige Schneckengehäuse) enthalten. Durch die
Aufkonzentration am Fuß der Halden können diese Schalen das Kies
fast völlig bedecken. Diese Schalen sind bei der Verarbeitung zu
einem qualitativen hochwertigen Kies bzw. Sand ein Problem und man
entfernt diese Schalen soweit es technisch mit einem vertretbaren
Aufwand möglich ist.
aufgenommen am 18.08.2012
Zu dem Betrieb gehört noch eine Recycling-Anlage für Bauschutt
und eine Asphalt-Mischanlage (Main-Tauber-Asphalt) und weitere
Firmen auf dem weitläufigen Betriebsgelände.

Schilf im Gegenlicht der Wintersonne
aufgenommen am 15.12.2007
Kiesgruben sind auch biologisch sehr schnelllebige Orte; die
Sukzession der Pflanzen führt in wenigen Jahren zur Verlandung von
(flachen) Seen (Wasserlinsen, Schilf, Erlen ...) und dem völligen
Zuwachsen bis zum Wald (Klimax in der
Region). Wenn Bodendecker den Boden begrünt haben, folgen
Brombeeren und dann in deren Schutz Birken. Dies dauert nur wenige
Jahre. In deren Schatten folgen dann weitere Baumarten. So ist
nach ca. 50 Jahren von einer Kiesgrube nichts mehr zu sehen.
Kieselsteine oder Gerölle ("Mainkiesel) sammeln


Bildbreite 5 cm, je Vorder- und Rückseite (Sammlung Nr. 9040)
Der Anfang einer Leidenschaft:
Das ist der Stein mit dem im Frühjahr 1969 mein Interesse an den
Steinen geweckt wurde.
Der ca. 3 cm große, aus Hornstein bestehende Kieselschwamm, fand
ich beim Spielen in einer Baugrube an der Birkenstraße zur
Errichtung eines Wohnhauses in der Nachbarschaft. Durch die
Struktur erinnert das Stück wegen des "Stielansatzes" an einen
"vertrockneten Pfirsich". Die Neugier war geweckt, auch wenn
niemand aus meinem Umfeld sagen konnte, was das ist. Nun, da
halfen auch die ersten Bücher nicht und auch die Lehrer in der
Schule. Und auch keiner meiner Verwandten oder Freunde meiner
Eltern.
Dass es kein "Pfirsich" sein kann, dachte ich mir bereits. Aber
richtig deuten konnte ich das Stück erst viele Jahre später, als
ein Paläontologe das Stück sah und ich die wahre Natur als
fossiler Kieselschwamm erklärt bekam. Aber fortan suchte ich wegen
der Nähe zu den Kiesgruben nach den Mineralien und Gesteinen der
Mainschotter. Nun förderte mein Vater das Interesse, gab mir ein
Buch und das Ergebnis waren Besuche in Idar-Oberstein, in den
Jura-Kalken bei Pottenstein, in der damals noch im Abbau stehenden
Sulfid-Grube "Bayerland" bei Waldsassen im Fichtelgebirge
und ein Urlaub im Alpen-Kristallin im Rauris in Österreich. Aber
ich erkannte schnell, dass eine Beschränkung auf den heimatlichen
Spessart die bessere Wahl sein wird.

Auch ein Stück eines Kieselschwamms,
gefunden am 11.06.2011
in der Kiesgrube der Fa. Volz und Herbert, Hörstein,
Bildbreite 10 cm.
Zurück zur
Homepage oder an den Anfang der Seite








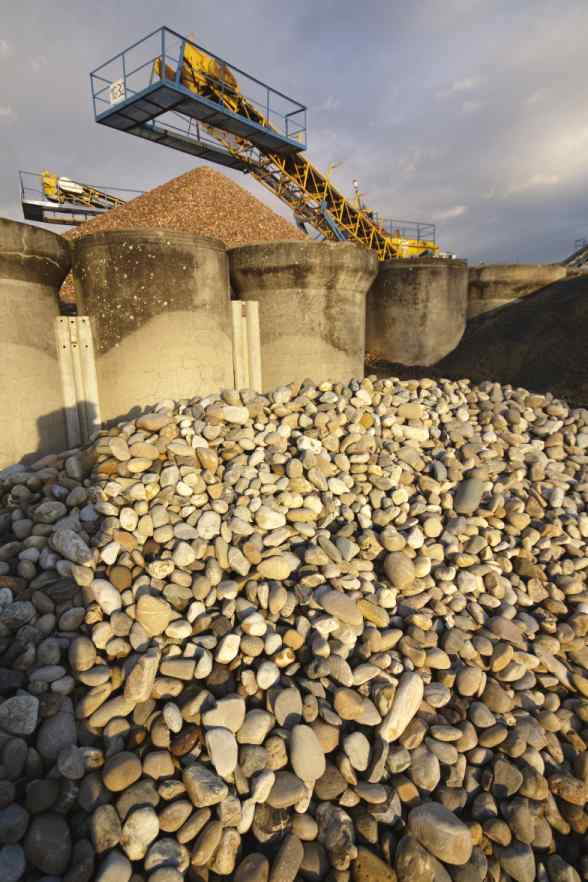
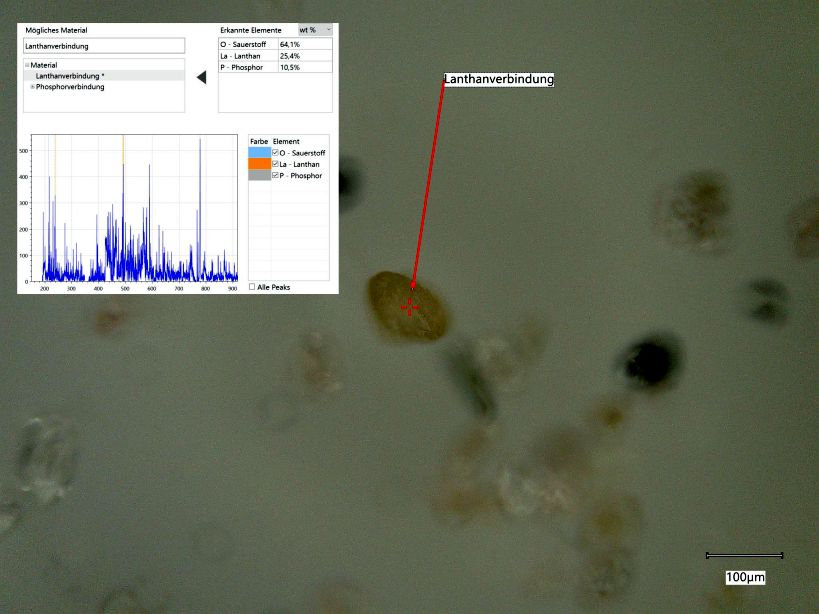






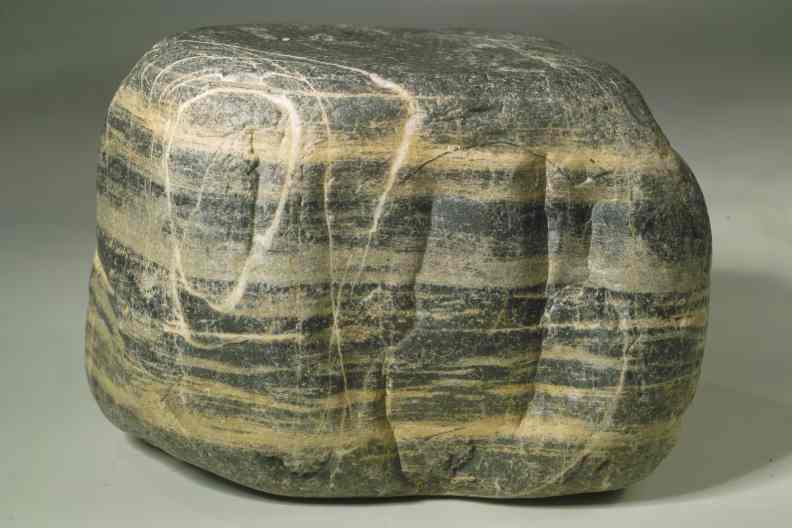


 Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit
einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am
Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,
Bildbreite 6 cm,
Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit
einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am
Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,
Bildbreite 6 cm,