im Spessart und seine Mineralien
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Gebänderter Chalcedon (Achat) auf
Dolomit, gefunden 1977,
Bildbreite 5 mm
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Gebänderter Chalcedon (Achat) auf
Dolomit, gefunden 1977,
Bildbreite 5 mm
Am Rande des kristallinen Spessarts um Alzenau i. Ufr. treten
nördlich davon die Sedimente des Zechsteins, umgeben von denen des
Rotliegenden, als ungebankte Dolomite zu Tage. Sie wurden früher
als Rohstoff zur Kalkherstellung abgebaut und beim lokalen
Kalkbrennen genutzt.
Im Zuge von Baumaßnahmen wurden Aufschlüsse geschaffen. Dabei
konnten einige interessante, farbige Mineralien, wie Quarz, Chalcedon
(auch als Achat), Baryt, Azurit
und Malachit, gefunden werden, die auch
in der älteren Literatur des vorigen Jahrhunderts schon einmal
beschrieben wurden. Zusätzlich konnten weitere Mineralien bestimmt
werden.
Der grösste Teil der Funde befindet sich im seit 2006 wieder
eröffneten Museum der Stadt Alzenau in
Michelbach und die schönsten sind dort ausgestellt.
| Azurit | Chrysokoll | Malachit |
| Baryt | Dolomit | Manganomelan |
| Calcit | Goethit | Quarz |
| Chalcedon | Illit |
Kalkige bis dolomitische Sedimente stehen wenige hundert Meter
nördlich der Stadt Alzenau in Unterfranken an. Hier wurde schon
seit langem Dolomit abgebaut und daraus
"Kalk" gebrannt. Dies belegen die Reste von kleinen Schürfen, die
bis Mitte der 70er Jahre erkennbar waren.
Bei zwei Baumaßnahmen wurden nördlich des Rothen-Berges bei
Alzenau größere Mengen des Zechstein-Dolomits weiter
aufgeschlossen:
a. Bau der Umgehungsstraße von der BAB 45 Aschaffenburg-Gießen, Anschlussstelle Alzenau bis nach Michelbach in den Jahren 1976 - 77 (GK 1:25.000, Blatt 5920 Alzenau in Ufr. R 350578 H 555135), nur wenig nördlich der unten genannten Reithalle.
b. Bau einer großen, später noch erweiterten Reithalle zw. Alzenau und Michelbach ca. 1977 (GK 1:25.000, Blatt 5920 Alzenau R 350578 H 555128).
Beide Aufschlüsse sowie das Gestein selbst sind infolge der
schnellen Verwitterung als auch der Begrünung bzw. der Bebauung
heute nicht mehr zugängig. Hier kann man nur auf zukünftige
Baumaßnahmen hoffen, dass die Gesteine nochmals angeschnitten
werden.
Die Fundstelle war bereits im 19. Jahrhundert bekannt. Stücke von
hier gelangten sogar in die berühmte Sammlung des Erzherzogs
Stephan Victor von Österreich (*1817 †1867),
die später von dem Industriellen Carl H. C. L. RUMPFF (*1839 †1889; er war Teilhaber an der chemischen
Fabrik von Bayer in Leverkusen) gekauft und gemehrt wurde. Diese
ca. 14.000 Stücke umfassende Sammlung gelangte durch eine
Schenkung an das Museum für Naturkunde in Berlin, wo ein Großteil
der Sammlung heute noch verwaltet wird:
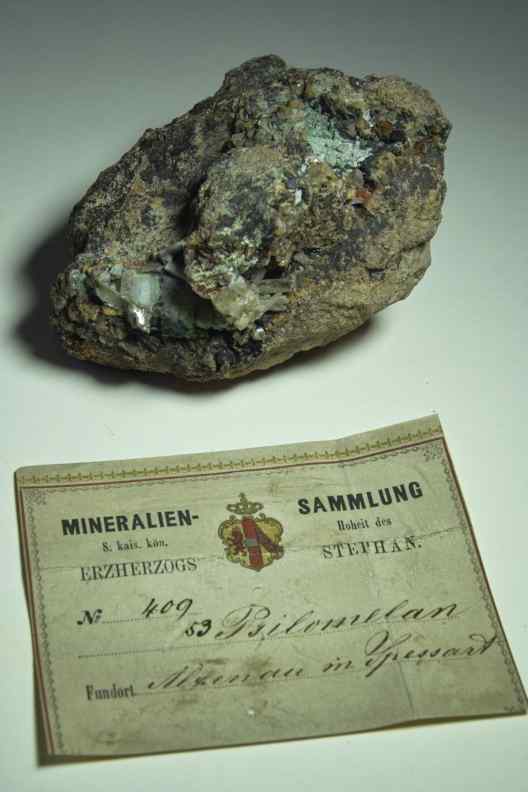

"Psilomelan" auf Baryt und darüber weißer Chalcedon auf dem
Zechstein-Dolomit aus Alzenau mit einem randlich
beschnittenen Zettel der Sammlung Carl RUMPFF (*1839 †1889),
Museum für Naturkunde in Berlin, Sammlung
Nr. 2006-10274;
aufgenommen am 15.02.2013
Im Stadtgebiet von Alzenau finden sich als kristallines
Grundgebirge die dunklen, metamorphen Gesteine der Alzenauer
Formation. Sie bestehen aus Amphiboliten, Kalksilikatgesteinen,
Graphitquarziten und Hornblendegneisen. Man deutet sie heute als
die wechselnde Abfolge während des Kambriums untermeerisch
geförderten Basalten, Mergeln und Kieselschiefer, die bei der
späteren Gebirgsbildung im Karbon Temperaturen von ca 630° C und
einem Druck von 5.000 bar ausgesetzt waren.
Mit Ende des Karbons (ca. 285 Ma war die Landoberfläche des
variskischen Gebirges weitgehend eingeebnet. Es bestand aufgrund
der Härteunterschiede der Spessartgesteine ein kleinräumig
gegliedertes Abtragungsrelief mit einer Schüttrichtung zur
Wetterau hin. Die Rotliegend-Sedimente des Alzenauer Raumes
enthalten neben den typischen Spessart-Geröllen auch Stücke aus
dem Taunus.
Mit Beginn des Zechsteins (ca. 235 Ma) wurde unser Gebiet von
einem flachen Meer bedeckt, welches von Norden her transgredierte.
Diese carbonatischen Ablagerungen werden hier beschrieben. Das
stark differenzierte Relief des Spessarts bildete mit ihrer
lagunären Landschaft die Basis für die Ausfällung der
unterschiedlichen Fazies dieser eintönigen Sedimente (wie z. B.
Normal-, Schwellen-, Sapropel- und Algendolomite,
sulfatisch-karbonatische Mischgesteine), die die unterschiedlichen
Bereiche der Lagunen und ihrer verschiedenen Wassertiefen,
Salzgehalte usw. repräsentieren.
Wie mächtig die Folge des Zechsteins in Alzenau abgelagert wurde, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Sicher wurde der auch hier der heute abgetragene Bröckelschiefer sedimentiert, sowie auch die bekannten Ablagerungen des Buntsandsteines, da sie beide aus dem Vulkanit von der Strütt bei Mainaschaff bzw. dessen Schlotbrekzie belegt sind.
In weiten Teilen am Rothenberg westlich von Alzenau gibt es (wie
bei Hörstein, Dettingen und Kleinostheim) nahezu völlig verkieselte Zechstein-Dolomite. Es
handelt sich in Alzenau meist um gut gerundete Steine (Blöcke),
oft mit gut erkennbarem Windschliff und einer sehr typischen,
narbigen Oberfläche:

Zechstein-Sedimente als wechselhafte, carbonatische Gesteine
(Schwellenkarbonate, Z1 (Werra-Serie)) wie Mg-haltige Kalke bis
hin zu einem Dolomit treten, oft auch
verkieselt, nördlich bis nordöstlich der Stadt Alzenau auf. Sie
werden von den schlecht aufgeschlossenen, schwach gefestigten,
konglomeratischen Sedimenten des Rotliegenden begleitet. In ihnen
finden sich auch Gerölle des Rhyolithes von Sailauf, welches eine
frühere Entwässerungsrichtung des Gebietes das heute den Spessart
darstellt, belegt.
Die carbonatischen Gesteine sind am Spessartrand wie auch in
Alzenau teilweise völlig verkieselt und treten hier als rundlich
freigelegte Blöcke zu Tage. Sie wurden im Pleistozän wohl durch
die überdeckenden Sande teils zu Windkantern geschliffen, wie
Lesesteinbefunde in der Umgebung des Fundortes dokumentieren. Die
quarzitischen Gesteine sind dann sehr verwitterungsresistent,
werden freigelegt, können deshalb leicht gefunden und auch
kartiert werden.

Die Baustelle der Umgehungsstraße zwischen Michelbach und Kahl in
Höhe von Alzenau.
Hier waren die Sediemente des Rotliegenden und des Zechsteins
aufgeschlossen. Der
Aufschluss des Baryt-Ganges liegt weiter hinten. Der weiße Opel
Kadett C Caravan mit
dem Kennzeichen ALZ P 738 war das Auto meines Vaters. Die wahre
Bedeutung des
Aufschlusses hatte ich seinerzeit nicht erkannt,
aufgenommen im Juli 1977.
Das Foto wurde 1997 veröffentlicht und dann war das Dia beim
Schriftleiter des
Naturwissenschaftlichen Vereins verschollen. Deshalb wurde das
Foto in dem Buch
"Spessartsteine" nicht abgedruckt. Bei Umräumarbeiten am
30.03.2018 wurden die
Fotos mit anderen wieder gefunden.
Beim Bau der Umgehungsstraße ergab sich im Bereich der heutigen
Straße folgendes Bild: Schwer zu klassifizierende,
konglomeratische Sedimente des Rotliegenden, vorwiegend aus
gerundeten Quarzen und verschiedenen Gneisen, bilden das Liegende.
Das Grundgebirge wurde nicht aufgeschlossen. Dolomitische
Zechstein-Sedimente als drusenreiche, schlecht bis sehr gut
gebankte Gesteine von ca. 7 m Mächtigkeit bilden hier bei Alzenau
das Hangende. Die barytarmen Dolomite ließen sich Richtung
Michelbach über ca. 50 m verfolgen. Paläokarsterscheinungen, sonst
in den Dolomiten des Vorspessart verbreitet, wurden hier nicht
beobachtet.
Eine Verwerfung, begrenzt durch einen fast senkrecht einfallenden,
NO-SW streichenden Baryt-Gang, trennte den Dolomit vom
Rotliegenden. Der vorwiegend schmutzig weiß erscheinende Baryt-Gang erreichte eine Mächtigkeit von bis
zu 2 m; auf der Nordseite waren die Hohlräume recht zahlreich. Der
umgebende Dolomit war auf weiteren 20 m in östlicher Richtung von
zahllosen Baryt-Nestern durchzogen. Das Ganze wurde nach oben hin
durch die pleistozänen Flugsandfelder und Lössüberdeckungen
verhüllt.
Die Sedimente des Zechsteins sind im Spessart an vielen Stellen
aufgeschlossen, überlagern das Grundgebirge und werden ihrerseits
vom Buntsandstein verdeckt. Sie tauchen flach nach Osten ab und
können dort nur noch durch Bohrungen nachgewiesen werden.
Es sind die Ablagerungen des Zechstein-Meeres, eines sehr flachen
Meeres, welches sich nach dem Abtragen des variskischen Gebirges
von Norden hierher ausbreitete. Die liegenden Schichten, der
Kupferletten genannt, sind dünn und oft sehr reich an Mineralien,
die die Metalle Kupfer, Blei, Zink und seltener Silber enthalten.
Die Kupferletten waren eine der Grundlagen des früheren Bergbaues
auf diese Bunt-, Schwer- und Edelmetalle im Spessart (z. B.
Huckelheim, Bieber oder Großkahl). Später brachten hydrothermale
Lösungen reichlich Barium als weißen, spätigen, auffallend
schweren Baryt. Die im Gestein zirkulierenden Wässer haben einen
Teil der Metalle aus den Kupferletten gelöst und an anderer
Stelle, meist oberhalb des Kupferlettens wieder ausgeschieden.
Diese sind als Anzeiger der Metallgehalte oft intensiv blau oder
grün und fallen deshalb leicht auf.
Die Dolomite enthalten als Flachwasserbildung, keine oder nur sehr
wenige, meist sehr schlecht erhaltene Fossilien.
Die zahlreichen, unförmigen, z. T. auch großen Hohlräume die sich
dem heutigen Betrachter als Drusen darstellen, entstanden, als die
Umwandlung zum Dolomit einsetzte
(Austausch des Ca durch Mg); dies ist mit einer beachtlichen
Volumenreduktion verbunden. Sie sind oft mit einem Rasen aus
Dolomit-Kristallen ausgekleidet. Der Dolomit ist im Gegensatz zu
dem Kalk viel weniger in Wasser löslich, weshalb es hier im
Spessart keine Kluftsysteme gibt, die zu begehbaren Höhlen
erweitert wurden.
Eine andere Deutung sieht die Hohlräume als Lösungskavernen, die
früher mit Sulfaten wie z. B. Gips, gefüllt waren.
Kalkbrennen war früher eine weit verbreitete Tätigkeit, die im
Kleingewerbe an fast allen Zechstein-Dolomit-Vorkommen ausgeführt
wurde. So gab es noch in diesem Jahrhundert zahlreiche Kalköfen im
Vorspessart und es sind zahlreiche Überreste von Kalköfen
aufgefunden worden. Diese Öfen wurden mit Holz befeuert. Neben
Kalke zu Bauzwecken wurde auch schon Düngekalk erzeugt.
Erste Berichte darüber finden sich - wenn auch Alzenau, damals 500
Einwohner mit 112 Häusern, nicht wörtlich genannt wird - bei
BEHLEN (1823, Bd. 1, S. 57). Er beschreibt erstmals den
geologischen Aufbau. Ausführlich werden auch die damals noch
bergbaulich genutzten Zechstein-Dolomite beschrieben. Zur Nutzung
des Gesteins führt er aus:
"Diese Gebirgsart ist es, welche in technischer und ökonomischer Hinsicht für diese Gegend des Spessarts von bedeutendem Nutzen wird, indem viele mit Ziegelhütten verbundene Kalköfen daran gutes Baumaterial und ein treffliches Düngungsmittel bereiten. Der daraus gebrannte Kalk hat durchaus eine rein aschgraue Farbe, und zerfällt, besonders von den weichen Abänderungen, gleich in der Luft, zum Theil selbst schon im Ofen, zu einem aschähnlichen Mehl."
Auch in Alzenau gab es Kalkbrennereien mit Kalköfen. H. BÜCKING (1892:158) erwähnt Steinbrüche wo der Dolomit in bis zu 5 m Mächtigkeit aufgeschlossen ist. Mündlich überliefert sind eine Kalkbrennerei bei der ehemaligen Gastwirtschaft "Funke-Keller" bzw. auf dem Gelände des Baugeschäftes Peter Kresslein (Hanauer Str. 89). Die zweite fand sich unweit der heutigen Reithalle zwischen Alzenau und Michelbach, nicht weit von der Fundstelle der hier beschriebenen Mineralien. Weiter gibt es in den Akten des Alzenauer Stadtarchivs mehrere Gewerbeanmeldungen über Kalkbrennereien (19.2.1879 Sebastian Ludorf Ziegel- und Kalkbrennerei, desgleichen 1.7.1885 Sebastian Funk und 11.10.1887 Adolf Ludorf für eine Feldbrennerei).
Der Kalk bzw. Dolomit wurde in Stücke gebrochen und in einfachen
Schachtöfen mit Holz, später wohl auch mit Kohle gebrannt,
gelöscht und dann zu den bekannten Bauzwecken verwendet. Auch als
Düngekalk für die mageren Böden des Vorspessarts fand das Material
Verwendung.
Dabei wird das hier verwendete Gestein als eine Verwachsung aus
wechselnden Anteilen Ca- und Mg-Carbonat auf über 900 - 1.000°C
erhitzt und in CaO bzw. MgO überführt, wobei CO2 frei
wird. Die entstehenden Klinker werden zu einer pulvrigen Masse
gemahlen und abgesackt. Zur weiteren Verwendung wird in Wannen
Wasser zugesetzt, welches sich unter einer enormen
Wärmeentwicklung zu Ca- bzw. Mg(OH)2 verbindet. Der
dann gelöschte Kalk eignet sich als Grundlage für Farben, Putze,
Mörtel zum Mauern und für Dünger. Die Aushärtung erfolgt über die
Aufnahme von CO2 aus der Luft, wobei sich wieder
Ca-Carbonat bildet, welches die einzelnen Mörtelteilchen dauerhaft
verbindet.
Die aus hiesigen, etwas manganhaltigen Gesteinen gewonnenen
Brannt- oder Schwarzkalke (!) sind aufgrund des Mn-Gehaltes sehr
dunkel, so dass eine Verwendung für Anstriche entfällt.
1936 existierten wohl so gut wie keine Erinnerungen an den damals
schon weit zurückliegenden Abbau, denn in dem umfangreichen Werk
"Die nutzbaren Mineralien, Gesteine und Erden Bayerns" wird nur
das Vorkommen von Dolomit erwähnt:
"O. von Alzenau (5 m mächtiger, verkieselter Dolomit; hartes,
wackiges, graues, löcheriges Gestein, brauneisenreich und
Schwerspat führend);"
Die Beschreibung trifft recht gut die an der Oberfläche sichtbaren
und freigewitterten Gesteinsstücke.
Von den ehemals so zahlreichen Kalkbrennereien im Spessart
existiert heute nur noch die Fa. Hufgard in
Rottenberg, die gleiches Material wie in Alzenau in Steinbrüchen
der Umgebung bricht und in einem weithin sichtbaren Betrieb zu
Branntkalk verarbeitet. Das Kalkbrennen wird dort 2023
eingestellt.
Folgende Mineralien konnten in den Sedimenten des Zechsteins
nachgewiesen werden:
Quarz SiO2
Der sonst in der Natur so weit verbreitete, in Dolomiten wohl eher
seltene Quarz findet sich in zwei sehr leicht unterscheidbaren
Modifikationen:
a. Kristalliner Quarz in Form von sichtbaren idiomorphen Kristallen.


Farblose Rasen aus kleinen Quarzkristallen auf Chalcedon (Achat),
Bildbreiten links ca. 7 cm, rechts 3 cm
Im Dolomit fanden sich Drusen von bis zu 20 cm Durchmesser, die
völlig mit einem dünnen Rasen aus bis zu 0,5 mm großen, meist
farblosen Quarzkristallen überzogen waren. Die Kristalle zeigen
kaum ein Prisma und in der Regel nur die Pyramide, deren Flächen
stark glänzend sind. Die Flächen zeigen kleine Strukturen, die
Vizinalflächen gedeutet werden können. Die dunklen Farben
entstehen in der Regel durch den braunen Untergrund. Oft
überziehen die Kristallrasen als abhebbarer, nur dünner Belag die
rhomboederförmigen Dolomit- oder tafelige
Baryt-Kristalle oder überkrusten meist nicht
mehr vorhandenen Manganomelan. In einigen Fällen sind die
Kristallüberzüge grün, wohl durch darunterliegenden Malachit. Die bläulichen Farben entstehen
durch den darunterliegenden Chalcedon.
In wenigen Fällen überzieht eine weiße bis bräunliche Schicht aus
Chalcedon den Quarz.
Kleinere Drusenfüllungen des Dolomits sind sehr häufig mit
winzigen, weißen Quarz-Kristallen, oft über
einer mm-dicken Schicht aus weißem bis leicht hellgrünem
Chalcedon, ausgekleidet. Der Untergrund aus Dolomit-Kristallen
fehlt hier.
In Teilen des Dolomits sind bis in den mm-Bereich alle Hohlräume
mit einer dünnen Schicht aus völlig farblosen Quarzkristallen
ausgekleidet.
Schmale, nur mm-mächtige Risse und Klüfte im Dolomit können
ebenfalls mit weißem Chalcedon, etwas schwarzem Manganomelan und
dann mit farblosem Quarz, dessen Kristalle sich in der Mitte
berühren, ausgefüllt sein.
b. Als feinstkristalliner Chalcedon, in gebänderter Form auch als
Achat benamt:
Chalcedon ist sehr verbreitet als mm-dicker, lagiger Belag in den
bis zu faustgroßen Drusen zu finden. Die Farbe schwankt von weiß
über grün bis hin zu einem zarten blau ("aquamarin"). Färbender
Bestandteil ist sehr wahrscheinlich Malachit
mit wechselnden Anteilen von Azurit . Der
Chalcedon wird fast immer von kristallinem Quarz überzogen oder
ist davon unterlagert; mehrfache Wechsel wurden auch gefunden. Der
bis zu 5 mm dick werdende Chalcedon wird meist durch eine dünne
Schicht aus einem schwarzen Manganomelan
oder von faserigem, grünen Malachit von den darunterliegenden
Mineralien Dolomit oder Baryt getrennt. Eine Fluoreszenz des
Chalcedons bei Bestrahlung mit UV-Licht tritt nicht auf.
Da ein lagiger, verschiedenfarbiger Aufbau in den nur mm-dicken
Lagen des dann meist grauen Chalcedons vorliegt, kann man von
einem Achat mit gemeiner Bänderung sprechen. Die Färbung variiert
in der Regel von einem hellen grau bis zu schneeweiß.

Achat als mm-dicker Überzug in einer Druse im Dolomit, überkrustet
von farblosen Quarz-Kristallen,
Bildbreite 3 cm
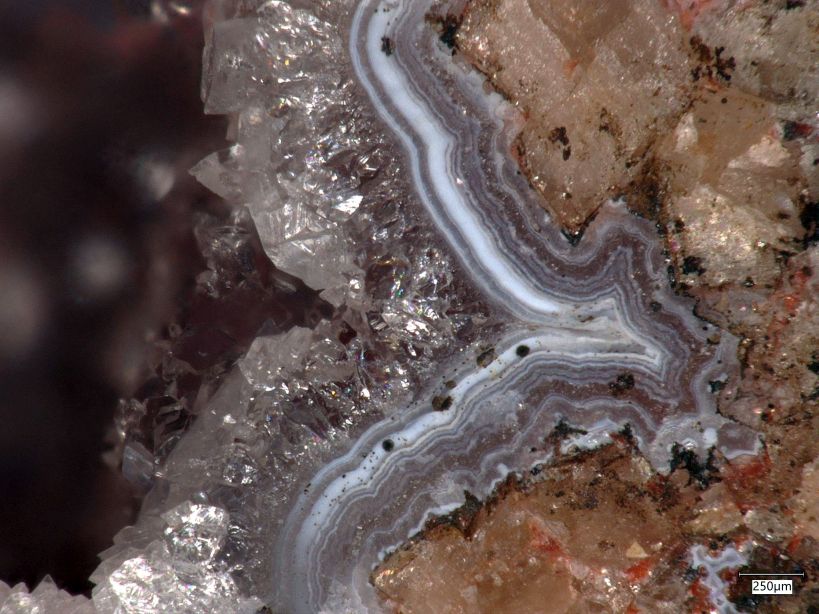
Entgegen der durch andere Personen vorgenommenen, visuellen
Bestimmungen, konnte ohne Mikroskop Chrysokoll
beobachtet werden. Die als "Chrysokoll" bestimmten, massiven
Stücke wurden röntgendiffraktometrisch einwandfrei als Quarz
bestimmt.
Goethit
FeOOH
Erdiger, blättriger oder strahliger, brauner Goethit füllt
seltener gemeinsam mit dem Manganomelan
Hohlräume aus. Er ist auch färbender Bestandteil des dann
hellbraunen Gesteins in der Nähe von Drusen und Klüften.
Gemeinsam mit farblosem Baryt wurden
hellbraune, glaskopfartige, mm-große Massen gebildet. Dünne
Schichten färben den Baryt, das viele, dünne Spalten damit
ausgefüllt sind.
Manganomelan
Nicht näher bestimmbare Mn-Mineralien bilden bis zu 3 cm-große,
dünne, wiederholt schalige und stalagtitische Beläge neben und
unter dem Quarz, seltener auch in den Drusen
des Baryts. Dünnste, kaum haftende und rissige Beläge überziehen
die Dolomit-Kristalle und werden in der Regel von Chalcedon
überzogen. Seltener sind solche Dendriten auf dem Chalcedon,
teilweise auch unter dem farblosem Quarz, was dem Chalcedon ein
"schmutziges" Aussehen verleiht.

Kristalliner Quarz mit schwarzem Manganogel
auf dem Dolomit,
Bildbreite 5 cm
In einem Fall konnte ein kleines Aggregat eines ehemaligen, nicht
näher ansprechbaren Sulfides unter einem dünnen
Manganomelan-Überzug erkannt werden. Es war in Goethit
umgewandelt worden. Der Manganomelan schützte die erdige
Pseudomorphose vor der Zerstörung.
Typische, moosförmige Dendriten (keine Fossilien!) sind sehr weit
verbreitet auf den Klüften des Dolomits, im Dolomit selbst und auf
den Spalten des weißen Baryts zu beobachten.
Die schwarzen Mn-Oxide bestehen wie an anderen, vergleichbaren
Fundorten aus nicht näher bestimmbaren, weil fast völlig
röntgenamorphen Mn-Oxiden, die mit dem Namen Manganomelan belegt werden können.
Calcit CaCO3
Das verbreitete Mineral ist selten als Auskleidung einzelner
Drusen im Baryt auf farblosem Quarz zu
beobachten. Die kleinen, weißen Kristalle erreichen kaum eine
Größe von 1 mm. Sie zeigen einen skalenoedrischen Habitus, sind
deutlich angelöst und besitzen kaum einen Glanz auf den
Kristallflächen. Farblose Kristalle auf Quarz sind sehr selten.
Im Dolomit selbst konnten bis zu 5 cm große Drusen geborgen
werden, die mit gleichen, farblos bis weißlichen, skalenoedrischen
Calcit-Kristallen ausgekleidet sind. Neben den bis zu 2 mm großen
Kristallen kommt nur etwas Manganomelan und zwischen dem Dolomit
und dem Calcit eine farblose Quarzschicht vor. Die Kristallflächen
des scharfkantigen Calcits scheinen leicht angelöst, etwas stumpf.
Im Dolomit konnten bis zu 1 cm starke Gänge aus grauem Calcit beobachtet werden. Darin finden sich sehr undeutliche, meist durch Ton braun gefärbte Calcit-Kristalle. Sie erreichen bis zu 4 mm Größe.
Rezente, bis zu 2 cm große stalagtitische Bildungen an den Decken
der Drusen bestehen ebenfalls aus stumpfen, weißen bis grünen
Calcit-Aggregaten, deren undeutlich ausgebildete Kristalle sich
unter dem Mikroskop kaum ansprechen lassen.
Dolomit
CaMg[CO3]2
In Alzenau konnte sicher nur Dolomit nachgewiesen werden. Fast
alle Hohlräume des sehr feinkörnigen Gesteins sind mit idiomorphen
Dolomit-Kristallen ausgekleidet. Die Kristalle mit den teils
sattelförmig gekrümmten und deutlich parkettierten Kristallflächen
erreichen wohl bis zu 7 mm Größe, Kristallaggregate daraus auch
1,5 cm. Die gut spaltbaren, farblosen bis gelblichen Kristalle
sind lebhaft glänzend und werden oft von einer dünnen Schicht aus
dem schon beschriebenen Manganomelan
überzogen. Auffällig an den meisten gut ausgebildeten Kristallen
ist weiter, dass sie zusätzliche kleine Flächen wie das
Basispinakoid und das hexagonale Prisma zeigen.

Hellbraune, leicht sattelförmig gekrümmte, rhomboedrische Dolomit-
Kristalle,
Bildbreite 2 cm
Eine Abgrenzung zum Ankerit, Siderit und den anderen Carbonaten ist sicher nur aufgrund von röntgendiffraktometrischen und chem. Untersuchungen möglich, die auch am Alzenauer Material durchgeführt wurden. Die ermittelten d-Werte passen gut zu denen vergleichbarer Fundorte des Spessarts. Die Untersuchung erfolgte an einem typischen, hellbraunen Kristall an der Universität Würzburg. Aus den gemessenen Werten ließen sich die Gitterparameter zu a=4,803 und c=15,994 Å berechnen (JCPDS-Kartei 11-78: a=4,8112 und c=16,02 Å). Es handelt sich um einen sehr reinen Dolomit (50 Mol-% MgCO3), da der d(104)-Reflex von 2,8795 (Å) bei einem Winkel (2Θ) von 31,0325° erscheint.
Das Gestein Dolomit besteht beim Blick durchs Mikroskop aus einem eng verzahnten Kornpflaster 0,05 bis 0,5 mm, ausnahmsweise auch max. 1 mm großer Dolomit-Kristalle. Die verschiedene Orientierung der gut spaltbaren, chremeweißen bis braunen Körner erzeugt das zuckerkörnige Aussehen. Auf den dünnen Klüften lassen sich schwarze Schnüre aus Manganomelan beobachten. Das Gefüge ist stark porig, so dass das Gestein porös erscheint. Cm-große Bereiche bestehen aus einem feinen, locker verwachsenen Gemenge winziger Dolomit- und Quarzkristalle in einer Goethit-Matrix. Feinkristalline wechseln mit größeren Bereichen ab, ohne dass im Schliff eine Schichtung erkennbar ist. In den Zwickeln sind Tonmineralien erkennbar. Organisches Material ist kaum vertreten.

Farblos-weißes Quarz-Gängchen im Dolomit, angeschliffen und
poliert
Bildbreite 2 cm
Das Gestein - hauptsächlich aus dem Mineral Dolomit, weiterer
hier nicht bestimmter Carbonate, Eisen- bzw. Mangan-Oxiden und
Tonmineralien bestehend - zeigt in weiten Bereichen typische
Lösungskorrosionserscheinungen, die sich von den früher
entstandenen Drusen deutlich, weil meist mit wenigen Kristallen
bestanden und an Klüfte gebunden, unterscheiden.
Ein Teil der zahlreichen Drusen im Gestein ist mit einem schlecht
gebundenen Grus aus Dolomit-Kristallen, kleinen farblosen Quarzen,
braunem Goethit und etwas Ton teilweise oder ganz gefüllt. Wie die
Auskleidung aller Hohlräume in anderen Partien ist dies als Edukt
der beginnenden Verkieselung zu deuten.
Fossile Spuren von Lebewesen als nur partiell schlecht erhaltene
Steinkerne bzw. nicht näher bestimmbarer und mit Dolomit
ausgekleideter Hohlräume - mit und ohne Steinkern - wurden nur
selten beobachtet. Es handelt sich hier in Alzenau möglicherweise
um Brachiopoden oder Muscheln (wie z. B. Schizodus obscurus SOW.),
deren Schalen aufgelöst wurden. Übrig blieb der Hohlraum der
Schale oder des ganzen Tieres. Die Steinkerne sind jedoch in
einigen Bereichen deutlich häufiger - aber nicht entlang einer
Schicht angereichert. Die 0,5 - 3 cm großen Hohlräume der
Mollusken lassen keine Einregelung erkennen.
Azurit Cu3[OH|CO3]2
Das sofort auffallende, weil hellblaue Mineral bildet bis zu 5 mm
große "Sonnen" aus strahligen Stengeln auf den Klüften des
Dolomits.
Selten wurden bis zu 3 mm lange, dunkelblaue Kristalle in den
Klüften des Dolomits gefunden. Die Kristalle weisen den gleichen
Habitus auf wie die bekannten aus Altenmittlau.
Verbreitet sind bis zu 5 mm große Rosetten aus dunkelblauem Azurit
als Kluftbelag auf dem mergeligen Dolomit. Sie werden von kleinen
Malachit-Kristallen wie auch von chremeweißen Illit-Überzügen
begleitet. Einschlüsse im und unter dem Chalcedon färben denselben
bläulich.

Blaue Azurit-Kristalle auf Dolomit,
Bildbreite 3 cm
Auf den quer zur Schichtung verlaufenden Kluftflächen erreichen
blaue Beläge, die sich kaum in einzelne Kristalle auflösen lassen,
die Größe von einigen cm2. Sie werden von schwarzem Manganomelan
begleitet und neigen auch zu dendritischen Formen.
Malachit Cu2[(OH)2|CO3]
Das grüne Mineral wurde nur selten auf Klüften des Dolomits
gefunden. Er bildet bis 3 cm große, strahlige, auch gebänderte
Aggregate und auch unscheinbare, erdige bis dendritische Anflüge.
Zusammen mit Azurit ist er selten als
typisches Umwandlungsprodukt zu erkennen. Dünne, radialstrahlige
Aggregate erreichen auf Klüften bis zu 3 cm Durchmesser). Als
Begleitmineral tritt regelmäßig nur Dolomit auf.

Erdiger Malachit als poröse Kruste auf Malachit,
Bildbreite 2 cm

Grüne Krusten aus Malachit mit blauem Azurit auf Dolomit,
Bildbreite 1,5 mm
Gemeinsam mit Chrysokoll fand sich
Malachit in Form 0,5 mm großer, schlecht ausgebildeter Kristalle.
Neben den Azurit-Aggregaten fanden sich bis zu 0,5 mm große Nadeln
und wirre Nadelfilze aus grünem Malachit auf Manganomelan. Die
Malachit-Nädelchen sind meist nur locker aufgestreut und werden so
kaum erkannt. Meist ist feinst verteilter Malachit der färbende
Bestandteil des Chalcedons.
Baryt Ba[SO4]
Grobspätiger Baryt (I) ist die letzte Ausscheidung der primären
Folge. Die bis zu einigen kg großen, grobspätigen Stücke enthalten
bis zu 6 cm lange und 1 cm dicke, tafelige Kristalle.

Tafeliger Baryt-Kristall einer 2. Generation auf
Dolomit,
Bildbreite 7 mm
Sie zeigen oft Lösungserscheinungen und glänzen nur noch an den
reliktisch erhaltenen, originären Kristallflächen. Verbreitet sind
dünne, weiße Überzüge aus Chalcedon. Der Baryt wurde tektonisch
beansprucht; zerbrochene Kristallstücke liegen zwischen den
Kristallen. Drusen im Baryt enthalten selten etwas glaskopfartigen
Manganomelan und farblose Quarzkristalle darüber. Der weiße Baryt der 1.
Generation zeigt eine weiße oder gelbliche, auch bläuliche
Fluoreszenz bei Bestrahlung mit UV-Licht. Bei kurzwelligem
UV-Licht (ca. 255 nm) tritt sie deutlicher auf als bei
langwelligem (356 nm). Auch ist dann eine deutliche,
langanhaltende Phosphoreszenz zu beobachten.
Der Baryt wuchs auf den rhomboedrischen Dolomit-Kristallen, deren
Abdrücke meist auf der Außenseite des weißen Baryts zu sehen ist.
Im Handstück sichtbare, enge Verwachsungen mit dem Dolomit liegen
vor. Das Mineral ist reich an Mn-Dendriten auf den Spaltflächen,
es ist weiter sehr spröde und lässt sich aufgrund der guten
Spaltbarkeit kaum in großen Stücken gewinnen.
Seltener fand sich eine zweite Generation aus einem transparenten, völlig farblosen bis leicht graugrünem Baryt (II). Er bildet bis zu 2 cm lange, dicktafelige, auch gestreckte Kristalle oder bis zu cm-breite Kluftfüllungen innerhalb des Baryts. Sie zeigen ebenso wie die weißen Baryte der ersten Generation auffällige, teils stärkere Lösungserscheinungen, die dann einen "faserigen" Aufbau vortäuschen. Daneben finden sich erneute Bildungen tafeliger, länglicher Kristalle auf den Kluftflächen des Baryts. Der Baryt der 2. Generation fluoresziert nicht.
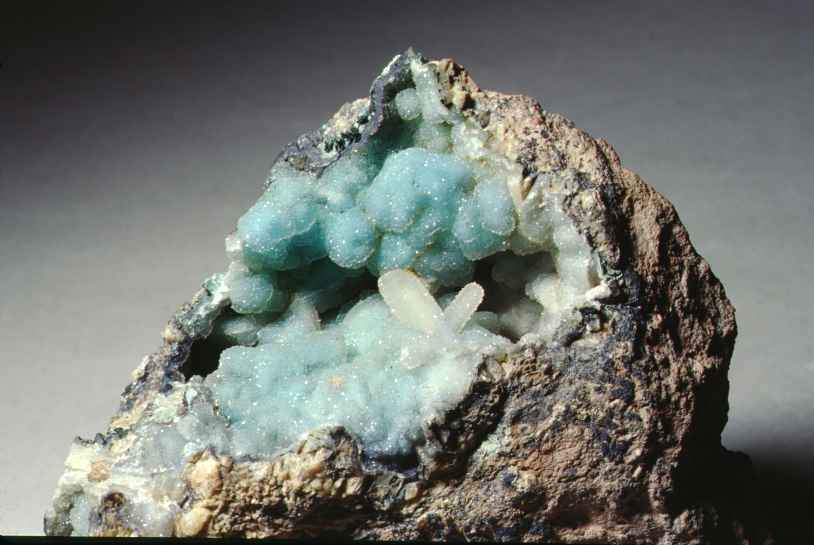
Farblose Quarzkristalle als Kruste auf Dolomit und Baryt,
Bildbreite 8 cm
Die beiden Baryt-Generationen lassen sich chemisch keine Unterscheidung zu, so dass sich mittels EDX nur Ba und S nachweisen ließ (Unterschied <0,5 %).
Die bis zu 1 cm großen, tafeligen Baryt-Kristalle unter dem Chalcedon sind in der Regel weggelöst worden, so dass heute nur noch Umhüllungspseudomorphosen von Chalcedon nach Baryt vorliegen. Darin können selten noch die faserig angelösten Reste des Baryts gefunden werden. Auch bis zu 3 cm lange, mm-breite Vertiefungen in den Dolomit-Drusen haben früher Baryt-Tafeln enthalten.
Im Dolomit finden sich selten bis zu faustgroße, deutlich
konkretionäre Baryt-Stücke. Es fehlen auf der Außenseite die
Negative bzw. die Reste der Dolomit-Kristalle. Statt dessen enden
die grobspätigen Baryt-Tafeln als rundliche "Kristalle". Sie
erinnern im Ansatz an die Baryt-Rosen von Rockenberg, Wetterau.
Chrysokoll
CuSiO3+H2O
Rissiger und dadurch faserig erscheinender Chrysokoll bildet einen
nur 0,2 mm dicken Überzug oder stark rissige Massen zwischen dem Manganomelan auf den Dolomit-Kristallen
und unter dem dann stark grün erscheinenden Chalcedon. Die
"Fasern" des Chrysokolls stehen senkrecht auf den
Dolomit-Kristallflächen. Als Begleitmineral treten kleine Malachit-Kristalle auf.
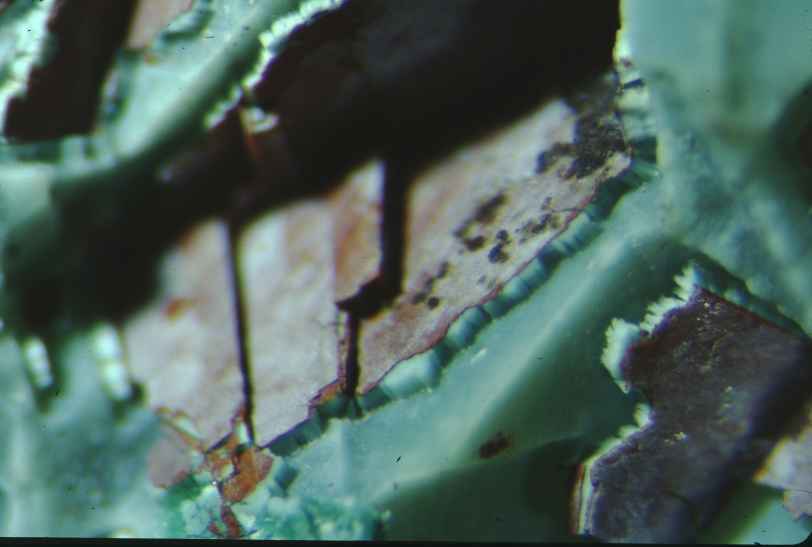
Rissig-faseriger Chrysokoll auf Dolomit,
Bildbreite 3,5 mm
Seltener konnte massiger, grünlicher Chrysokoll als Überzug auf
Dolomit mit wenig Malachit gefunden werden.
Illit K1-1,5Al4[Si7-6,5Al1-1,5O20](OH)4
Das in den Zechstein-Dolomiten des Spessarts verbreitete, aber
sehr unscheinbare Mineral, tritt auch hier als 0,1 mm dicke, sehr
weiche Kruste auf den Dolomit-Kristallen in den weichen, tonigen
Bereichen auf. Die glaskopfartigen Massen sind stumpf und von
chremeweißer Farbe.
Literatur
LORENZ, J. (1997): Der Zechstein-Dolomit von Alzenau und seine
Mineralien.- Nachr. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, Bd. 104,
S. 1-34, Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 781ff.
LORENZ, J. (2014): Die metasomatischen Gesteine im Spessart:
Dolomit, Siderit, Quarzit und Kalkstein.- Jahresberichte der
wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu
Hanau/gegr. 1808 163 - 164, Themenband Spessart,
S. 11 - 32, 9 Abb., 2 Tab., Hanau.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, W. (1967): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5920 Alzenau
i. Ufr.- 336 S., BGLA München.
OKRUSCH, M., MÜLLER, R., & EL SHAZLY, S. (1985): Die
Amphibolite, Kalksilikatgesteine und Hornblendegneise der
Alzenauer Gneis-Serie am Nordwest-Spessart.- Geologica Bavarica 87,
S. 5-37, München 1985.
Zurück
zur Homepage oder an den Anfang der Seite