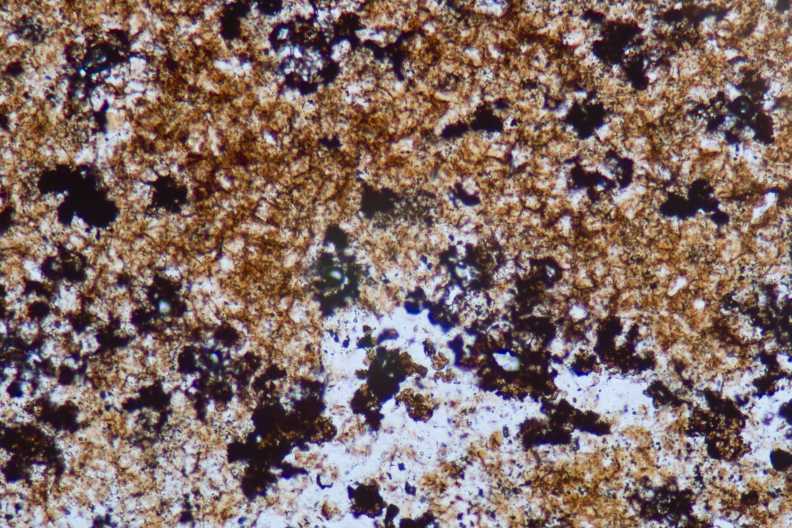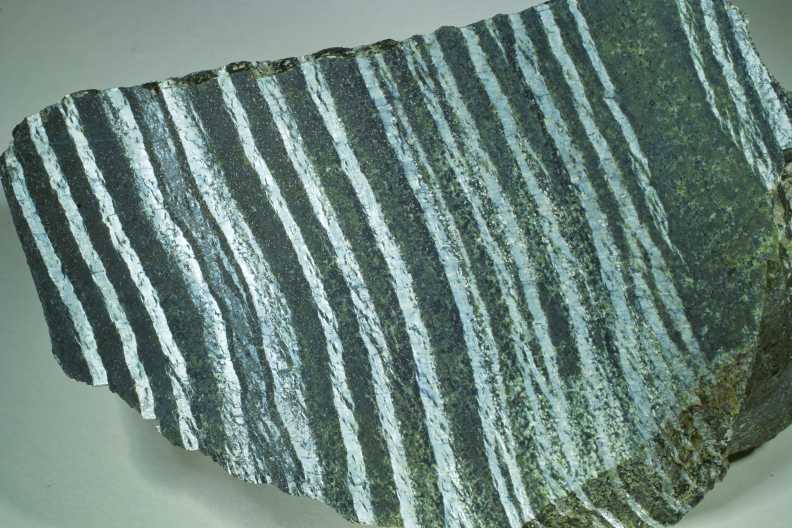Die metasomatisch
veränderten
Zechstein-Sedimente und verwandte Gesteine
im Spessart.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Sie fristen ein Dasein der geringen Beachtung:
Links: Kleinostheim: Neben dem Parkplatz am Schützenhaus liegen
mind. 2 unscheinbare Felsen aus einem hellbraunen Quarzit,
bei dem es sich um die verkieselten Zechstein-Dolomite handelt,
die ca. 1 km weiter nördlich an der Spessart-Randverwerfung
anstehen;
sie wurden bei/nach Bauarbeiten hierher geschafft.
aufgenommen am 01.05.2011.
Rechts: Verkieselter Zechstein-Dolomit, völlig strukturlos,
porös, als sehr zähes und unglaublich hartes Gestein,
angeschliffen und poliert, gefunden im ehemaligen Steinbruch am
Schluchthof der Rückersbacher Schlucht,
Bildbreite 11 cm
Bekanntermaßen liegt auf dem Kristallin des Spessarts über
weite Flächen ein bis zu 20 m dickes Sedimentpaket aus den
vorwiegend carbonatischen Sedimenten des Zechsteins (das ältere
Rotliegende wurde nur auf der Westseite des Spessarts
abgelagert). Es handelt sich bei den Zechstein-Sedimenten
vorwiegend um marin im Zechstein-Meer gefällte Kalksteine; diese
sind nur in Ausnahmefällen noch als solche erhalten und noch
seltener aufgeschlossen. Die aus Norrdeutschland bekannten
Zyklen (Werra-, Staßfurt-, Leine-, Aller-Formation)
sind im Spessart nicht trennbar, da überprägt, nicht abgelagert
oder Schichtlücken bestehen. Als Ablagerungszeitraum ist ein
Alter von etwa 255 Millionen Jahren angenommen worden (diese
Gesteine enthalten keine Bestandteile, mit denen ein
radiometrisches Alter ermittelt werden könnte, so dass man das
aus einer relativen Abfolge schließen muss).

Kaum veränderter, poröser Zechstein-Kalk mit einer erkennbaren
Lamination, dünnen Stylolithen und etwas weißer Calcit als
Neubildung
in den wenigen Hohlräumen. Die Bankung kann als eine Abfolge von
fossilien Biofilmen, sedimentären Abfolge von gefälltem Kalk und
dünnen Lagen aus glimmerreichen Kristallinbestandteilen aus der
näheren Umgebung aufgefasst werden. Gefunden im Tunnel Falkenberg
bei Hain,
Bildbreite des angeschliffenen und polierten Stückes 14 cm.
Diese Kalksteine sind nahezu überall am Spessartrand und an
den wenigen Stellen im Spessart zu dolomitischen Kalksteinen und
Dolomiten umgebildet worden, wobei der Gesteinscharakter als
gebanktes Sedimentgestein aber weitgehend erhalten blieb. Diese
primäre Dolomitisierung ist zum Teil noch bei Meeresüberdeckung
begonnen worden, wie man es aus rezenten Vorkommen kennt. Sie
werden überdeckt von Tonsteinen (Bröckelschiefer,
Fulda-Formation), die nahtlos in den Buntsandstein über leiten.
Der Buntsandstein besteht an der Basis ebenfalls aus Tonsteinen,
Schluffen und Sandsteinen im Wechsel.
Diese dolomitischen Sedimente haben eine
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, denn aus dem "Kalkstein"
wurde an den Vorkommen bzw. wird in Rottenberg "Kalk" (Branntkalk) gebrannt, der u. a. zur
Mörtelbereitung in der Bauwirtschaft verwandt wurde
("Aschaffenburger Schwarzkalk"). Die Tradition "Kalk" zu brennen
ist lange und sehr verbreitet praktiziert worden (siehe LORENZ
2010:781ff).
In einer zweiten Phase ist ein Teil des Gesteins so weit
verändert worden, dass nur größere Strukturen wie einzelne
Fossilien (Steinkerne) und die tonigen Schichtgrenzen
überliefert sind. Im Bereich der zahlreichen
Störungen (oft identisch mit den Baryt-Gängen) wurden diese
Kalksteine und Dolomite einer teilweise entstellenden
Veränderung unterworfen, so dass man die einstige Natur des
Gesteins im Handstück nicht mehr erkennen kann, sondern nur der
Verband zeigt, welche Zeitstellung das Gestein hat. Im
Handstück, als Block oder als Geröll ist es nicht möglich, die
Herkunft zu ermitteln - wenn man keinen Aufschluss kennt. Am
weitesten verbreitet sind die verkieselten Dolomite des
Zechsteins (infolge der großen Beständigkeit bleiben die Felsen
selektiv erhalten und fallen als solche Gesteine naturlich mehr
auf). Die metasomatischen Bildungen sind die Folge einer
hydrothermalen Überprägung im Zuge der Bildung der barytischen
Gangabfolge auf den NW-SE-Verlaufenden Störungen. Dies konnte in
den letzten Jahren an zahlreichen, teils bisher unbekannten
Vorkommen beochatet werden.
Folgende Gesteine sind aus den Zechstein-Sedimenten hervor
gegangen; die Aufstellung ist nur beispielhaft, denn die meisten
Formen sind an mehreren Lokalitäten anzutreffen:
- Quarzite
Alzenau:

Bei Bauarbeiten im nördlichen Stadtgebiet von Alzenau im
eigentlichen
Sinn werden immer wieder rätselhafte, runde Blöcke aus einem
wohl
sedimentären, metasomatischen Quarzit freigelegt. Diese finden
dann
den Weg in die lokale Gartengestaltung. Die oft sehr gut
gerundeten,
äußerst harten und stellenweise mit Windschliff versehenen
Blöcke
findet in Größen von ca. 2 - 3 kg bis hinauf zu 2 t Gewicht -
hier aufgenommen am 04.06.2001.
Weitere Blöcke liegen am Spessart-Gymnasium und an Plätzen, wo
man diese in die Gestaltung der Straßen einbezogen hat.
Merkwürdigerweise findet man keine kleinen Stücke. Da das
Gelände inzwischen nahezu lückenlos bebaut worden ist, werden
keine frischen Blöcke mehr ausgegraben.

Gartengestaltung (Steingarten) mit den Blöcken aus verkieseltem
Zechstein-Dolomit auf Schrotten aus dem Rhyolith von Sailauf am
Rannenbergring im Alzenauer Stadtteil Kälberau;
aufgenommen am 23.12.2019
Zahlreiche Mauern, Gärten und Vorgärten in Kälberau sind mit
diesen Steinen bestückt worden, denn die sind sehr dauerhaft und
lassen sich wegen der glatten Oberfläche auch leicht reinigen.
Da aus dem Stein so gut wie keine Nährstoffe gezogen werden
können, ist auch nur ein geringer Aufwuchs an Flechten und Moos
zu bobachten.
Achtung!
Es gibt merkwürdigerweise hier in Alzenau am Rothenberg auch
sehr ähnlich bis gleich aussehende Tertiär-Quarzite (LORENZ
2010:675), wie sie beispielsweise aus Wächtersbach (JAHN
2017:346ff), insbesondere aus den Braunkohlenvorkommen, bekannt
und beschrieben worden sind. Dabei handelt es um kieselig
gebundene Sandsteine ohne Porenvolumen, die als Quarzite an der
Oberfläche der im Miozän gebildet wurden. Eine hydrothermale
Genese ist zu verneinen. Eine sichere Unterscheidung ist nur mit
Hilfe eines Mikroskops, besser und ganz sicher mit einem
Dünnschliff, möglich.
Diese kieseligen Gestein brechen bei einem hohen
Verkieselungsgrad (also porenlos) splittrig, so dass unsere
Vorfahren diese Gesteine - sowohl Tertiärquarzite als auch die
verkieselten Zechstein-Dolomite - als potentielles Gestein zur
Herstellung von Werkzeugen erkannten und auch nutzten. Bei der
Durchsicht von archäologischen Fundkomplexen aus der Region
konnten solche Gesteine - ohne sichere Herkunftszuordnung -
erkannt werden.
Hörstein:


Typisch brauner Verkieselter Zechstein-Dolomit als
anstehender Fels (teils mit Flechten überkrustet) im
Weinberg von Hörstein (R 3505784 H 5546722),
am links 02.01.2016, rechts mit Julius KAPELLER am
27.02.2016) - es dürfte damit der einzige Wein auf
verkieseltem Zechstein-Dolomit sein.

Der wolkig verkieselte Kalkstein weist eine hohe Porositöt
auf und ist
von etwas Manganhydroxiden durchsetzt, angeschliffen und
poliert,
Bildbreite 8 cm
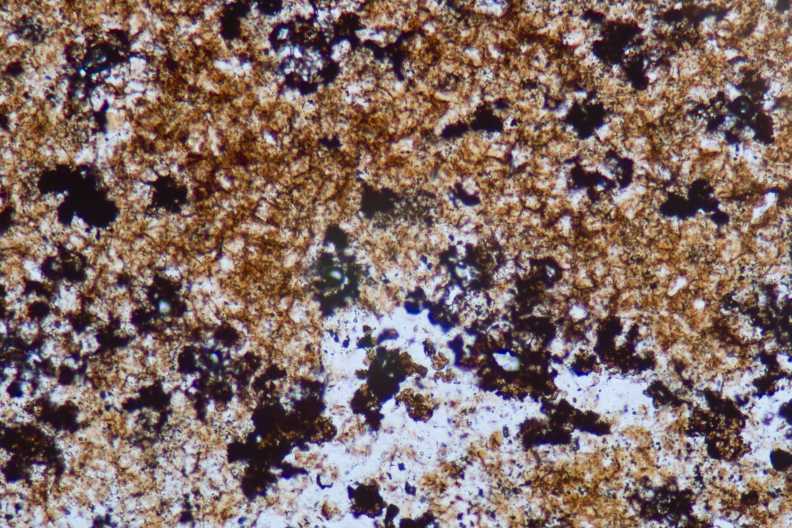
Das gleiche Gestein wie oben, jedoch unter dem Mikroskop als
Dünnschliff:
Die einzelnen Quarzkörnchen sind kleiner wie die
Schichtdicke des Schliffs
und durchsetzt von Eisen- und Manganoxiden; die helle
Struktur ist der
Teil eines Risses, der mit Quarz gefüllt ist,
Bildbreite 1,25 mm
Das Vorkommen befindet sich auf einer Höhe von ca. 220 m und
liegt damit etwa 100 m höher als das gleiche Gestein bei
Kleinostheim! Im Hangschutt unterhalb finden sich große
Mengen des sehr verwitterungsbeständigen und zähharten
Gesteins, welches durch die Bebauung verhüllt ist und nur
beim Ausheben von Fundamenten zu Tage treten.

Großer, ca. 3 t schwerer Felsblock aus verkieseltem
Zechstein-Dolomit,
partiell von hellen Flechten und Moos überkrustet. Die
Rückseite trägt
eine Impala-Platte mit dem Eintrag: "Zum Gedenken an die
Verstorbenen
des ASV Hörstein". Der Geologenhammer ist 28 cm lang.
Gesehen nach
einem Hinweis eines Mitglieds des Angelsportvereins Hörstein
am
04.05.2025 auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube des
Vereins
zwischen Kahl und Hörstein (Alzenau).
Dettingen:


Links: Verkieselter Zechstein-Dolomit als anstehender
Felsen (fast ganz mit Moos überwachen) des Vorkommens der
Waldabteilung Kühruhe
im Gemeindewald von Dettingen am 03.01.2016. Die kleinen
Schürfe waren vermutlich im 19. Jahrhundert angelegt worden.
Dabei wurde das
Gestein von Hand zu Schotter zerklopft, was einen
hervorragenden Schotter und Splitt ergibt. Für diese Abbaue
gibt es keine schriftlichen
Belege oder Archivalien.
Rechts: Bruchstück des unscheinbar braunen und stumpfen
Gesteins von einer Halde des ehemaligen Steinbruchs,
Bildbreite 13 cm.
Kleinostheim:


Diese sehr harten Gesteine bleiben bei der Verwitterung und
beim Transport in Bächen und Flüssen gut erhalten und werden
angereichert. So
findet man in den Kiesgruben des Maintals sehr reichlich
diese Gesteine in kantigen Stücken; das Bruchstück stammt
aus der ehemaligen
Kiesgrube Schultz zwischen Kleinostheim und Dettingen,
gefunden 1973. Das Stück im linken Bild ist auf einer
Kluftflächen mit einem Rasen
aus farblosen Quarz-Kristallen überkrustet. Diese
Quarzite sind immer braun in unterschiedlichen Tönen,
brechen splittrig und weisen Klüfte
auf, die oft mit farblosen Quarzkristallen überkrustet sind,
Bildbreite 11 cm.
Das Bild rechts zeigt einen Ausschnitt der oberen
Bruchfläche. Dabei sieht man, dass man keine
Strukturelemente erkennen kann; trotzdem
ist dies ist ein gutes Merkmal für die Bestimmung,
Bildbreite 2 cm.

Brauner, verkieselter Zechstein-Dolomit nördlich des
Winterwies-
grabens an der Spessart-Randverwerfung bei Kleinostheim. Die
hellen
Flächen sind Flechten. Länge des Geologenhammers 28 cm;
aufgenommen am 31.03.2025.

Dicke Platte eines ca. 1,5 m hohen Steins aus braunem,
verkieseltem
Zechstein-Dolomit auf einer Verkehrsinsel zwischen der
Frankfurter Str.,
Stuttgarter Str. und der Straße zum Schluchthof in der
Waldstadt von
Kleinostheim;
aufgenommen am 02.05.2025.
Bieber:
Aus Bieber sind verkieselte
Zechstein-Sedimente seit den Tagen des Bergbaues bekannt
und die sehr harten und zähen Gesteine wurden von den
Bergleuten als "Rauhkalk" angesprochen und in der Regel
nicht abgebaut, so dass heute noch solche Felsen in den
Abbauen zu sehen sind. Wie von anderen Orten bekannt, sind
diese Quarzite strukturlos und meist einfach braun
gefärbt. Die Ausnahme sind Partien, bei denen die
Schichtung erhalten geblieben ist.


Links: verkieselter
Zechstein-Dolomit aus dem Tagebau Nord,
Bildbreite 13 cm.
Rechts: Verkieselter Kupferschiefer aus dem Tagebau Nord,
Bildbreite 4 cm.
Schweinheim
Die Zechstein-Sedimente von Schweinheim (Stadtteil von
Aschaffenburg) sind früher auch zu Kalk gebrannt worden. Es
gibt keinen Aufschluss, sondern nur Lesesteine auf Äckern im
Verbreitungsgebiet. Dabei sind wohl auch verkieselte Partien
ausgewittert:


Links:
Verkieselter Zechstein-Dolomit als Lesestein von einem Acker
bei Schweinheim. Merkwürdig sind die Negative von einem
kubischen Mineral, entweder Halit, Pyrit oder etwas
anderes. Leider ließen sich auch unter dem Mikroskop keine
Reste des Vorläufers erkennen, so dass es sich um eine
Vermutung handelt. Fund und Sammlung Thomas WEIS,
Schneppenbach;
Bildbreite 6,5 cm.
Rechts:
Ausschnitt aus dem linken Bild mit dem Negativ eines kubisch
(oder auch orthorhombischen) Minerals, welches sowohl auf
Klüften als auch innerhalb des Gesteins eingewachsen
ist;
Bildbreite 1,5 mm.
- Dolomite und andere "Zebra-Gesteine"
Rottenberg:

Durch die hydrothermalen Lösungen der Baryt-Genese
rekristallisierter hell-
bis dunkelbrauner Dolomit bzw. Ankerit zusammen mit weißem
Baryt aus
dem Steinbruch der Fa. Hufgard bei
Rottenberg, (dunkler "Zebra-Dolomit"),
Bildbreite 23 cm.
In dem Stück kann man gut sehen, dass die Fluide einmal
entlang der Schichtgrenzen wie auch in die hier diagonal
verlaufenden Klüfte in das Gestein eingedrungen sind. Bei
der Umsetzung (Metasomatose) wurden die kleinsten
Dolomit-Kristalle von dem warmen Wasser (Hydrothermen)
gelöst und in größeren Kristallen mit sehr unterschiedlichen
Eisen- und Mangangehalten wieder als Dolomit bzw.
Dolomit-Ankerit-Kutnahorit-Mischkristall abgeschieden. Der
weiße Baryt ist dabei die fianale Füllung, die zu einem
Verschluss der Wegsamkeiten führte. Eine frühe, Ca-betonte
Phase der Hydrothermen, ist auch an anderen Stellen im
Spessart zu beobachten, besonders im Bereich des
Diorit-Komplexes - siehe auch die Tunnelbaustelle zwischen
Heigenbrücken und Laufach.
Die jetzt sichtbare, schokoladenbraune Farbe ist eine Folge
der tertiären Tiefenverwitterung, bei der ein Teil des
Mangans wie auch des Eisens mobilisiert und als Manganoxide
und Eisenhydroxide aun den Kristallgrenzen neu gebildet
worden ist. Beim
Zerfall des Dolomit-Ankerit-Kutnahorit-Mischkristalls wird
das Eisen bzw. das Mangan frei und bildet Oxide und
Hydoxide, die das Abfärben bedingen. Das dabei
auch frei werdene Calcium ist die Ursache für die Bildung der
vielen farblosen, weißen bis schwarzen Calcit-Kristalle in den
Hohlräumen.
Am Bergmannsloch bei Hailer (bei Gelnhausen) sind auch
solche Gesteine aus grobkristallinen Carbonaten gefunden
worden.
Von der Tunnelbaustelle
zwischen Hain und Heigenbrücken

Hydrothermaler Zebradolomit (HZD,
siehe KELKA et al. 2023) mit
dem Übergang zum nicht veränderten Dolomit bzw. Kalkstein,
angeschliffen
und poliert, gefunden im Tunnel
Falkenberg,
Bildbreite 10 cm.

Eine ähnliche Bildung ist eine fleckige Variante
("Fleckendolomit"), geschliffen
und poliert, gefunden im Tunnel Falkenberg. In den Zwickeln,
Hohlräumen und
Poren sind dünntafelige Baryt-Kristalle gesprosst,
Bildbreite 13 cm
Die immer noch nicht ganz verstandene Entstehung der
merkwürdigen Gesteine war der Gestand von Ulrich KELKA´s
Arbeit an der School of Geographical and Earth Sciences der
University of Glasgow in UK, wo die Proben im Vergleich mit
denen von der San Vicente Mine in Peru analysiert wurden:
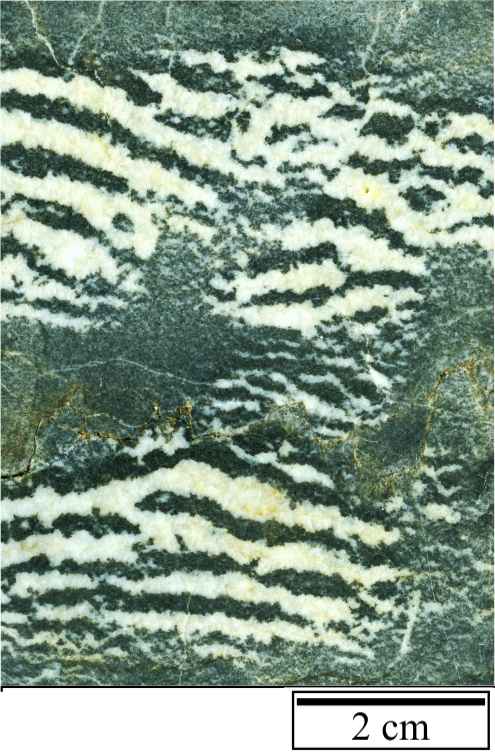
Hydrothermal Zebra Dolomite aus Peru; die
Ähnlichkeit ist doch frappierend,
Foto von Ulrich KELKA, Universität Glasgow.

Gelblicher Zebradolmit mit einem Riss,
ausgefüllt von weißem Calcit und
Azurit von der Gratlspitze der nördlichen Kalkalpen
südöstlich von Rattenberg
bei Brixlegg, Tirol, Österreich; partiell angeschliffen.
Gefunden von Vera KARNER von Geo-Trip in Krün,
Bildbreite 9 cm.
Aus den "Bergamsker Alpen" beschreibt WAGENPLAST (2008:255
Abb. 5) einen "Zebrastein" von Selvino als weiß gebänderten
Dolomitstein mit braunem Calcit.
Sehr ähnliche Strukturen sind auch aus völlig anderen, z. B.
metamorphen, Gesteinen bekannt:
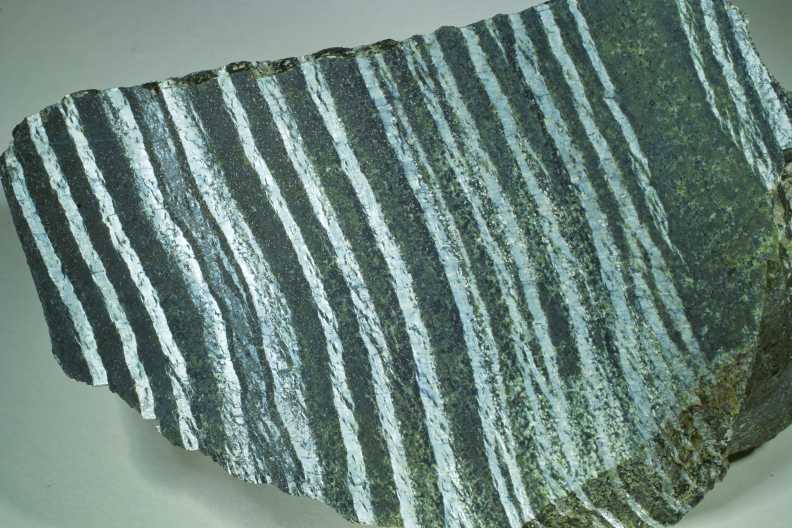
"Serpentin"-Gestein mit Lagen aus Parallelfaserigem
Serpentin ("Zebra-Serpentin")
mit dünnen Lagen aus Chrysotil aus dem nördlichen Mineras
Gerais in Brasilien.
Das hier angeschliffene Gestein wird im Handel als "Silberauge"
bezeichnet,
Bildbreite 12 cm
Wie eigene Mineralanalysen (Probe 000/532)
zeigen, besteht das Gestein hauptsächlich aus einem
feinkörnigen Klinochlor in den dunklen Partien. Darin ist
reichlich das weltweit sehr seltende Mineral Magnesioferrit
((Mg,Fe,Mn)(Fe,Al,Ti)2O4)
enthalten, weshalb das Gestein auffallend magnetisch ist,
insbesondere in den ganz dunklen Bändern. Die hellen Streifen
werden von Chrysotil in der Variante -Orc1
(orthorhombischer Polytyp; früher Orthochrysotil) ausgefüllt.
Es ist damit ein klassisches "Asbesterz" und man könnte es zur
Gewinnung von Asbestfasern abbauen, deren Verwendung aber
innerhalb der EU verboten ist.

Fluorit mit einer Zebra-Struktur ("Zebra-Fluorit")
aus einem nicht näher
bekannten Vorkommen in Nord-Korea(!), angeschliffen und
poliert,
Bildbreite 12 cm.
Solche Bildungen in Blei-Zink-Lagerstätten und auch von
solchen Fluoriten sind beispielsweise auch aus Spanien bekannt
und sie wurden zusammen mit dem Zebra-Dolomit als Zeiger für
solche Lagerstätten angesehen (WAGENPLAST 2004).
Sehr änliche Fluorit-Kalkstein-Wechsel sind von der Austin
lead mine und aus dem Hastle Quarry bei Cave in Rock in
Illinois beschrieben worden (GOLDSTEIN 1997:35 fig. 60, FISHER
et al. 2013:38). Es handelt sich um eine
Mississippi-Valley-Type Lagerstätte, die neben Blei- und
Zinkerze auch für schöne Mineralien bekannt ist. Die
gestreiften Fluorit-Erzkörper werden dort als "coontail-ore"
benannt, nach dem amerikanischen Kurzwort coon für raccoon,
dem amerikanischen Namen für den Waschbär (Procyon lotor),
der einen weiß-schwarz geringelten Schwanz besitzt.

Ein sehr großer, frischer Felsblock eines Zebra-Dolomit
(oder -Kalk?) in der Ausstellungsfläche zwischen fossilem Holz
bei Jim Grey´s Petrified Wood am Stadtrand (am Highway US 180)
von Holbrook in Arizona, USA. Der Stein stammt sicher aus
einer der vielen Blei-Zink-Lagerstätten vom
Mississippi-Valley-Type in den USA.
Aufgenommen von Helga Lorenz mit Alfred NEUMANN als Maßstab am
23.02.2017.
An sehr abgelegener Stelle, in den North-West Territories in
Kanada, auf Baffin Island, gibt es die Nanisivik Mine auf 73°
N°! Dort baute man Zink- und untergeordnet Bleierze ab, die
auch etwas Ag führten. Die sulfidischen Erze befinden sich ein
einem etwa 1 Ga alten Dolomit, der nach der fig. 7 in GAIT et
al. (1990:519) aus einem Zebra-Dolomit besteht. In einem
kleinen Karstsystem fanden sich außergewöhnlich schöne
Pyrit-Kristalle, die zu den schönsten der Welt gezählt
werden.
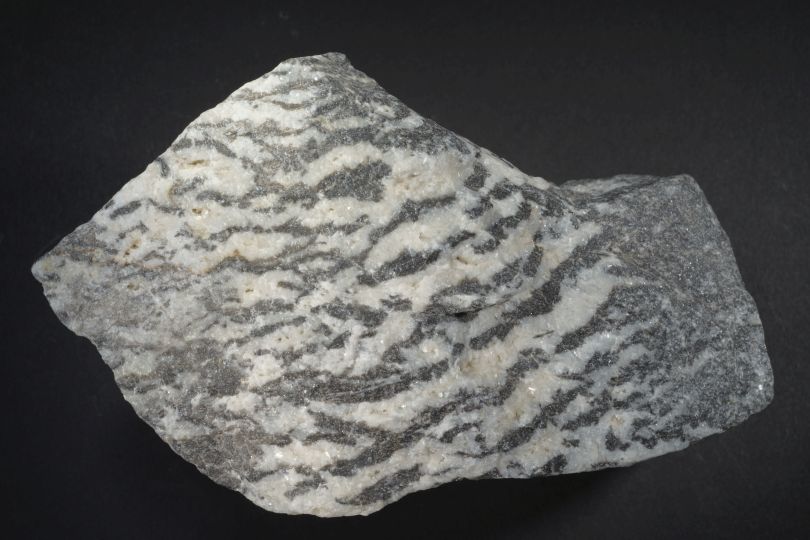
Handstück eines Zebra-Dolomits von einer
MTV-Lagerstätte in
Missouri, USA. Es handelt sich tatsächlich um einen Dolomit
(mittels
Analysen geprüft),
Bildbreite 13 cm.

Bruchraues Handstück eines visuellen "Zebra-Calcits"
von Las Alpujarras im
südöstlichen Andalusien, Spanien. Das Gestein wird dort von
den Bergleuten
als "Piedra Franciscana" bezeichnet.
Bildbreite 10 cm
Das Stück wurde vom Stuttgarter Geologen Peter Wagenplast
(*1941 †2013)
gesammelt, der darüber 2004 berichtete (WAGENPLAST 2004).

Von einer Störung durchzogenes Stück eines "Zebra-Fluorits"
mit
braunem Fe-Calcit als finale Bildung. Der weiße und braune
Fluorit war das Ziel eines Bergbaus auf das Mineral;
angeschliffen
und poliert. Dass es sich ausschließlich um Fluorit handelt,
wurde
mittels Analysen geprüft,
Bildbreite 10 cm (ex. Coll. Wagenplast).

Von mehreren Generationen Störungen durchkreuztes Stück eines
"Zebra-Dolomits" von Alto de la Estrella, Sierra de
Gador, Andalusien,
Spanien; Abb. 3 in WAGENPLAST (2004:174), aber nachgeschliffen
und neu poliert,
Bildbreite 21 cm (ex. Coll. Wagenplast).

Leider ist die Herkunft nicht bekannt: Zebra-Quarz
oder Zebra-Jaspis,
also ein Chalcedon mit umkristallisierten Bändern aus einem
farblosen
Quarz, der die gleiche Textur zeigt, wie die Zebra-Dolomite.
Oder es ist
ein verkieseltes Zebra-Carbonat. Das Stück fand sich ohne
Zettel in der
Sammlung von Dr. Werner KLINGEN (*1930 †2005) und gelangte
sicher von 1994 in dessen Bestand;
Bildbreite 11 cm.

Metasomatischer Siderit (hellbraun; WERNER 1981) mit
Sphalerit
(dunkelbraun) als "Zebra-Siderit", durchzogen von weißen
Calcit-Rissen
und links eine jüngere Störung, ausgefüllt von Siderit. Darin
sind noch
winzige Chalkopyrit-Körnchen eingewachsen. Der Haldenfund stammt
aus dem Sabiner Stollen der aufgelassenen Eisenerzgrube
Füsseberg bei
Daaden-Biersdorf. Das geschliffen und polierte Stück stammt aus
der
Sammlung von Peter WERNER(†);
Bildbreite 9 cm.

Tektonisch versetztes Bändererz aus Sphalerit (braun)
und Calcit (weiß) von der Grube Hilfe Gottes bei Bad Grund
im Harz,
Sammlung Peter C. Ruppert im Mineralogischen Museum der
Universität Würzburg (Foto Kristina Hanig). Das Stück wurde
in dem Buch KLEINSCHROT, D. & HANIG, K. [Hrsg.] (2019):
Historische Erzlagerstätten und Mineralienfundorte des
Harzes. Die Sammlung Peter C. Ruppert im Mineralogsichen
Museum der Universität Würzburg.- 105 S., Abb., [Würzburg
University Press] Würzburg (Preis mit festem Einband 44,90
€, 20 € als Sonderausgabe) auf Seite 53 abgebildet und
beschrieben,
Bildbreite 40 cm
Nun gibt es Gesteine bzw. hydrothermale Gangbildungen, die den
Zebra-Strukturen sehr ähnlich sind und im Handstück auch nicht
immer sicher als solche erkannt werden können. Bekanntes
Beispiel dafür sind die Bändererze aus den Gängen der
Blei-Zink-Lagerstätte von Bad Grund im Harz.

Dunkler Kalkstein mit weißem Calcit als Rissfüllung;
gefunden von Lothar STAAB im Sauerland,
Bildbreite 14 cm.
Es sieht einem Zebra-Kalkstein sehr ähnlich, ist aber das
Produkt einer mechanische Beanspruchung des Gesteins, welches
Risse bildete, die dann mit weißem Calcit aufgefüllt wurden.
Hier wurde aber keine chemische Veränderung beobachtet.

Australischer "Zebra Rock",
Bildbreite 7 cm
Das faszinierende Gestein Zebrastein (englisch "Zebra
Rock") hat zwar eine Zeichnung wie beim Zebra-Dolomit,
ist aber ein Sedimentgestein, bei dem die Schichtung unter dem
Mikroskop noch erkennbar ist. Der feinkönige Sandstein stammt
von der Halbinsel Mirinwung des Gajerrong Ostufers am Lake
Argyle ganz im Norden von Westaustralien, ca. 70 km südlich
der Stadt Kununurra in der Kimberly-Region. Es ist Bestandteil
der Ranford-Formation (Johnny-Cakeshale-Member) und ist etwa
670 Ma alt (Präkambrium). Als Gesteinsbestandteile werden
neben Quarz und Muskovit noch Kaolinit, Dickit und Alunit
angegeben. Die dunklen Bänder bzw. Bereiche enthalten ein
feines Pigment aus Hämatit; das ist auch auf den Kluftflächen
zu sehen. Bemerkenswert ist die Zeichnung des weichen
Gesteins, die sich nach den Fotos auf den Internetseiten auf
eine größere Distanz verfolgen lässt. Es scheint so zu sein,
dass einst das ganze Gestein Hämatit führte und die hellen
Bänder entfärbt wurde, in dem das Eisenoxid abgeführt worden
ist. Der Prozess scheint unverstanden.

Diesen Stein müsste man als "Zebra-Pegmatit"
ansprechen. Der stammt aus dem
Pegmatit von Püllerreuth in der Oberpfalz,
Bildbreite 17 cm.
Wie oben beschrieben, gibt es solche Texturen auch in
Pegmatiten. Ein Beispiel bilden KUZ´MIN & SKOROBOGATOVA
(2000:95) ab, in dem sie einen rhythmisch gebänderten
Muskovit-Albit zeigen, der mit dünnen Bändern aus
Muskovit-Beryll-Plagioklas abwechselt. Das Stück stammt aus
der Izumrudnye Mine im Ural Russlands.
Aus dem Hohenloher Feuerstein wird auch ein "Zebra-Hornstein"
aus hellen und dunklen Lagen eines Chalcedons, aber wohl kein
klassischer Achat, beschrieben und abgebildet (SCHÜSSLER,
SIMON & WARTH 2000:113). Diese haben keine hydrothermale
Genese, so dass dies ein anderer Prozess war, der dabei
ablief.
Aus Bosnien-Herzegowina ist hydrothermaler "Zebra-Siderit"
beschrieben worden (KELKA et al. 2018:170).
Von der Ostküste Grönlands kennt man "Zebra-Baryt" (KELKA
et al. 2018:170), ebenfalls als hydrothermale
Bildung.
Aus Jacupiranga in Braslilien wird von WIMMENAUER (1985:341
Abb. 117C) eine metasomatische Reaktionszone aus Phlogopit und
Calcit mit rhythmisch-lagiger Ausbildung zwischen einem
Karbonatit und einem Pyroxenit beschrieben. Die Abbildung
zeigt eine "Zebra-Struktur".
TAYLOR (2009:2919 Plate 35) bildet unter der Überschrift
"Textures of Related/Miscellanous Interest" einen
australischen "Zebra-Quarz" ab (kein Fundort
angegeben), ohne den Begriff zu verwenden.
STARKEY (2022:283) bildet in fig. 536 hübsch gebänderten
"Lithomarge" ab. Die Abb. zeigt einen sehr gut, hell/dunkel
gebänderten Tonstein aus dem Bergwerk Cook´s Kitchen Mine,
Illogan, Cornwall. Mit "Lithomarge" wird in England
üblicherweise das bezeichnet, was man hier früher als
"Steinmark" ansah, also Tonmineralien wie Kaolinit, Halloysit
usw. aus hydrothermalen Gängen. Auf der Seite der englischen
Mineralienhandlung von Crystal Classics ist ein ähnliches
Stück abgebildet, welches aber bereits (abgerufen 07.07.2022)
verkauft war. Ein weiteres mit "narrow bands" stammt aus der
Phenix Mine No. 7 in Cornwall. Diese Stücke erinnern eher an
"Liesegang-Bänder".

Auf den Münchner Mineralien-Tagen wurde 2021
ein "Zebra-Calcit" angeboten, der aber
in Wirklichkeit ein Kalksinter aus Calcit ist. Die
Gesteinsbrocken wurden mit Säure
behandelt, um die Farbtiefe zu erhöhen.
Das angeschliffen und polierte Stück ist 11 cm breit.

Ein merkwürdiges Gestein mit einer
"zebraähnliches" Textur aus Rhodochrosit, Jakobsit
und ein Mg-Silikat aus Sǎcǎrǎmb (früher Nagyág), 25 km SE
von Brad in Rumänien;
Bildbreite 8 cm angeschliffen und poliert.
- Kalksteine:
Von der Tunnelbaustelle
zwischen Hain und Heigenbrücken


Metasomatisch durch die Bildung Calcit aus einem
Zechstein-Dolomit entstandener, mausgrauer Kalkstein. Dabei
wurde das Magnesium abgeführt
(Dedolomit) und es kam zu einer erheblichen Kornvergrößerung, so
dass das Gestein im Handstück eher nach einem grauen Marmor
aussieht,
Bildbreite 8 cm.
Eine ganze Schar aus cm-breiten Baryt-Gängen durchschlägt den
metasomatischen Kalkstein (LORENZ 2014:23ff). Diese streichen
ganz typisch von
NW nach SO, siehe Geologenhammer als Maßstab rechts im Foto,
aufgenommen am 07.09.2014.
Der eindrucksvolle Aufschluss wurde nach dem Ende der
Bauarbeiten "rekultiviert" und ist heute verschüttet.
Diese Kalksteine sind erst mit dem Tunnelbau der Bahn bei Hain
entdeckt worden (LORENZ 2014). Mit dem Bauforschritt konnte man
erkennen, dass überall im Bereich der Baryt führenden Störungen
diese Gesteine aus den Zechstein-Dolomiten entstanden sind. Die
ursprüngliche Struktur wurde dabei völlig verändert, so dass
selbst die sonst trennenden Tonlagen völlig verschwinden können,
so dass es als ein massiges Gestein ohne Vorzugsrichtung
vorkommt.
Merkwürdige Zechstein-Kalke bzw. Dolomite aus dem Tunnel
Hirschberg


Ca. 10 cm mächtige Lage aus einem merkwürdigen Sediment
aus feinblättrigen Calcit, der aber senkrecht zur Schichtung
steht. Im Ausschnitt eines gesägten
Stückes ist der plattig-gitterartige Aufbau gut zu sehen,
aufgenommen am 21.04.2014
Länge des Geologenhammers 41 cm
Der Kalkstein, der eindeutig den Zechstein-Sedimenten
zuzuordnen ist, ist reich an Tonmineralien. Diese Tonteilchen
finden sich in den Zwischenräumen der sehr dünnen plattigen
Struktur. Die paralle angeordneten Plättchen, die mit den
Resten der einstigen Schichtung eine gitterartige Struktur
ergibt, sind sehr empfindlich und sind deshalb an der
Erdoberfläche nicht erhaltungsfähig. Man kann sie kaum
bearbeiten, ohne dies vorher mit einem Kleber zu festigen.
Vermutlich sind die das Pendant zur Zebrastruktur im Tunnel
Falkenberg.

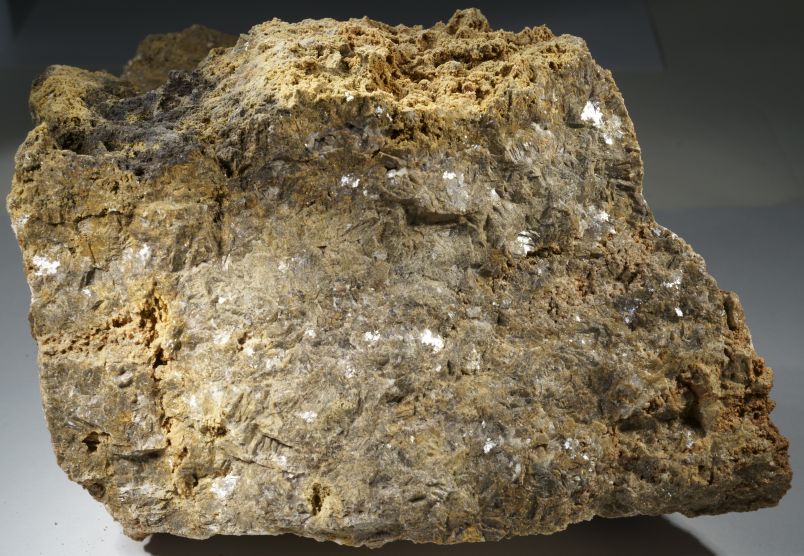
Mit den Bauarbeiten im Neubaugebiet "Rotäcker" in Schweinheim
(Aschaffenburg) wurden Felsen angetroffen, die aus einem
metasomatisch
umgewandelten Kalkstein bestehen; links die Baustelle mit den
Kalksteinen
aufgenommen am 02.06.2021
Rechts: Bruchstück mit einer Bildbreite von 16 cm.
In Schweinheim (Aschaffenburg) stehen Zechstein-Kalke an,
die im 19. Jahrhundert auch zu Kalk gebrannt wurden; ebenso
hat man mit den gleichen Öfen Ziegel aus dem Tons des
Bröckelschiefer gebrannt. Infolge der Überbauung waren in den
letzen Jahren keine Aufschlüsse vorhanden, wo man diese
Kalkstein hätte anschauen können. Mit dem Beginn der
Erschließung des Neubaugebietes "Rotäcker" wurden Felsen
gefördert, die eine große Ähnlichkeit mit den Kalksteinen von
den Liebighöfen besitzen. Auch hier war es in Schweinheim der
Hausbau, der einen solchen Aufschluss schuf. Details zur
Mineralogie und Geochemie können erst berichtet werden,
wenn Unterschungsergebnisse vorliegen.
- Siderite:
Bieber (heute Biebergemünd)

Der "Bieberer Eisenstein": metasomatisch aus den
Zechstein-Carbonaten
entstandener Siderit (helle Partien), teils durch das lange
Liegen in den
Halden in Goethit (schokoladenbraun) umgewandelt und von Pyrit
durchsetzt,
angeschliffen und poliert,
Bildbreite 18 cm.
Das im Handstück kaum nach seiner Herkunft zuordenbare Gestein
kam in Bieber in sehr großen Mengen vor
und wurde als Manganerz abgebaut. Leider gibt es kein Foto eines
anstehenden Eisensteins und auch die Zeichnungen zeigen nur eine
wolkige Imprägnation in den Zechstein-Sedimenten. Auch auf den
Halden kann man es kaum finden, da es sich nur wenige oder gar
nicht von den mit Erde verschmierten Brauneisestein-Stücken
unterscheidet. Ein im Tagebau Nord 2014 angelegter Schurf
erbrachte leider keinen anstehenden Siderit, sondern nur eine
Masse aus erdigem hellbraunem Goethit und schwarzem Romanechit
und weißem Baryt.
- Ankerite:
Sommerkahl

Die Grube Hoffnungsglück bei Sommerkahl baute auf
Eisenerze(?). In der
Halde können neben Ankerit und Siderit auch sehr eigenartige
Gesteine aus
Baryt und Quarz mit etwas Carbonat gefunden werden;
Bildbreite 5 cm.
Auch hier handelt es sich um extrem umgewandelte
Zechstein-Sedimente. Vom ursprünglichen Mineralbestand wie
auch von der sedimentären Struktur ist gar nichts mehr
vorhanden. Leider konnt auch hier der Gesteinsverband nicht
im Anstehenden studiert werden. Aufschlüsse sind nicht
vorhanden.
- Eisen- und Manganerze:
Eichenberg

Typisches Manganerz (schwarzer Romanèchit)
mit Eisenerz (brauner Goethit)
mit weißem Baryt wie es aus der Grube
Heinrich gefördert wurde,
Bildbreite ca. 8 cm.
Dieses Erz entstand aus der Verwitterung des vorher hier
gebildeten Siderits, der seinerseits aus dem Zechstein-Dolomit
hervor gegangen war. Typisch für solche Lagerstätten sind dann
noch in stark wechselnden Anteilen: Romanechit, Pyrolusit und
röntgenamorphe Manganoxide. Solche Eisen- und Manganerze sind im
Spessart weit verbreitet und sie waren auch das Ziel eines
lokalen Bergbaues; neben Eichenberg sind dies: Sommerkahl,
Schöllkrippen, Huckelheim, Bieber und vermutlich auch
Laufach.
- Tonsteine:
Aschaffenburg

Von weißen Baryt-Brocken durchsetzter, schwarzbrauner Tonstein
in der
Baugrube für die Liebig-Höfe an der Bavariastraße in
Unterschweinheim in
Aschaffenburg, Länge des Geologenhammers 40 cm,
aufgenommen am 17.07.2015.
Im Umfeld der Zechstein-Sedimente und der Baryt-Gänge finden
sich immer wieder stark Mangan- und Eisen-haltige Tonsteine. Sie
sind bergfrisch schmierig und färben hervorragend. Im
lufttrockenen Zustand sind diese sehr leicht und bröselig. Sie
enthalten meist Baryt und Reste von Dolomit bzw. Kalksteinen.
Vermutlich stellen diese Gesteine den Lösungsrest dar, der bei
der metasomatsichen Veränderung der Zechstein-Sedimente
entsteht. Die schokoladenbraune Farbe ist der Hinweis für das
Vorkommen, oft gebunden an tiefreichende Klüfte und Spalten.
Meist sind diese Gesteine sehr reich an Spurenelementen,
insbesondere auch an Schwermetallen wie Kupfer, Zink und
Arsen.
Nach dem derzeitigen Stand der Forschung sind
immer noch nicht alle Gesteine aus dem Anstehenden bekannt.
Infolge von Bauarbeiten kommen immer noch neue Belegstücke
hinzu, die das Wissen um diese merkwürdigen Gesteinsmassen
ergänzen und Lücken schließen.
Mit der hydrothermalen
Überprägung ist in der Regel auch Baryt abgeschieden worden. Diese
Fluide führten immer auch zu einer Zufuhr oder Mobilisierung mit
einer anschließenden Fixierung von Schwermetallen (in der Regel
Arsen, Kupfer, Blei, Zink), so dass diese Gesteine oder
Gangfüllungen immer aus der gegenwärtigen Sicht eine geogene
Belastung darstellen. Man kann also prognostizieren, wenn solche
Gesteine (gar in Verbindung mit Baryt) auf Baustellen anzutreffen
sind, dass dann auch die Kollission mit einer unsinnigen
Gesetzgebung bzw. mit anderen Regelwerken (z. B. LAGA-Liste)
vorprogrammiert ist. Beim Arsen können
die analysierten Werte erheblich sein und die Zuordnungwerte um
Größenordnungen überschreiten. Trotzdem besteht dabei für Menschen
keine Gefahr, weil die in Lösung befindlichen As-Ionen infolge des
hohen Ca- und/oder Mg-Spiegels, in Tonmineralien und am
Eisenoxiden sofort wieder fixiert werden
Verkieselter Zechstein-Dolomit im anstehenden Dolomit:
Bisher war es aufgrund der mangelnden Aufschlussverhältnisse
nicht möglich, einen verkieselten Zechstein-Dolomit im
Anstehenden zu studieren. Das änderte sich im Mai 2013, als
bei Hailer eine Baugrube für ein Verwaltunsgebäude im
Dolomit angelegt wurde (LORENZ 2014:17ff). Der unscheinbare
Aufschluss offenbarte verkieselte Partien im Dolomit:

Linsenförmiger Körper aus Quarzit, der durch Verkieselung
aus dem
Dolomit enstand. Die dunklen Partien sind reich an
Fe-Hydrxiden und
Mn-Oxiden, Bildbreite ca. 25 cm,
aufgenommen am 25.05.2013
Hier war einem wenig verfestigten Dolomit (teils als
"Dolomit-Aschen") erkennbar, dass Eisen- und Mangan in Form
dreidimensionler Dendriten (Goethit und Romanechit)
zugeführt worden war. Eine ca. 5 cm dicke und nicht
horizontbeständige Schicht ist mehr oder minder verkieselt.
Die Grenze zwischen hart (verkieselt) und weich (ohne Quarz)
ist auf ca. 0,5 bis 1 cm beschränkt. Stellenweise ist auch
eine ca. 5 bis 10 cm dicke Schicht mit Mangan- und
Eisenoxiden durchsetzt und zumindest teilweise verkieselt.
Diese Formen erinern an die Haldenfunde aus dem Raum
Bieber.
|
Literatur:
BURISCH, M., WALTER, B. F. & MARKL, G. (2017): Silification of
hydrothermal Gangue Minerals in Pb-Zn-Cu-Fluorite-Quartz-Baryte
veins.- The Canadian Mineralogist Volume 55, part 3, May 2017, p.
501 – 514, 5 figs., 1 tab., The Mineralogical Association of
Canada.
FISHER, J., LILLIE, R. & RAKOVAN, J. (2013): Fluorite in
Mississippi Valley-type Deposits.- Rocks & Minerals Vol. 88,
No. 1, Jan./Feb. 2013, p. 20 - 47, 56 figs., [Taylor & Francis
LLC] Philadephia.
GAIT, R. L., ROBINSON, G. W., BAILEY, K. & DUMKA, D. (1990):
Minerals of the Nanisivik Mine Baffin Island, Northwest
Territories.- The Mineralogical Record Volume 21, Number 6
November-December 1990, p. 515 - 534, 48 fig., [Mineralogical
Record Inc.] Tucson AZ.
GOLDSTEIN, A. (1997): The Illinois-Kentucky Fluorite
District.- The Mineralogical Record Volume 28,
Number 1 January-February 1997, p. 3 - 49, 89 fig., [Mineralogical
Record Inc.] Tucson AZ.
HIPS, K., HAAS, J. & GYÖRI, O. (2016): Hydrothermal
dolomitization of basinal deposits controlled by a synsedimentary
fault system in Triassic extensional setting.- International
Jouranl of Earth Sciences (GR Geologische Rundschau) Vol. 105,
Number 4, June 2016, p. 1215 - 1231, 13 figs., 3 tab., [Springer
Verlag] ohne Ort.
JAHN, G. (2017): Wüste, Meer und Lavafluten. Aus der Erdgeschichte
unserer Heimat zwischen Vogelsberg, Spessart und Rhön.- 428 S.,
328 meist farbige Abb., gebundene Ausgabe, [TRIGA - Der Verlag]
Gelnhausen.
KELKA, U., BEADOIN, N., LORENZ, J., KOEHN, D., REGENAUER-LIEB, K.,
BOYCE, A. & CHUNG, P. (2023): Zebra dolomites of the Spessart,
Germany: implications for hydrothermal systems of the European
Zechstein Basin.- International Journal of Earth Sciences
Geologische Rundschau Vol. 112, Number 8, November 2023, p. 2.293
– 2.311, 14 figs., [Springer Nature-Verlag] Berlin
Heidelberg.
KORSHINSKIJ, D. S. (1965): Abriß der metasomatischen Prozesse.-
195 S., 15 Abb., [Akademie-Verlag] Berlin.
KUZ´MIN, V. I. & SKOROBOGATOVA, N. V. (2000): Geological
Museum of the Vims.- p. 91 - 99, 18 figs.- in Mineralogical
Almanac Volume 3, 136 p., 136 color illustartions, 132
historical photos, [Ocean Pictures Ltd.] Moscow.
LORENZ, J. (2014): Die metasomatischen Gesteine im Spessart:
Dolomit, Siderit, Quarzit und Kalksteint.- Jahresberichte der
wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu
Hanau/gegr. 1808 163 - 164, Themenband Spessart, S. 11 -
32, 9 Abb., 2 Tab., Hanau.
LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte
Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 15, 27, 7 Abb..- in Karlsteiner
Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom
Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 576ff, 579ff,
673ff.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
SCHÜSSLER, H., SIMON, T. & WARTH, M. (2000): Entstehung,
Schönheit und Rätsel der Hohenloher Feuersteine.- 2. Aufl., 175
S., zahlreiche, teils farb. Abb. als Fotos, Skizzen, Karten und
Profile, [Verlag und Offsetdruck Eppe GmbH] Bergatreue.
STARKEY, R. E. (2022): Making it Mine. Sir Arthur Russel and his
Mineral Collection.- 426 p., 754 figs., [British Mineralogy
Publications] Worcestershire.
TAYLOR, R. (2009): Ore Textures. Recognition and Interpretation.-
288 p., zahlreiche farb. Abb., [Springer Verlag] Berlin
Heidelberg.
WAGENPLAST, P. (2004): Geologische Wanderungen in Andalusien:
„Zebrasteine“als Indikatoren für Blei- und Fluorit-Lagerstätten in
den Provinzen Almeria und Granada.- Der Aufschluss Jahrgang 55,
Heft 3 Mai/Juni 2004, S. 171 - 177, 8 Abb., VFMG e. V. Heidelberg.
WAGENPLAST, P. (2008): "Lombardische Diamanten" aus den
Bergamasker Alpen.- Der Aufschluss Jahrgang 59, Heft 4
Juli/August 2008, S. 253 - 255, 5 Abb., VFMG e. V. Heidelberg.
WERNER, P. (1981): Über einige Verwachsungserscheinungen an
Erzmineralien des Siegerlandes.- Der Aufschluss Jahrgang 32,
Heft Dezember 1981, S. 483 - 489, 7 Abb., VFMG e. V. Heidelberg.
WIMMENAUER, W. (1985): Petrographie der magmatischen und
metamorphen Gesteine.- 382 S., 297 Abb., 106 Tab., [F. Enke
Verlag] Stuttgart.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite