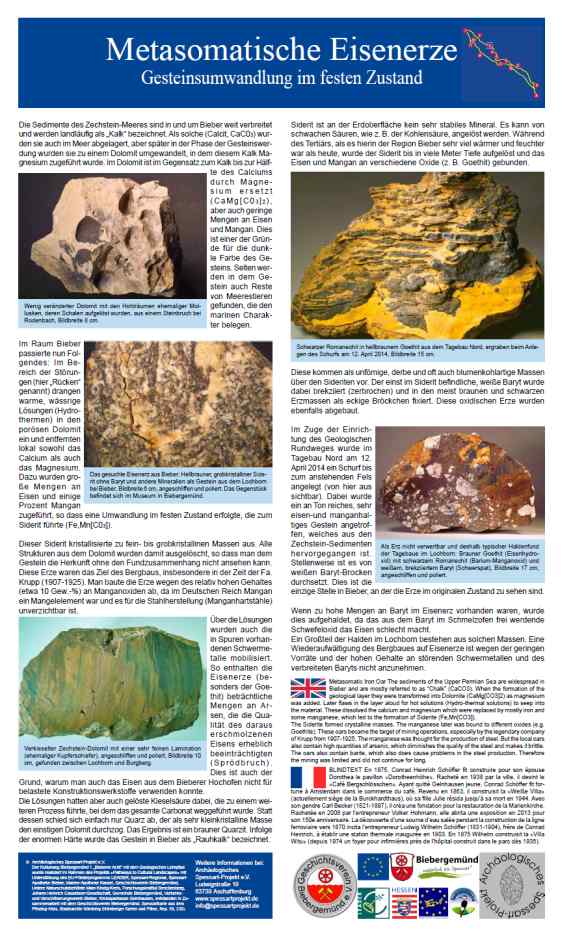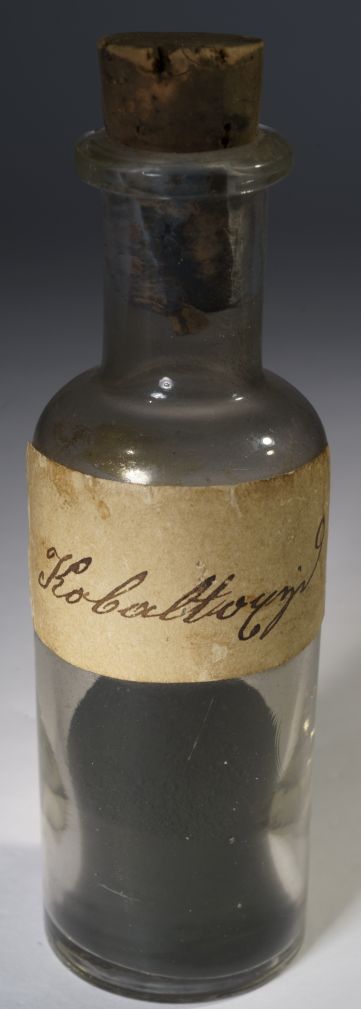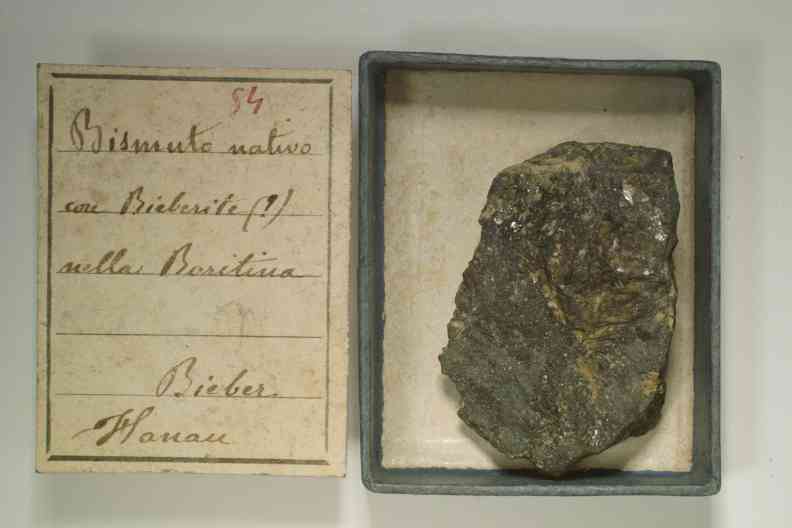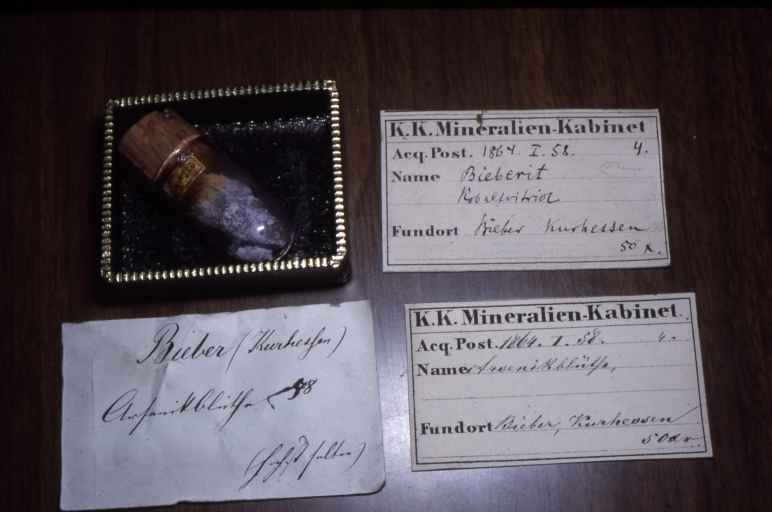Der historischen Bergbau auf die
hydrothermalen Co-Ni-Bi-Gänge, den Kupferschiefer des Zechsteins
und die karbonatischen bis oxidischen Fe-Mn-Vererzungen
von Bieber im Spessart
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main
Wichtiger Hinweis:
Der Bergbau auf die Silbererze des Kupferschiefers wurde 1807, der
auf die Kobalt-Erze wurde 1867 und auf Eisen-(Mangan)-Erze wurde
1923 eingestellt. Infolge der seit langem anhaltenden
Sammelaktivitäten sind die wenigen Halden außerhalb des
Naturschutzgebietes im Lochborn abgesucht. Infolge der hohen
Niederschläge sind alle empfindlichen Phasen in den Halden
zumindest angelöst, wenn nicht bereits zerstört.
Es versteht sich von selbst, dass ein Sammeln innerhalb des
Naturschutzgebietes im Lochborn ausdrücklich verboten ist!

Mit Bäumen bestande Halde um eine Schachtpinge
im Lochborn bei Bieber,
aufgenommen am 11.10.2008

Zur Pflege der Wiesen im Lochborn werden auch
Ziegen eingesetzt, so dass die
Flächen nicht verbuschen; dies ist einer der Ziele des
Naturschutzes*,
aufgenommen am 11.10.2008
Zusammenfassung
Der vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert anhaltende Bergbau in
um um Bieber) (heute ein Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd im
hessischen Teil des Spessarts östlich von Gelnhausen) war
insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert weit über die Grenzen
bekannt (siehe Okrusch et al. 2011, S. 283ff, Aufschlüsse Nr. 263
- 271).
In die Mineralogie unauslöschlich eingegangen ist der Mineralname
Bieberit, der nach dem Ort von hier beschrieben worden ist. Ebenso
stammt das Mineral Rösslerit auch aus Bieber, so es die
Typuslokalität für das Mineral ist.
Sehr ausführliche Schilderungen zur lokalen Geologie des bieberer
Raumes und zum Auftreten der Erze auf den hydrothermalen Gängen
finden sich bei BÜCKING (1891 und 1892) DIEDERICH &
LAEMMLEN (1964) und DIEDERICH (1969). Leider gibt es keine
neueren, umfassende geologisch-mineralogische Beschreibungen.
In und um Bieber wurden drei verschiedene Bergbaue betrieben,
sich deutlich unterschieden lassen:
Es ist schriftlich belegt, dass im Mittelalter ein Abbau des
Kupferschiefers begonnen wurde. Dabei baute man eine wenige cm bis
einige dm dicke Schicht eines schwermetallhaltigen
Zechsteinsedimentes ab, welches flächendeckend des
Zechstein-Dolomit unterlagert. Gehalte der Metalle liegen maximal
bei ca.: 0,7 % Kupfer, 2,4 % Blei, 1,7 % Zink und 0,007 % Silber.
Dieser Bergbau erzeugte ein weites aber sehr niedriges
Stollensystem, welches unter kaum vorstellbaren Arbeitsbedingungen
erzeugt wurde. Das gesamte geförderte Gestein wurde gepocht und
mit Flussmitteln aufgeschmolzen; in einem komplexen Prozess gewann
man hauptsächlich Kupfer, Blei und in geringen Mengen Silber. Die
Ausbeute war insgesamt gering und deshalb wurde der Abbau bereits
1807 eingestellt.
(Ausbeute-)Taler des Landgrafen
Wilhelm IX von 1791 mit dem Hinweis auf der Rückseite über dem
Wappen: "Bieberer Silber".
Taler aus Bieber, Ausbeutetaler (oder Ausbeutemünze, auch
Bergbauprägung, hier auch Bieber-Taler genannt) aus dem Silber von
Bieber aus dem Jahre 1791, geprägt in der Münze von Hanau. In der
Zeit von 1754 bis 1802 wurden ca. 40 verschiedene Varianten
gestaltet, die sich machmal nur sehr gering unterscheiden. Allen
eigen ist der textliche Hinweis auf die Verwendung von Silber aus
Bieber. Von den einst ca. 40.000 geprägten Halb- und Talern sind
nur noch geringe Bestände vorhanden. Sie werden heute zu recht
hohen Preisen nahezu ausschließlich auf Münzauktionen gehandelt;
je nach Erhaltungszustand und Jahrgang muss man zwischen 300 und
12.000 € dafür bezahlen! Manche sind so selten, dass diese in 15
Jahre nicht angeboten werden.


Schachtpinge im Lochborn mit einer
Erläuterungstafel des Kulturrundweges (Bieberer 8), der von
Bieber bis zum Wiesbüttsee
verläuft - man folge dem Schild wie rechts abgebildet.
aufgenommen am 11.10.2008
Im 18. Jahrhundert begann man, die gangförmigen, hydrothermalen
Cobalt-Nickel-Bismut-Gänge zu erschürfen. Dabei wurden lange
Stollen angelegt und der gesamte Ganginhalt gewonnen. Das von Hand
ausgelesene Erz wurde zerkleinert und zu Blaufarben für die
keramische Industrie verwandt. Dieser Bergbau, den Bieber in der
Geologie und Mineralogie bekannt werden ließ, stellte man 1867
ein.
Durch Funde nicht belegt, aber sehr wahrscheinlich ist die
Eisenerzgewinnung bereits zu vorrömischer Zeit (der spätere
flächenmäßig sehr unfngreiche Bergbau hat dabei sicher alle
früheren Spuren getilgt). Sporadisch wurden Eisenerze sicher zu
allen Zeiten um Bieber gewonnen und wohl auch verhüttet. Der
großmaßstäbliche Abbau des Siderits mit einer gesamten Fördermenge
von ca. 1,9 Millionen t begann im 19. Jahrhundert und wurde 1923
eingestellt. Grund dafür waren neben wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen auch die hohen Gehalte an Arsen
(bis ca. 1 Gew.-%!), die bereits in geringen Mengen einen
Sprödbruch des Eisens bewirken. Man gewann die Erze vor allem
wegen des hohen Gehaltes an Mangan, welches den Stahl
verschleißfest macht. Das As wurde durch Zugabe von As-armen
Eisenerzen auf ein verträgliches Maß reduziert.
Es sind aus allen drei Bereichen noch abbaubare Vorkommen
vorhanden. Infolge der nach heutigen Maßstäben geringen Vorräte
(“Rucksacklagerstätte“), der damit verbundenen Kosten für
Umweltauflagen, der schlechten Qualität der Erzmittel und der
immer noch raltativ niedrigen Metallpreise ist ein
Wiederaufwältigen der Abbau nicht denkbar. Da Kobalt in Zukunft
ein sehr gesuchtes Metall sein wird, könnte eines fernen Tages
wieder ein Bergbau begonnen werden. Eine Tonne Cobalt als Metall
kostet derzeit ca. 27.000 € - dagegen ist Baustahl mit ca. 450 €
geradezu billig.
Für die Abfuhr der Eisen- und Manganerze wurde eine Eisenbahn
erbaut, die bis in die 1950er Jahre betrieben wurde. Die Bahn
verlief von Gelnhausen nach Bieber und hier bis zur Lochmühle. Von
den Anlagen ist kaum mehr etwas vorhanden, lediglich der Bahndamm
ist über weite Strecken noch zu sehen. Auch einzelne Gebäude der
Bahnhöfe sind noch vorhanden. Martina WEIBEZAHN aus Bieber plant
eine Veröffentlichung über die Spessartbahn, für die Aktien heraus
gegeben wurden.
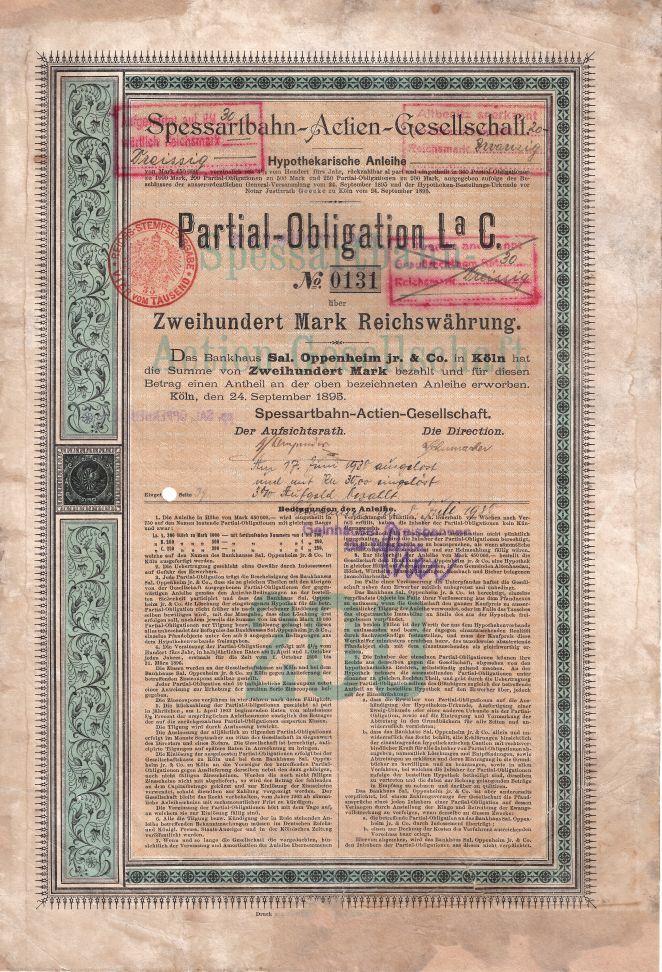
Aktie der Spessartbahn AG von 1895 über
200 Reichsmark.
Geologisch-bergbaukundliche
Erweiterung des Kulturrundwegs der "Bieberer Acht":
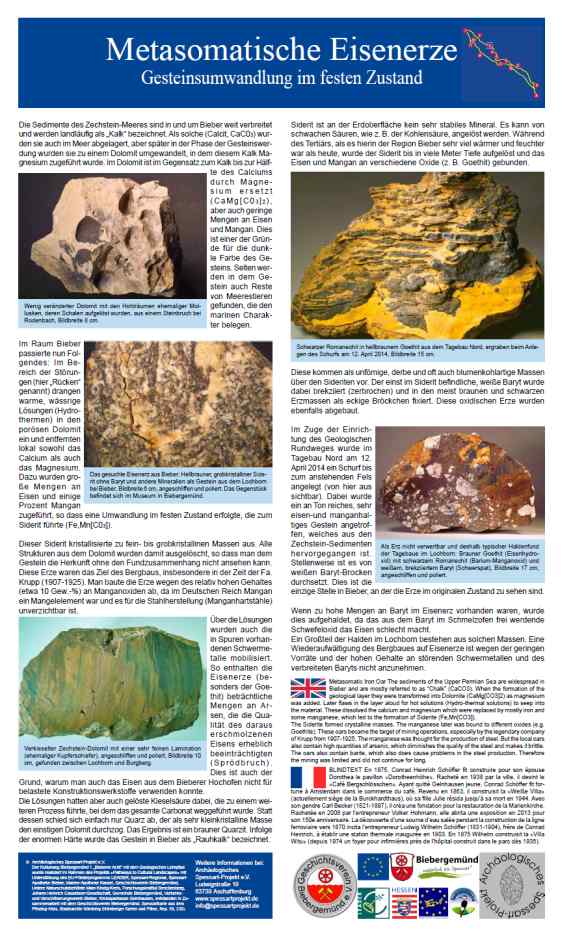
Neue Tafel am Tagebau Nord
Der bestehende Kulturrundweg "Bieberer Acht" wurde 2014 um einige
Stationen erweitert. Insbesondere liegt der Schwerpunkt auf der
Geologie und der damit verbundenen Auswirkungen: Bergbau,
Hüttenwesen und die Rohstoffe. Dabei wurden auch vorhandene Tafeln
des Bestandes aktualisiert und und teilweise ausgetauscht. Die
erzbildenden Prozesse der 3 Lagerstättentypen sind im Detail sehr
komplex und können nur schwer auf einer Tafel so erläutert werden,
dass das Nachvollziehen für Laien leicht möglich ist. Später soll
es dazu ein Begleitheft geben, welches dem Besucher einen
vertiefenden Hintergrund vermittelt.
Für den die thematische Erweiterung wurden weder Kosten noch
Mühen gescheut. Das Stollenmundloch des Bertha-Stollens wurde
nachgebaut.

Unweit der Schmelz lag das Stollenmundloch des
Bertha-Stollens,
aufgenommen am 10.04.2009.
Im Herbst 2012 wurde seitens der Gemeinde in Zusammenarbeit mit
dem Geschichtsverein Biebergemünd versucht, das Mundloch des
Stollens mit Hilfe eines Baggers so weit zu öffnen, dass man in
den Stollen einblicken kann. Der Erfolg blieb leider aus, da wegen
einiger Bäume eine Freilegung nicht erfolgen konnte. Deshalb legte
man in Richtung des Stollens einen Graben an, der einen eichenen
Türstock bekam und dann mit einer Tür gesichert werden wird.


Der neu eingebaute Türstock nahe am Mundloch des
ehemaligen Berta-Stollens in Bieber an der Straße Zum Burgberg,
aufgenommen am 22.12.2012 (Panoramafoto). Der
eigentliche Stollen verläuft wenige Meter weiter nördlich und
mündet in den Garten des Hauses links
Da bisher keine Eisenerze im Anstehenden zu sehen waren, wurde mit
einem Bagger eine Böschung im Tagebau Nord frei geschürft, so dass
man hier die unscheinbaren Eisen- und Mangenerze sehen kann.

Die Mitglieder des Geschichtsvereins nach
schweißtreibender getaner Arbeit: Josef
ACKER, Siegfried EMRICH, Peter NICKEL und der virtuose
Baggerfahrer Dieter
BECKER
am 12.04.2014.


Ergebnis der Baggeraktion:
Typisches Mangenerz aus Romanechit (schwarz) mit Baryt (weiß)
und Goethit (braun) aus der frei gebaggerten Stelle im Tagebau
Nord, angeschliffen und poliert, Bildbreite
links 8 cm, rechts 10 cm. Das Erz mit dem reichlichen Baryt kann
nicht verwendet werden, weil der Baryt im Schmelzofen stören
würde. Aus diesem Grund wurden solche
Stücke auf die Halde geworfen und nicht abgefahren.
Die Eröffnung
war für den
Sonntag, den 12. Oktober 2014 um 14 Uhr
vorgesehen.
Der Treffpunkt befand sich am alten Rathaus (unweit des
Museums) Am Plaster 4, 63599 Biebergemünd Ortsteil Bieber.

Die Teilnehmer der Erstbegehung am
12.10.2014 im schattigen Tagebau Nord ca. 200 m vor der
Burgbergkapelle.
Für die Zukunft bleit das Ziel, dass man in einem anderen Tagebau
den bekannten Eisenstein (Siderit) frei schürft, was aber nur
innerhalb des Tagebaues möglich ist. Das Problem ist dabei, dass
dies nur innerhalb des Naturschutzgebietes möglich wäre, wo
verschiedene Interessenssphären - Biologie versus Geologie - auf
einander treffen. Da innerhalb des Naturschutzgebietes keine
Erhaltungsmaßnahmen stattfinden, wird das Gelände weiter zuwachsen
und somit seinen Charakter verlieren, so dass die Schutzwürdigkeit
abnehmen wird - siehe Text weiter unten.
Links: Das berühmteste Erz aus
Bieber, der "Speiskobalt": Skutterudit-Kristalle in
einer Kombination zwischen Würfel und Oktaeder, partiell
überkrustet von kleinsten Siderit-Kristallen
Bildbreite 1 cm.
Mitte: Nach dem Rösten des Skutterudits erhält man ein schwarzes
Pulver aus "Kobaltoxyd" (heute Kobaltoxid), hier in einer
verkorkten Flasche, wohl um 1900;
Bildbreite 3,5 cm.
Rechts: Das tiefblaue Produkt, welches man aus dem Kobaltoxid
herstellte: Smalte, ein Kalium-Kobalt-Silikat als Glas,
hier als Pigment für das Herstellen
einer Farbe in einer Kuststoffflasche (Kremer Pigmente,
Aichstetten),
Bildbreite 4,5 cm.
Lage
Die Gewinnungsstellen der Erze lagen um die Orte Rosbach, Bieber,
Gassen und Röhrig verteilt. Sie gehören heute alle zur Gemeinde
Biebergemünde. Ein Großteil der Spuren ist überbaut oder durch die
landwitschaftliche Nutzung verschwunden.
Geologie
Im Raum Bieber stehen innerhalb des weitläufigen
Buntsandstein-Spessarts Schollen des Zechsteins und des darunter
liegenden Grundgebirges aus metamorphen Gesteinen (sehr
gleichförmige, glimmerreiche Paragneise mit ±Staurolith) an
(“Bieberer Fenster“).
Das gesamte Gebiet ist von zahlreichen Störungen durchzogen. Die
Sprunghöhe der Verwerfungen werden mit ca. 10 - 70, teilweise bis
130 m angegeben. Auf vorwiegend herzynisch streichenden Klüften
und Gängen wurden aus hydrothermalen Lösungen buntmetallreiche
Erze ausgeschieden ("Kobaltrücken")). Sie stehen im Gneis
und halten bis in den Zechstein und in den Bröckelschiefer durch.
Die überwiegende Gangmasse besteht aus Siderit und Baryt, in denen
sich die begehrten Co-, Ni-, Bi- und Cu-Erze fanden. Die mittlere
Mächtigkeit der Gänge von 0,65 m (gewöhnlich 0,15 - 1,50 m) konnte
bis zu 6 m anschwellen. Sie konnte jedoch auch nur wenige mm stark
sein! In nur wenigen Fällen bestand die gesamte Gangfüllung aus
Co- oder Nickelerzen (FREYMANN 1991). Die Erzführung war insgesamt
jedoch sehr ungleichmäßig. Nur in den mittleren Teufen und an
Scharungsstellen waren die Gänge „edel“ (BÜCKING 1892). Im
Streichen konnten die größten Gänge bis zu 2,4 km verfolgt werden.
Folgende Kobaltgänge wurden im Raum Bieber gefunden und teilweise
auch abgebaut (nach FREYMANN 1991):
1. Büchelberger Kobaltgang, 90°, 45-80° NE, 27 m, ~1790-1867
2. Büchelberger Kobaltgang, 150°, ?, ?, ~1790-1867
3. Büchelberger Kobaltgang, ?, ?, ?, -
1. Lochborner Kobaltgang, 135-150°, 55° NE, 7-24 m, 1748-1850
2. Lochborner Kobaltgang, herzynisch, 50-70° NE, ?, -
3. Lochborner Kobaltgang, herzynisch, 40-60°, ?, -
4. Lochborner Kobaltgang, 120°, SW, ?, nach 1780-1867
5. Lochborner Kobaltgang, 150°, SW, 20-38 m, nach 1780-1867
1. Röhriger Kobaltgang, 120-165°, 57° NE, >4 m, 1731-1800(?)
2. Röhriger Kobaltgang, 120-165(180)°, 57° NE, >4 m,
1731-1800(?)
Über dem Metamorphikum konnten früher noch wenig verfestigte
Sedimente des Rotliegenden festgestellt werden. Die Schichtenfolge
des Zechsteins erreicht hier bis zu 45 m. Sie sind als Mergel,
dolomitische Kalk-, calcitische Dolomit-, Schluffsteine und Tone
ausgebildet. Die liegenden Schichten des Zechsteins führen den
metallreichen Kupferletten, die tonige Form der Kupferschiefers
sedimentären Ursprungs. Der feinkörnige „Letten“ besteht nach
FREYMANN (1991) aus Quarz, Glimmer, Calcit, Dolomit, Illit,
Kaolinit, Chlorit, erdiger Baryt, Fe-Mn-Mineralien und bitumöse,
organische Bestandteile (0,3 - 5,4 %). Die wirtschaftlich
interessanten Erzmineralien (Korngröße 0,002 - 0,3 mm) sind darin
feinst verteilt und bestehen aus Pyrit, Markasit, Arsenopyrit,
Tennantit, Chalkopyrit, Arsenkies, Galenit und Sphalerit. In den
oberflächennahen Bereichen kommen „Kupferglanz“, Covellin,
Cerrusit, Azurit und Malachit hinzu.

Kupferschiefer in plattiger Ausbildung an einer
Schachtpinge im
Lochborn
aufgenommen am 11.10.2008
Lokal enthält der Zechstein-Dolomit metasomatische
Fe-Mn-Vererzungen, meist Siderit (teils in oxidische Mineralien
umgewandelt: Goethit, Pyrolusit, Romanèchit, Lepidokrokit) in den
verkarsteten Zonen, die teils hydrothermal überprägt sind. Sie
erreichen Mächtigkeiten von 2 - 25 m. Das Auftreten von Baryt, die
geringen Gehalten an Buntmetallerzen und das verstärkte Auftreten
der Erze entlang der Störungen weisen auf eine gemeinsame Genese
der Erze hin. Eine Beeinflussung des Kupferschiefers kann dabei
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Massiver bis erdiger Goethit mit brekziösem
Baryt,
Bildbreite ca. 10 cm
Darauf folgt wie oft im Spessart die Bröckelschieferfolge mit dem
unteren Buntsandstein aus Gelnhausen- und Salmünster-Folge aus
feinkörnigen Sandsteinen. Untergeordnet finden sich in der
Umgebung kleine Durchbrüche basaltischer Magmen, die ebenfalls
Ziele eines bescheidenen Steinabbaues (Beilstein, Hoher Berg,
Madstein) waren. Unter den jüngsten Zeugnissen geologischer
Veränderungen ist das fast rezente Niedermoor am Wiesbüttsee zu
erwähnen, weil aus ihm bedeutende Beiträge zur Wald- und
Besiedlungsgeschichte des Spessarts gewonnen werden konnten.
Die meisten der durch den jahrhundertelangen Bergbau recht
zahlreich geschaffenen Aufschlüsse (wie bei DIEDERICH &
LAEMMLEN 1964 aufgeführt) sind seit langem aufgelassen und deshalb
verwachsen, verschüttet oder inzwischen überbaut.
Im Bereich des Bergbaugebietes sind an vielen Stellen steile,
recht frisch erscheinende Pingen zu finden, die sicher örtlich von
Zeit zu Zeit nachbrechen. Es muss auch obertägig ständig mit
Einstürzen gerechnet werden, wie zuletzt im oberen Lochborn, wo am
27. oder 28.12.1998 auf dem ehemaligen Bahndamm zwischen oberem
und unterem Maschinenschacht ein ca. 2 m großer, frischer
Einsturztrichter gefunden werden konnte.

Die Burgberg-Kapelle mit Kirchhof und
Umfassungsmauer am Burgberg bei Bieber,
aufgenommen am 11.10.2008
Historie
Über die bergbaulichen Aktivitäten liegen zahlreiche Schriften
vor, die größtenteils noch erhältlich sind (FREYMANN 1991, HOFMANN
1969, Autorenkoll. 1994, CANCRIN 1787, DIEDERICH & LAEMMLEN
1964 und BACKHAUS & WEINELT 1967) weshalb hier auf eine
Beschreibung verzichtet wird.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass das Blaufarbenwerk wie auch
die Bergwerke in der napoleonischen Besatzungszeit an die
Schwester Pauline (oder Paulina; die Paris Hilton dieser Zeit) von
Napoleon Bonaparte vergeben wurden, so dass die Einkünfte ihr
zuflossen (BERINGER & NICKEL 2012).

Der Lochborner Teich war über Jahre trocken, so
dass Erlen wuchsen. Mit dem
Wiederfüllen vor ca. 20 Jahren starben die Erlen ab und die
Stümpfe ragen aus dem
Wasser.
aufgenommen am 11.10.2008
Die umfangreichen und aus neuerer Zeit volumniösen Halden und
andere an den Boden gebundene Zeugen des Bergbaues
(Stollenmundlöcher, Pingen) sind meist reich an wenn auch fein
verteiltem Erz. Alle bergbaulich interessanten Gangfüllungen und
Erze enthalten typischerweise deutliche As-Gehalte. Diese Erze
verwittern recht leicht unter den gegenwärtigen Bedingungen und
sind heute Quellen eines bedeutenden As-Eintrages in die Gewässer.
Dies wurde beispielsweise am Schwarzbach im Lochborn von TUROWSKI
(1998) untersucht und ausführlich beschrieben. Die Wässer des
Schwarzbaches erreichen Arsen-Gehalte nach längeren Trockenzeiten
bis zu 0,28 mg/l Bachwasser. Infolge der Größe der Halden und des
Verwitterungsgrades der Erze ist mit einem Eintrag zu rechnen, der
sicher noch hundert Jahre anhalten wird.
Einst befand sich in der Region die wohl bedeutendste, ehemalige
Forschungsstelle für Mittelgebirge, unterhalten vom Naturmuseum
Senckenberg in Frankfurt. Dazu werden die Räumlichkeiten des
früheren Bahnhofes der Eisenbahn genutzt, die das Eisenerz nach
Gelnhausen brachte. Infolge der schlechten Erreichbarkeit wurde
die Forschungsstelle von der Lochmühle nach Gelnhausen verlegt.
Der Forschungsschwerpunkt hat sich auch mit verlagert, denn in
Mittelgebirgen forscht man nicht mehr.
Der Bergbau von Bieber findet sich auch in den sehr bekannten
Grimm´s Märchen wieder. So beschreibt RUF (1995) ausführlich,
warum man heute davon ausgehen kann, dass es sich bei den sieben
Zwergen in dem Märchen vom Schneewittchen um Bergleute aus Bieber
handeln kann! Und das GRIMM´sche Schneewittchen lebte im
Mittelalter in Lohr, wo sich auch die Kurmainzische
Spiegelmanufaktur befand.

In der Ortslage von Bieber und Umgebung sind
an einigen Stollenmundlöchern und
historisch bedeutsamen Orten Tafeln aufgestellt worden, die
Erläuterungen geben.
Sie stammen noch aus der Zeit von Ernst-Ludwig HOFMANN,
aufgenommen am 19.08.2017
Über lange Zeit gab es in Bieber eine Hütte, in der die Erze zur
Metallgewinnung geschmolzen wurden. Davon gibt es kaum mehr
dingliche Reste. Hin und wieder werden Schlacken gefunden, die
aber nur schwer einem bestimmten Prozess zugeordnet werden können.
Infolge des lang anhaltenden Bergbaues und der damit verknüpften
Verhüttung ist es ohne aufwändige Untersuchungen kaum möglich nach
Form und Farbe zu urteilen.

Porzellanartige, blasenarme Schlacke mit
rundlichen, sphaerolithischen kristallinen
Bestandteilen und wenigen kleinen metallischen Körnchen als
Lesefund auf einem
Acker südlich von Röhrig. Der Prozess, der zur Bildung dieser
Schlacke führte, ist
nicht bekannt. Dies ernthält sehr viel BaO.
Bildbreite 7 cm
Mineralien
Die wenig attraktiven Belegstücke aus dem Kupferschieferbergbau
sind heute nur einem sehr geringen Umfang vorhanden. Auch aus dem
Bergbau auf die Eisenerze liegen wegen der geringen Attraktivität
und da aus vielen ähnlichen Fundstellen bessere Stücke vorhanden
waren, kaum Belegstücke vor.
Zum Zeitpunkt des aktiven Bergbaues auf die Cobalt-Nickelerze
wurden bereits international Mineralien gehandelt. Die damals noch
junge Wissenschaft der Mineralogie entstand als Oryktognosie in
Mitteleuropa und deshalb finden sich in fast allen alten
Sammlungen der Universitäten und Museen sehr wenige Belegstücke
aus Bieber; so auch in der Sammlung von J. W. von GOETHE in
Weimar! Die wohl beste und umfangreichste Mineraliensammlung war
die der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu
Hanau, deren Sammlung im Bombenhagel auf Hanau 1945 verbrannte.
Reiches Belegmaterial findet sich in den alten großen Sammlungen
Mitteleuropas, so z. in Berlin, Göttingen, Bonn, Wien
(Österreich), Strasbourg (Frankreich), London (Großbritannien),
München, Würzburg und in vielen anderen Sammlungen auch, so z. B.
Aschaffenburg, Wiesbaden, ....
Die primären Erze in Bieber bestehen aus den Gangarten Siderit
und Baryt, selten Calcit (Ca[CO3]) und etwas Quarz,
darin eingewachsen sind die Erzmineralien (nach WAGNER &
LORENZ 2002):
Alloklas ((Co,Fe)AsS)
Bismuthinit (Bi2S3)
Chalkopyrit (CuFeS2)
Cobaltit ((Co,Fe,Ni)AsS)
Emplektit (CuBiS2)
Galenit (PbS)
Gersdorffit ((Ni,Co,Fe)(As,Sb)S)
Löllingit (FeAs2)
Maucherit (Ni11As8)
Nickelin (NiAs)
Nickelskutterudit ((Ni,Co,Fe)As2-3)
Orthogersdorffit ((Ni,Co,Fe)(As,Sb)S)
Rammelsbergit (NiAs2)
Safflorit ((Co,Fe)As2)
Skutterudit (CoAs2-3)
Tennantit ((Cu,Fe)12As4S13)
gediegen Wismut (Bi).
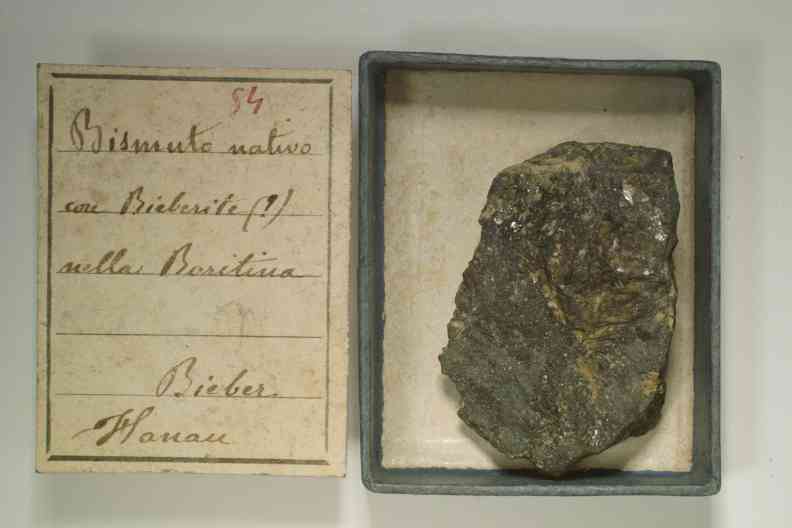
Gediegen Wismut im Siderit (nicht wie auf dem sehr
alten Zettel angegeben im Baryt!)
und auch ohne Bieberit,
Bildbreite 8 cm.
Einige Bilder
von den oben aufgeführten Mineralien aus dem Raum Bieber
finden Sie auf der nächsten Seite.
In GOLDSCHMIDT´s Atlas der Kristallformen finden sich mehrere
Abbildungen von idiomorphen Kristallen des ged. Wismut aus
Bieber (Band 9 , Tafel 48, Fig. 1, 3-6). Auch bei HINTZE
(1904:124) wird das sonst nicht so häufge Mineral „auf Gängen im
Glimmerschiefer mit Speiskobalt, Kobaltblüthe, Rothnickelkies,
Eisenspath und Baryt krystallinische Partien und ausgebildete
Krystalle;“ aufgeführt.
In dem sehr bekannten erzmikroskopischen Standardwert von RAMDOHR
(1975:411) wird in Abb. 318 ein Einschluss von ged. Wismut in
rissigem Skutterudit abgebildet. Das ged. Wismut zeigt die gleiche
Anomalie beim Schmelzen wie das Wasser - es zieht sich beim
Schmelzen zusammen, so dass es beim Erstarren sich ausdehnt. so
können die abgebildeten Risse, ausgehend vom Bismut, im massiven
Skutterudit gedeutet werden. Das Mineral kann deshalb auch als
mineralogisches Thermometer verwendet werden.
Diese Erzmineralien wurden oberflächennah, zum Teil in den alten
Stollen und auf den wenigen Halden in meist farbige
Sekundärmineralien umgewandelt:
Annabergit (Ni32+[AsO4]2·8H2O)
(wobei der grüne Annabergit als sehr selten gelten kann),
Bieberit (CoSO4·7H2O),
das Mineral wurde hier in Bieber zuerst gefunden (als
"Kobaltvitriol") und aus diesem Grund nach dem Fundort benannt
(Typuslokalität).
Rosafarbener Bieberit als erdige
Massen in einer verkorkten Glasphiole, Sammlung des
Naturkundemuseum in Wien,
aufgenommen am 23.08.1999
Bieberit ist und war schon in Bieber im 19. Jahrhundert sehr
selten. Die meisten "Bieberite" in den Mineralien-Sammlungen
erwiesen sich bei einer genauen Analyse als Erythrin. Bieberit ist
sehr empfindlich, weil wasserlöslich und deshalb auf den Halden
kaum zu finden. Heute existieren nur noch wenige, wirkliche
Bieberit-Proben aus Bieber in den (öffentlichen) und wohl nur ganz
selten in privaten Sammlungen. Ein Hinweis, dass es sich
tatsächlich um Bieberit handelt, sind Phiolen aus Glas und ein
Grundgestein aus Kristallin.


Links: Erythrin-Krusten als tpischer Haldenfund
aus dem Lochborn bei Bieber,
Bildbreite 2 cm
Rechts: Detail einer solchen Kruste aus kleinen, tiefroten
Kriställchen - ehemals Sammlung Albrecht VORBECK(†),
Bildbreite 3 mm.
Erythrin (Co32+[AsO4]2·8H2O),
Jarosit (KFe33+[(OH)6/(SO4)2]),
Pharmakolith CaH[AsO4]·2H2O),
Pikropharmakolith (Ca4Mg[AsO3(OH)/AsO4]2·11H2O),
Rösslerit (MgH[AsO4]·7H2O
- hierfür ist Bieber dieTyplokalität)
und viele weitere.
Gemenge solcher Phasen wurden früher als "Erdkobalt"
bezeichnet.
Leider konnte bis heute in keiner Sammlung - oder auch auf einer
Halde - ein nachweislicher Rösslerit von Bieber gesichtet werden
(LORENZ 2010:401ff). Alle Bemühungen sind gescheitert, so dass man
davon ausgehen muss, dass auch das Typmaterial verschollen ist.

Farblose bis weißliche Kristalle aus Rösslerit,
gefunden um 1970 im Jachymov, CZ
(Erzgebirge),
Bildbreite 5 mm.
Das Mineral ist selten. Diese Kristalle des kleinen Stückes
waren in einer Ausstellung
"Do it yourself" in Frankfurt, Berlin und bis 2013 in Dortmund
zu sehen.
Eine anekdotische Besonderheit ist der verbreitete und sehr
giftige Arsenolith (As2O3; ebenfall als
Neubildung auf alten Erzen und Bestandteil der "Erdkobalte"), von
dem Hanauer Chemiker Johann Heinrich KOPP (1807) schreibt:
„ ...sehr weich; leicht zersprengbar und besitzt einen
zusammenziehenden Geschmack. Auf einer Eisenplatte verdampft
es gepulvert vollkommen unter starkem Rauche. Auf glühende Kohlen
gestreut gibt es einen, nach Knoblauch riechenden, Rauch von
sich.“
Er hat es überlebt, denn er schrieb später weitere Beiträge und
starb im hohen Alter (*1777 †1858).
Achtung!
Nepper, Schlepper, Bauerfänger:
72,80 € für einen WIKIPEDIA-Ausdruck!?
Ja, so was gibt es.
Wenn Sie bei ebay nach Bieber-Mineralien suchen, finden Sie an
erster Stelle:
"Neu-Buch: Albin Schwab - MINERALIEN aus dem Bergbaugebiet
von Bieber i. Spessart."
Und wenn Sie jetzt denken, dass Sie dann etwas erhellendes
mit einem Bezug zu Bieber bekommen, dann erhalten Sie nach ein
paar Wochen ein extra gedrucktes Buch von PediaPress aus
Limburg, ohne, dass darin irgendetwas über Bieber steht, was Sie
hier auf der Seite nicht schon gelesen haben (außer die Liste
der Mineralien, die von hier kopiert wurde):
Es ist im Format A5 auf einfaches Kopierpaier (80 g/m²)
gedruckt, hat einen flexiblen (dünnen) lackierten Einband, ist
einfachst zusammen geleimt und enthält am Ende ein
(computergeneriertes) Inhaltsverzeichnis. Sie können dann 50 mal
"Formeleinheit" nachschlagen. Von den 251 Seiten erhalten Sie 18
Seiten Inhaltsverzeichnis, 10 Seiten Endnoten und
Internet-Quellen. Es sind einfach Ausdrucke von WIKIPEDIA, die
selbst mit dem dort vorhandenen Layout übernommen wurden. Samt
Fotos und Kommentare wie Fußnoten usw. Die meist kleinen Bilder
sind meist schlecht bis sehr schlecht (S. 12, 26, 40, 63, 93,
113 135, ...) oder verpixelt (S. 11, 56, 78, 99, 62, 120, 131,
...), wenn die Auflösung für den Druck nicht reichte. Herr
SCHWAB nennt sich "Editor" und druckt als Legitimation für die
Kopien seitenweise englisches "Kleingedrucktes" ab. Der Abruf
war 2015.
Wenn Sie die aus Bieber bekannten Mineralien in WIKIPEDIA
aufrufen, bekommen Sie das Gleiche, aber besser und sogar
aktuell.
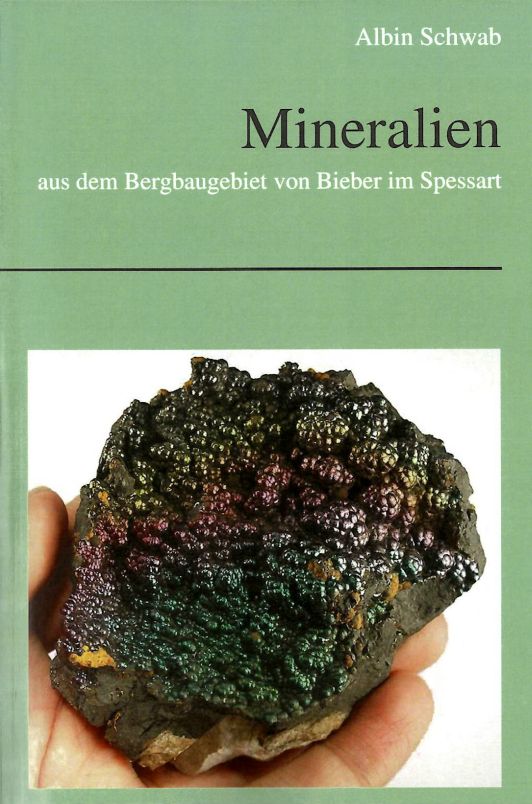
Das Stück könnte von Bieber sein, stammt aber
der Goethit stammt aus den USA (s. S. 97).
|
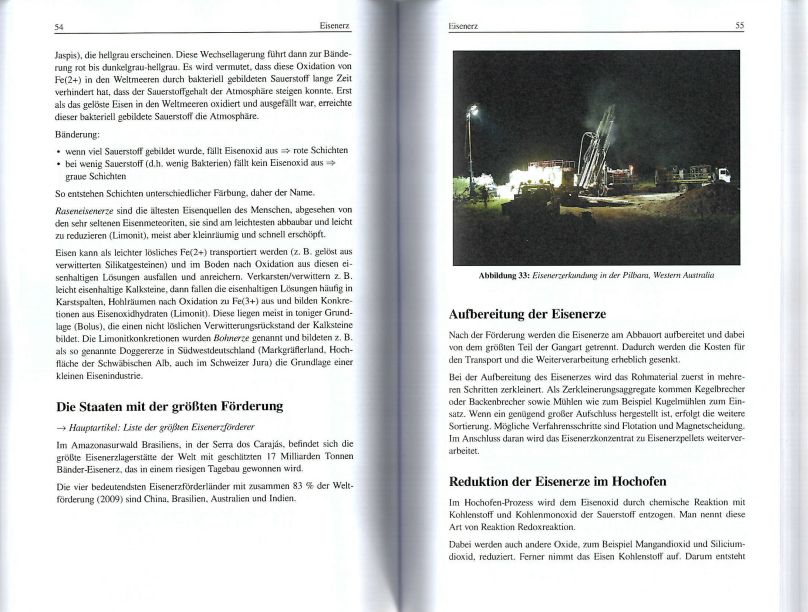
Dass man Eisenerz auch in Australien pros-
pektiert, ist für Bieber sicher nicht relevant.
|
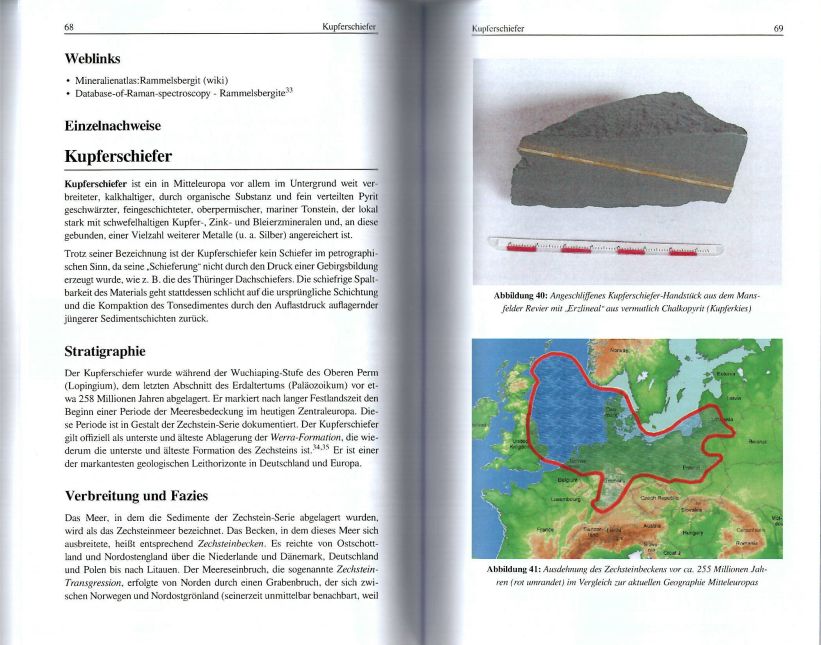
Es ist ein schöner Beitrag zum Kupferschiefer,
in dem auch Bieber aufgeführt wird, weil es in
WIKIPEDIA steht. Es ist eine der wenigen
Stellen an denen das Wort Bieber erscheint.
|
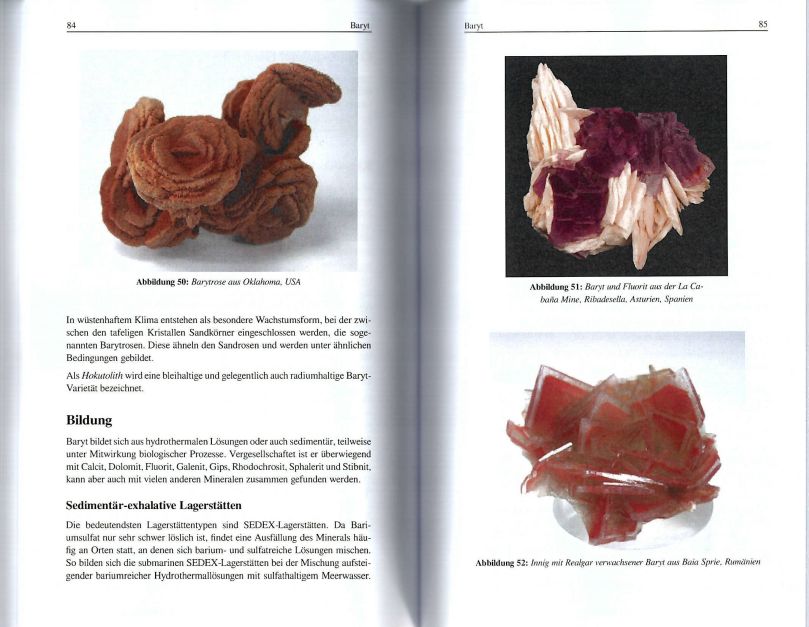
Baryt aus Oklahoma; ich hätte hier einen aus
Rockenberg abgebildet, aber auch das hat mit
Bieber nichts zu tun.
|
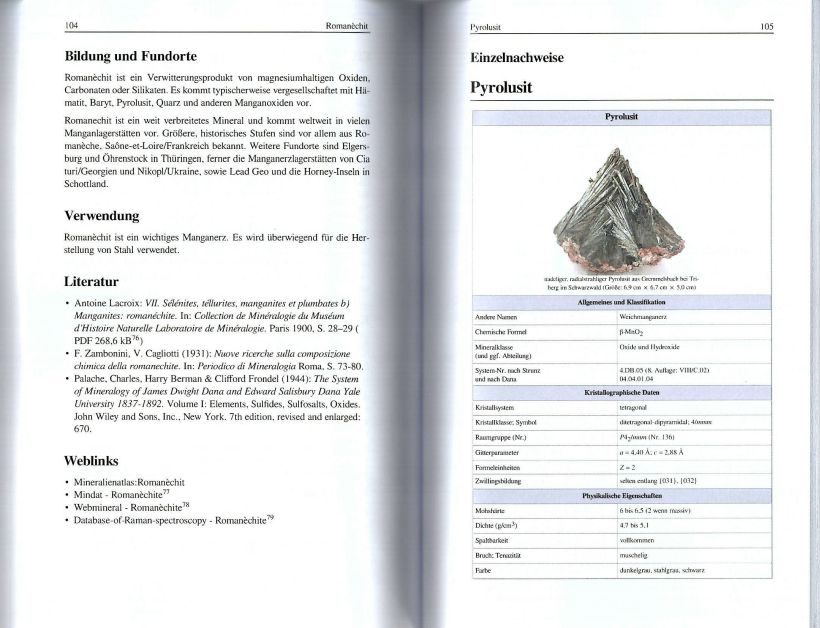
Selbst das Layout von WIKIPEDIA ist
übernommen, weil man das direkt aus
WIKIPEDIA drucken lassen kann!
|
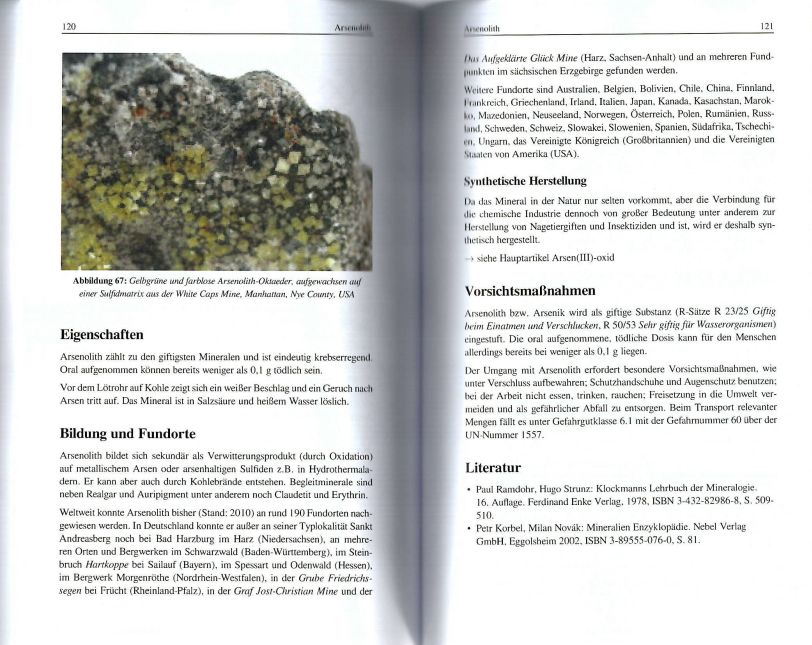
Das verpixelte Arsenolith-Foto erhellt nicht
das Aussehen des giftigen Minerals
|
Wäre es ein Schulaufsatz, dann würde ein Lehrer für das
Thema eine glatte 6 geben, denn das Thema ist verfehlt und es
ist alles kopiert und nicht mal abgeschrieben. Der genial
gewählte Titel suggeriert einen Zusammenhang mit Bieber, der ist
aber nicht da - oder, erst wenn man um die Ecke denkt, dass es
diese vorgestellten Mineralien auch in Bieber gibt, aber in ganz
anderer Form. Es ist so, als würde ich einen Beitrag über
Frankfurt machen und dann Beispiele aus der ganzen Welt, aber
eben nicht von Frankfurt, aus dem Internet zusammen kopieren.
Und die Texte sind logischerweise ganz allgemein gehalten, ohne
Zutun eines Editors und schon garn nicht von Herrn SCHWAB. Der
versteht vermutlich den größten Teil des mineralogischen
Inhaltes nicht.
Da kann man nur sagen, dass das Buch sein Geld nicht wert
ist. Wenn Sie es bestellt haben, können Sie es auch nicht zurück
geben, denn trotz der Angabe "Verkäufer zahlt Rückversand"
brauchen Sie dann einen Rechtsanwalt, denn Herr SHWAB nimmt
nichts zurück. Er bezieht darauf, dass sein Buchverkauf vom
"Finanzamt geprüft" sei.
Die aus WIKIPEDIA generierten Bücher bei PediaPress im Limburg
kosten dort zwischen 10 und 35 € bei dann 700 Seiten. Das kann
im Prinzip jeder selbst machen.
Vermutlich sind alle anderen "Bücher" in eBay von Albin
SCHWAB aus Gelnhausen auf die gleiche Art und Weise zusammen
kopiert.
Museum Biebergemünd -
geschlossen

aufgenommen am 04.11.2001
Wenn Sie nach Biebergemünd, Ortsteil Bieber, kamen, dann empfahl
sich der Besuch des kleinen, aber feinen Heimatmuseums. Es war
untergebracht in neben einem großen Sandsteinbau (ehemaliges
preußisches Amtgericht - rechts im Bild) fanden Sie in den Räumen
im 1. OG eine schöne Ausstellung zum Bergbau, Glashütten,
Geologie, Eisenbahn, Vorgeschichte und zur örtlichen Historie.
Auch konnte man hier einige der interessanten Schriften zur Region
käuflich erwerben. Das Museum wurde vom seit über 15 Jahren
bestehenden Geschichtsverein betreut und war am 1. Sonntag im
Monat von 14 -17 Uhr offen - sonst nach Vereinbarung. Bitte
sprechen sie dazu den Geschichtsverein
in Biebergemünd an.

Das Foto zeigt das ehemalige Postgebäude, welches nach dem Umbau
einen Gemeinschafts- und Vortragsraum haben wird,
aufgenommen am 04.08.2015

Das inzwischen renovierte Gebäude beherbergt im 1.
OG das Biebergrund-Museum,
aufgenommen am 18.05.2019
Die Wieder-Eröffnung des Museums fand am
Donnerstag, den 18.05.2023 um 14 (bis 17) Uhr unter reger
Beteiligung von Politik und Bevölkerung statt. Für die nahe
Zukunft ist noch die Erweiterung der Ausstellung um einen Raum
vorgesehen.
Literatur
Autorenkollekt. (1994): Festschrift 500 Jahre BIEBERER BERGBAU
1494 - 1994.- 70 S., Gemeinde Biebergmünd.
Autorenkollektiv (2020): 25 Jahre Geschichtsverein Biebergemünd e.
V. 1995 - 2020.- Festschrift, 170 S., 111 meist farb. Abb., 11
Grafiken, 21 Tab., [ohne Verlag] Beibergemünd.
BACKHAUS, E. & WEINELT, Wi. (1967): Über die geologischen
Verhältnisse und die Geschichte des Bergbaues im Spessart.- in
BACKHAUS, E. (1967): Beiträge zur Geologie des Aschaffenburger
Raumes.- Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins
Aschaffenburg e. V., 10, 260 S., Aschaffenburg.
BERG, G. & FRIEDENSBURG (1944): Nickel und Kobalt.- Die
metallischen Rohstoffe, ihre Lagerungsverhältnisse und ihre
wirtschaftliche Bedeutung.- 280 S., [Enke] Stuttgart.
BERINGER, I. & NICKEL, P. (2012): Pauline und Biebergemünd.
Pauline Bonaparte Fürstin von Guastalla.- Mitteilungsblatt Zentrum
für Regionalgeschichte 37. Jahrgang, S. 45 - 51, 3 Abb.,
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, Gelnhausen.
BÜCKING, H. (1891): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte
von Preussen und den Thüringischen Staaten. XLIX. Lieferung
Gradabteilung 68, No. 54, Blatt Bieber.- 56 S., [S. SCHROPP´sche
Hof-Landkartenhandlung] Berlin.
BÜCKING, H. (1891): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte
von Preussen und den Thüringischen Staaten. XLIX. Lieferung
Gradabteilung 69, No. 49, Blatt Lohrhaupten).- 30 S., [S.
SCHROPP´sche Hof-Landkartenhandlung] Berlin.
BÜCKING, H. (1892): Der nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der
Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge Heft
12, 274 S., Berlin.
CANCRIN, F. L. (1787): Geschichte und systematische Beschreibung
der in der Grafschaft Hanau Münzenberg, in dem Amte Bieber und
anderen Ämtern dieser Grafschaft, auch dem dieser Grafschaft
benachbarten Ländern gelegenen Bergwerke.- 190 + XIX S., [Hertel]
Leipzig; Reprint in der 2. Aufl. von 1994, Bad Orb.
DAMASCHUN, F. & SCHMITT, R. T. [Hrsg.] (2019): Alexander von
Humboldt. Minerale und Gesteine im Museum für Naturkunde Berlin.-
424 S., sehr viele Abb., [Wallstein Verlag GmbH] Göttingen.
DIEDERICH, G. & LAEMMLEN, M. (1964): Das obere Biebertal im
Nordspessart. Neugliederung des Unteren Buntsandstein,
Exkursionsführer und geologische Karte.- Abh. Hess. L.-Amt
Bodenforsch., Heft 48, 34 S., Wiesbaden.
DIEDERICH, G. (1969): Geologische Verhältnisse und Problemen bei
Bieber.- Natur und Museum 99 (7), S. 307 - 316, Frankfurt.
EMMRICH, S. (1997a): Quellen zum Bieberer Bergbau Die
Betriebsberichte 1907 - 1925.- 110 S., Hrsg. vom Geschichtsverein
Biebergemünd e. V. [Eigenverlag] Bieber.
EMMRICH, S. (1997b): Quellen zum Bieberer Bergbau
Betriebsstatistiken 1907 - 1926.- 48 S., Hrsg. vom
Geschichtsverein Biebergemünd e. V. [Eigenverlag] Bieber.
FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag
zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des
Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,
Aschaffenburg. GOLDSCHMIDT, V. (1913-1923): Atlas der
Krystallformen.- 9 Tafelbände mit je einem Textband, [Winters],
Heidelberg.
HINTZE, C. (1904): Handbuch der Mineralogie.- Erster Band, Erste
Abtheilung, 1208 S., [Verl. v. Veit & Comp.] Leipzig.
HOFMANN, E.-L. (1969): Geschichte der Berg- und Hüttenwerke zu
Bieber.- Natur und Museum 99 (7), S. 317 - 328, Frankfurt.
KLUTH, C. (1967): Über ein Vorkommen vom Emplektit zu Bieber in
Hessen.- Aufschluss 18, S. 9 - 12, Heidelberg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 566ff, 714ff,
731ff.
LORENZ, J. (2018): Mangan – Spurenelement, Mineralbestandteil und
Stahlveredler. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 01/2018, S.
38 - 40, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.
LORENZ, J. & NICKEL, P. (2022): Die Hochöfen des
Eisenhüttenwerks von Bieber und deren Betrieb. Eine
Wirtschaftsgeschichte.- in LORENZ, J. A. & der
Naturwissenschaftliche Verein Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen
& Mangan. Erze, Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten
des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,
S. 141 -157, 11 Abb., 2 Tab.
OKRUSCH, M. (1963): Die Anfänge der mineralogisch-petrographischen
Erforschung des Vorspessarts.- Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg, 4,
Heft 1, Würzburg.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
RAMDOHR, P. (1975): Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen.- 4.
bearbeitete und erweiterte Auflage, 1277 S., [Akademie-Verlag]
Berlin.
RUF, T. (1995): Die Schöne aus dem Glassarg Schneewittchens
märchenhaftes und wirkliches Leben.- 118 S., einige SW-Abb.,
[Verlag Königshausen & Neumann GmbH] Würzburg.
TUROWSKI, S. (1998): Schwermetalluntersuchungen am Schwarzbach im
Spessart unter Berücksichtigung der Geologie des Lochborn von
Bieber mit seiner Bergbaugeschichte.- Geol. Jb. Hessen 126,
S. 15 - 35, 14 Abb., 6 Tab. [Hess. Landesamt f. Bodenforschung]
Wiesbaden.
WAGNER, T. & LORENZ, J. (2002): Mineralogy of complex
Co-Ni-Bi vein mineralization, Bieber deposit, Spessart, Germany .-
Mineralogical Magazine 66, No. 3 (Juni 2002), p. 385 -
407, 10 Fig., 9 Tab., The Mineralogical Society, London.
NSG:

aufgenommen am 11.10.2008
*Gedanken zum NSG (Naturschutzgebiet):
Es ist schon merkwürdig, dass eines der unnatürlichsten Täler des
Spessarts zum einem bedeutenden Naturschutzgebiet gemacht wurde,
denn hier im Lochborn ist praktisch Alles vom Menschen umgestaltet
worden. Selbst die Bäche sind verlegt, Halden, Tagebaue und Dämme
haben den Talgrund total verändert. Und zu Zeiten des aktiven
Bergbaues gab es hier wenig bzw. keinen Wald. Man könnte denken,
dass die natürlichen Gegebenheiten viel weniger Nischen bieten
würden; dies würde zum Schluss führen, dass eine Umgestaltung mit
anschließender 50jühriger Ruhe zu einer größeren biologischen
Vielfalt führen würde als ein "unberührter" Wald!
Aber wenn man nichts macht, dannn werden eben alle Flächen von der
Vegetation besiedelt; bei den hohen Niederschlägen im Raum Bieber
ist das kein Problem. Bis auf eine Ausnahme sind auch die
Schwermetallgehalte keine Hinderungsgrund für eine Ansiedlung von
Bäumen. Wären keine Schatten spendenen Bäume - auch Fichten -
vorhanden, so wäre das Tal noch weiter zugewachsen und man würde
von den Bergbauresten noch weniger sehen. Problematisch sind
derzeit wohl die zahlreichen Wildschweine, die erheblichen
Wühlarbeit leisten und im Winter 2007/08 praktsich die gesamten
Wiesen "umpflügten".
Trotzdem sollte man die nicht standortgerechten Fichten
herausschlagen, so dass heimische Bäume die Flächen besiedeln
können. Wenn man den Charakter des Bergbaugebietes erhalten
wollte, müsste man den größten Teil des Waldes abholzen!
Der Geschichtsverein Biebergemünd:

Leider werden außerhalb des Naturschutzgebietes die verstürzten
Schächte (Schachtpingen) immer noch als illegale Müllplätze
genutzt. Es ist kaum zu fassen, welchen Aufwand man treibt, um die
Zeugnisse der hiesigen Kultur zuzuschütten. Hier gesehen während
einer aufschlussreichen Begehung durch ca. 15 Mitglieder des
Geschichtsvereins vom Biebergemünd am 14.06.2011 unter Führung von
Siegfried Emmrich am neuen Kunstschacht des 1. Röhriger
Kobaltstollens. Von diesem Stollen ist das Mundloch bei einem
Versuch in der 1970er Jahren neu erbaut worden als man versuchte,
den Stollen für ein Besucherbergwerk zu sichern. Leider wurde kein
offener Stollen angetroffen, so dass das Vorhaben eingestellt
wurde.
Tag des Denkmals 2011:

Die Gruppe der Jubiläumsbegehung des Kulturrundweges der Bieberer
Acht am 11.09.2011
an der "Eisensau" in Bieber. Nach Analysen stammt das Eisen sicher
aus Bieber.
(Foto Meinolf Drüll, Geschichtsverein Biebergemünd)
Zum Tag des (offenen) Denkmals am 11.09.2011 trafen gegen 10 Uhr
in Bieber 30 Teilnehmer zum Jubiläumsrundgang des Kulturweges ein,
die der Geschichtsverein von Biebergemünd eingeladen hatte. Das
Führerduo aus Siefried Emmrich (Kultur, Bergbaukunde) und Joachim
Lorenz (Geologie, Mineralogie) begann im Museum und an einem
großen Eisenstück aus dem ehemaligen Hochofen von Bieber mit der
Wanderung. Dann gingen wir zum Burgberg, passierten die
Eisensteintagebau, die Schachtpingen des Kobaltbergbaues und auch
den kaum mehr sichtbaren Resten des Kupferschieferbergbaus, so
dass wir verschwitzt gegen 13.30 Uhr an der Gastwirtschaft am
Wiebüttesee ankamen: ohne Regen, aber bei großer Schwüle. Nach dem
guten Essen liefen wir bequem bergab zurück. Wir kamen am oberen
Maschinenschacht vorbei, der infolge von umgestürzten Bäumen
besser sichtbar war. Dann erreichten wir den Lochborner Teich mit
den Erlen. Es gab auch ausnahmweise ein Stück Cancrinit zum Anfassen. Auf halbem Weg
gab es als Verpflegung kleine Schokoladentäfelchen und gegen 17.10
Uhr waren wir zurück am Museum. Das angekündigte große Gewitter
mit Regen und einem Temperatursturz auf 16 °C fand erst später
statt, so dass der Tag fast ganz trocken bleib. Das Wetter ist
meist besser als der Wetterbericht bzw. die Vorhersage meint.
Die kaltzeitlichen Böden an der B 276 zwischen Bieber
und Flörsbachtal:

Ein Teilabschnitt der Straßenböschung am der B276 zwischen Bieber
und Flösbachtal am 22.08.2015: Würgeboden!
(TK 1:25000 Blatt 5822 Wiesen R 3526694 H 5557574).
Im Zuge der Erneuerung der Straße zwischen Biebergemünd (Röhrig)
und Flörsbachtal wurden die Böschungen frei gelegt. Dabei konnten
kaltzeitliche Bodenbildungen in selten ausgeprägten Formen erkannt
werden. Es handelt sich um einen Würgeboden oder Brodelboden mit
Sandsteinhangschutt in einem solifluktiv umgelagerten
Bröckelschiefer, entstanden in der letzten Kaltzeit vor etwa 18 -
22.000 Jahren, als der tiefe Boden immer geforen war und
jahreszeitlich schwankend tief fror und oberflächennah auftaute.
Damals liefen hier Rentiere und Moschusochsen über den Spessart.
Winde brachten Löss und der Meeresspiegel
befand sich über 120 m tiefer als heute.

Ortstein: Mit Goethit verbackene Sandstein-Gerölle
Bildbreite 9 cm
Weitere Details wurden bei einer Besichtigung am 07.09.2015 von
Dr. Günther SEIDENSCHWANN und Joachim LORENZ vermittelt:

G. SEIDENSCHWANN erklärt den Interessierten - das größte
Kontingent
stellte der Geschichtsverein von Biebergemünd - die Herkunft der
Steine in
dem hier angeschnittenen Hangschutt aus meist
Sandsteingeröllen.
Das neue Biebergrund-Museum

Ansprache zur Eröffnung am 18.08.2018
Am sonnigen Samstag, den 18. August 2018, wurde nach etwa
vierjähriger Vorarbeit das neue Biebergrund-Museum eingeweiht. 35
Gäste folgten der Einladung und hörten die Reden der Beteiligten -
und die Schwierigkeiten und Hindernisse beim Umbau. Zunächst ist
die kommunale Begegnungsstätte im Erdgeschoss des ehemaligen
Postgebäudes aus dem Jahr 1916 mit einem Vortrags- bzw.
Mehrzweckraum - auch für Sonderausstellungen - und einer Küche
fertig gestellt worden.
Das 1. OG für das eigentliche Museum ist baulich fertig, muss
aber durch den Geschichtsverein noch mit den Ausstellungstücken,
Grafiken und Texten ausgestaltet werden. Im Dachgeschoss wird der
Geschichtsverein eine Bibliothek, ein Archiv und ein Büro
einrichten. Aufgrund des Alters ist nur das EG barrierefrei. Das
Museum ist eine gute kommunale Investition in die Zukunft des
Ortes. Darin werden die Geologie, der Bergbau, die Ortsteile, die
Spessartbahn und die damit verbundenen Gewerbe und Industrien
gezeigt. Ein Bereich für Kinder als außerschulischer Lernort
rundet die Ausstellung ab.
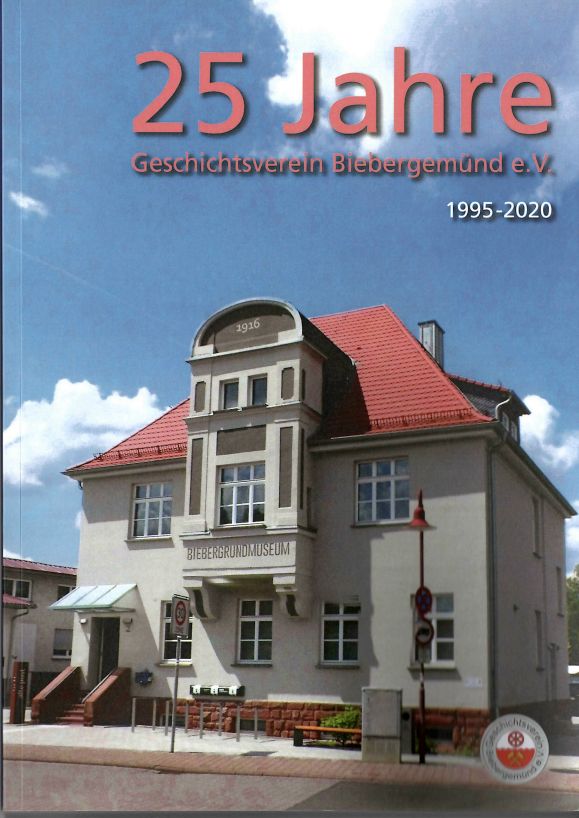
Titelseite. Zum 25. Gründungsjubiläum des Geschichtsvereins von
Biebergemünd wurde eine umfangreiche Jubiläumsschrift aufgelegt,
die das Werden, Tun und Wirken des Vereins beschreibt:
Autorenkollektiv (2020): 25 Jahre Geschichtsverein
Biebergemünd e. V. 1995 - 2020.- Festschrift, 170 S., 111 meist
farb. Abb., 11 Grafiken, 21 Tab., [ohne Verlag]
Biebergemünd.
Das Heft im Format A4 und ohne Werbeseiten wird als Softcover zu
einem Preis von 18 € angeboten und kann beim Geschichtsverein
Biebergemüd bezogen werden. Darin wird Vereinsgesehen beschrieben.
Darin befinden sich kaum Neuigkeiten zum Bergbau, dafür aber ein
sehr ausführlicher und umfangreicher Beitrag zur Glockengeschichte
der Kirchen.
Das neue Biebergrund-Museum mit der Ausstellung
Am Donnerstag, den 18.05.2023 wurden die Museumsräume des
Biebergrundmuseums erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet.

Der Bürgermeister Matthias SCHMITT begrüßte die ungefähr 50
geladenen Gäste zur Eröffnung des Biebergrundmuseums.
Darunter Vertreter der lokalen Politik, Leihgeber und
Sponsoren, Presse, die Mitglieder des Geschichtsvereins und
die am Bau der Ausstellung beteiligten Handwerker und
Firmen.
|

Rechts: Jürgen BECK von der gleichnamigen Schreinerei aus
Biebergemünd-Bieber sprach zu den Gästen. Er erzählte, dass
er in einem fruchtbringenden Verbund mit dem
Geschichtsverein ein Konzept umsetzte, was ohne das Zutun
von weiteren Planern gelang. Und es ist ein Vorzeigeobjekt
in der Gemeinde geworden.
|

Maria SCHNEEMANN vom Geschichtsverein bot die Schriften des
Geschichtsvereins im Vortragsraum an.
|

Der Museumsleiter Peter NICKEL erklärt den Besuchern
wortgewandt und fachlich präzise die Herstellung der
hessischen Bergbau-Taler aus dem Silber von Bieber - bzw.
deren Nachprägungen durch Banken im Main-Kinzig-Kreis und
der verschlungene Weg, wie er an die Präge-Stempel gelangte.
Es fehlen aber noch einige originale Taler aus Bieber in der
Ausstellung.
|
Einige hundert Besucher schauten sich die Ausstellungen und die
Exponate an, so dass die Räume immer mit Menschen gefüllt waren.
Einige kamen von weit her, so zum Beispiel die Miltenberger
Mineralien- und Geologiefreunde. Den Besuchern wurden zur Stärkung
Getränke, Häppchen und Kuchen gereicht, dessen Erlös an die
Förderkreis Laurentia zur Erhaltung der Kirche ging. Dabei zeigte
es sich, dass es in dem Bereich des Museums für so eine
Veranstaltung nicht ausreichend Parkplätze gab, so dass manche
Besucher einen weiteren Fußweg hatten; an gewöhnlichen Tagen - wie
sonntags - reichen die Parkplätze um das Museum aus.
Was sieht man im Museum?
- Eisenbahn zwischen Bieber und Gelnhausen
- Die Familie Cancrin
- Die Eisenerzeugung
- Bergbau (Kupferschiefer, Kobalt, Eisen)
- Geschichte von Wirtheim
- Kirchen & Religion
- Trachten, Kleidung, Aussteuer
- Geologie, Mineralogie und Erzgenese
- Vermessung (Markscheider)
- Münzwesen
- Postwesen
- Glasherstellung
- ...
Das Museum wird weiter entwickelt. In den kommenden Jahren werden
die Exponate ergänzt. Auch wird noch ein Raum eingerichtet.
Zurück zur Homepage
oder an den Anfang der Seite