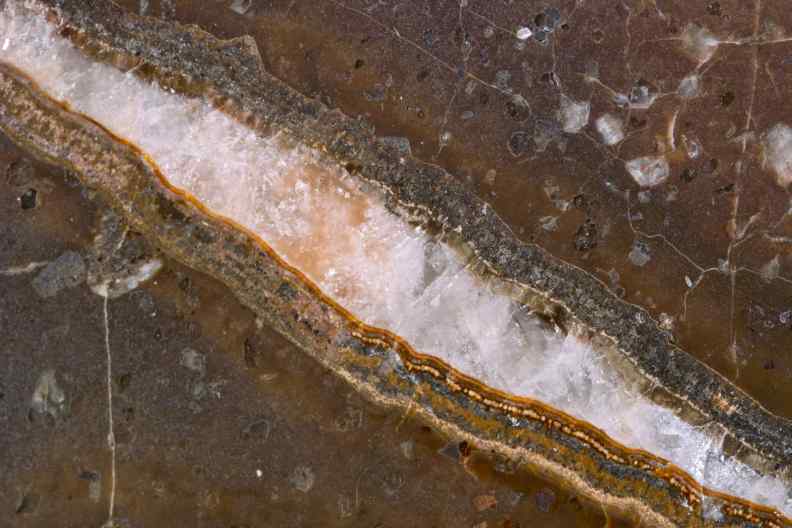Sulfate
von der Hartkoppe bei Sailauf
Anhydrit
Ca[SO4]
Bis zu 6 cm lang und 3 cm breit, konnte in den Calcit-Gängen der
4. Sohle als finale Drusenfüllungen spätig-strahliger, leicht
grünlicher Anhydrit nachgewiesen werden. Die gut spaltbare Masse
ist in mm-dicken Spaltstücken durchsichtig. Vom Baryt
unterscheidet sich das Mineral durch den mehr seidigen
Perlmutterglanz. Als Begleitmineral tritt noch etwas Dolomit und Gips
auf.

Großes Spaltstück von farblosem
Anhydrit mit dem typischen Perlmutterglanz,
Bildbreite ca. 7 cm
|

Farbloser Anhydrit als säulige
Kristalle, im oberen Bereich in feinkörnigen Gips
umgesetzt,
Bildbreite 3 cm
|

Drusenauskleidung aus einem weißlichen
bis farblosenAnhydrit, umgeben von Braunit und
Manganit,
Bildbreite 4 cm
|

Farbloser, von Spaltrissen
durchzogener, ganz frischer Anhydrit als finale
Hohlraumfüllung im Gangmaterial. Randlich beginnt die
Umwandlung zu Gips durch Wasseraufnahme und führt zu
Bassanit,
Bildbreite 2 cmm
|

Farbloser Anhydrit als blättrige
Aggregate, im rechten Bereich in weißen, feinkörnigen Gips
umgesetzt,
Bildbreite 8 cm
|

Die unscheinbare Fundstelle im
Haufwerk der Stücke mit Gips und Anhydrit;
aufgenommen am 17.04.2010
|

Mit Braunit imprägnierter Rhyolith aus
der Störungszone mit Rissen und Klüften, ausgefüllt von
weißem Anhydrit, Manganit, Kutnahorit und Braunit (angeschliffen und poliert),
Bildbreite 12 cm
|
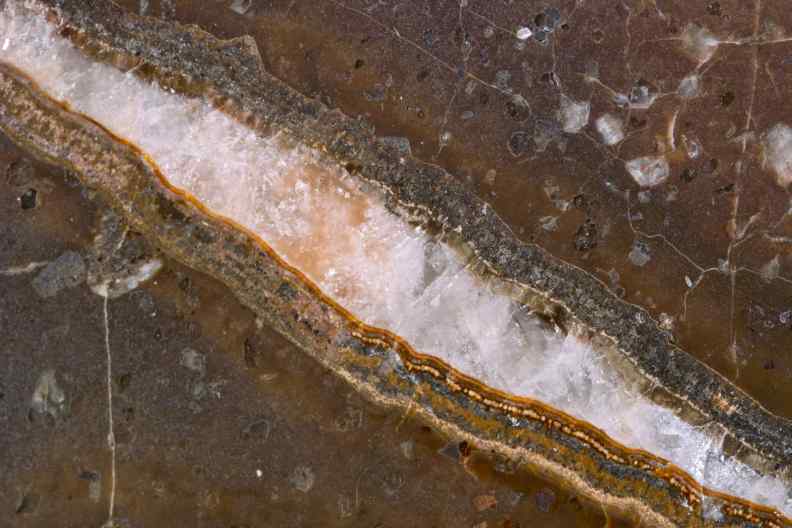
Ausschnitt aus Abb. links:
Farbloser bis weißer Anhydrit als finale Füllung in einer
Kluft, mit nadeligem Manganit, Braunit und Karyopilit
(angeschliffen und poliert),
Bildbreite 2 cm
|

Feinblättriger Anhydrit im weißen
Calcit - deshalb nur schwer erkennbar und sicher oft
übersehen -
Bildbreite 11 cm
|
Durch Reste von Anhydrit in Calcit-Drusen belegt, konnten die
seit langem beobachteten feinen, parallelen Abdrücke auf den Calcit- und Fluorit-Kristallen
dem ehemals vorhandenen Anhydrit zugesprochen werden.
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die manchmal in den Gängen sehr
zahlreichen, primatischen bis tafeligen Höhlungen im Calcit/Kutnahorit mit ±Fluorit, die
früher weggelöstem Baryt zugeschrieben wurden, in Wirklichkeit
ehemalige Anhydrit-Kristalle gewesen, die später weggelöst wurden.
Weißer, blättriger Anhydrit wurde in bis zu einem cm großen
Einschlüssen im Gang (4. Sohle) neben Brandtit beobachtet. Die im
Querbruch strahlig aussehenden Aggregate bestehen aus ca. 0,5 mm
dicken, gut spaltbaren, rissigen Täfelchen. Als Begleitmineral
tritt nur etwas Illit
auf.
Die Spuren von tafeligen bis stengeligem (teilweise mit
quadratischem Querschnitt, 1 mm dick bis 1,5 cm Länge) Anhydrit
(Baryt ist unwahrscheinlich) fanden sich praktisch in allen Teilen
der Gänge. Auffällig ist, dass insbesondere die Enden und dünnen
Stege und Zwickel zwischen den ehemaligen Anhydrit-Tafeln aus
Kutnahorit bestehen und oft von Brandtit begleitet werden. Die
Hydratisation des Anhydrit erfolgte beim gleichzeitigem Weglösen,
so dass keine Risse durch die Volumenzunahme zu beobachten sind.
In einigen Fällen ist Anhydrit, Brassit und Gips noch in Spuren
erhalten.

Keine Kristalle - sondern die Negative ehemaliger
Anhydrit-Kristalle
mit einem tafeligen Habitus im Rhodochrosit. Die einst sich
kreuzenden
Anhydrit-Kristalle formten als frühe Bildung Hohlräume, in denen
später der Calcitgebildet und der dann noch später durch die
Zufuhr
von Mn in Rhodochrosit umgesetzt wurde,
Bildbreite 4 cm.
Baryt Ba[SO4]
Selbständige Gängchen bis zu einer Mächtigkeit von 15 cm (in der
1. Sohle) können ganz mit weißem, grobspätigen Baryt gefüllt sein.
Zerbrechliche Kristalle erreichen bis zu 3 cm Größe. Dieser führt
nur etwas feinschuppigen Hämatit.
Das unmittelbare Nebengestein ist auffällig gebleicht. Der weiße
Baryt zeigt bei der Bestrahlung mit der UV-Leuchte eine blauweiße
Fluoreszenz. Der Baryt durchbricht sowohl den Rhyolith als auch
den dann stark brekziösen Muskovit-Biotit-Schiefer.

Reste von weißem Baryt als großflächiger Kluftbelag auf dem
Rhyolith
der obersten Sohle des Steinbruchs,
aufgenommen am 26.01.2013

Weißer Baryt als dünner Kluftbelag auf Rhyolith von der 1. Sohle,
Bildbreite 8 cm
1989 wurden sehr schöne und formenreiche, farblose, tafelige und
stengelige Baryt-Kristalle mit Hämatit und in Quarz-Gängen im Kontakt mit dem Muskovit-Biotit-Gneis
gefunden. Bei den tafeligen Kristallen kann das Pinakoid (001) so
zurücktreten, dass "oktaederähnliche" Kristalle, max. 1 mm groß,
entstehen konnten. Auch langsäulige, wasserklare, an Quarz
erinnernde Kristalle konnten beobachtet werden. Sie sind als 2.
Generation über dem meist grobspätigen Baryt, der an vielen
Stellen angelöst wurde, oder auf Fluorit von der 3. Sohle,
aufgewachsen.
Als Letztausscheidung füllt spätiger, weißer bis brauner Baryt
auch Hohlräume in den an Braunit reichen Teilen der Erzgänge. Hier
ist er manchmal angelöst und mit einer 2. Generation, farbloser,
stark glänzender Kristalle überwachsen.

Weißer Baryt auf Calcit (dunkelbraun durch Todorokit) im Rhyolith
(rechts unten),
Bildbreite 4 cm
Ebenso findet sich der Baryt als Füllung in Hohlräumen der Lithophysen.
Weiße, idiomorphe, blättrige Kristalle sind in den Hohlräumen
selten beobachtet worden.

Rundliches, blättriges Baryt-Aggregat in dem Hohlraum einer
Lithophyse, überkrustet vonb farblosem Quarz,
Bildbreite 3 cm
In einer Calcit-Druse wurden 2 mm große, glänzende, honiggelbe
Baryt-Kristalle entdeckt. Sie haben prismatischen Habitus bei
einem qadratischen Umriss.
Drusen aus der Brandtit-Zone der 4. Sohle führen selten auch
farblose, dicktafelige Baryt-Kristalle in einer Größe bis zu 0,5
mm. Sie sind teils zoniert, innen weiß und mit einer farblosen
Hülle überwachsen. Auch sechskantige Prismen wurden beobachtet.
Gips Ca[SO4]2·H2O
In kleinen, mit Hämatit und Calcit ausgekleideten Hohlräumen in
dem von Braunit
und Mn-Calcit
durchsetzten Calcit von der 3.
Sohle lassen sich bis 0,5 mm große, vollkommen farblose, teilweise
längsgestreifte (angelöste) Kriställchen beobachten. Sie sind
meist plattig, aber auch säulig ausgebildet und lebhaft
glänzend.

Drusenhohlraum, angefüllt mit weißem, feinkörnigem Gips, der aus
dem in Resten noch vorhandenen Anhydrit (Einschluss mit
Spaltrissen)
entstanden ist,
Bildbreite 3 cm
Weiße, "zuckerartige" Drusenfüllungen, die leicht herausfielen,
erregten die Aufmerksamkeit beim Öffnen von weißen Calcit-Drusen
der Störung auf der 4. Sohle. Unter der Mikroskop kann man
erkennen, dass sich die bis zu mehreren cm-großen Füllungen aus
max. 0,1 mm-großen, völlig farblosen, glasglänzenden Kristallen
zusammensetzen. Die Kriställchen sind regellos angeordnet.
Die typischen Formen wie die geringe Härte machten die Bestimmung
als Gips leicht. Die sonst verbreiteten, charakteristischen
Zwillinge treten hier nicht auf. Die Bestimmung wurde
röntgendiffraktometrisch gesichert.

Dünne Gipskrusten als Kluftfüllung im
brekziierten und mit Braunit imprägnierten Rhyolith aus
der Gangzone. Solche Beläge lassen sich im Steinbruch kaum
von den sehr ähnlich aussehenden Carbonaten unterscheiden!
Bildbreite 8 cm
|

Weiße Drusenfüllung aus Gips mit
eingewachsenen, farblosen Quarzkriställchen mit dem
ungebenden Braunit. Auf der kluftfläche oben glänzt
Karyopilit,
Bildbreite 5 cm
|

Bräunlicher bis weißer Gips als
ungewöhnlich große Hohlraumfüllung im brekziösen
Gangmaterial zusammenmit Braunit und kleinen
Quarz-Kristallen,
Bildbreite 13 cm
|

Weißer Gips als große Hohlraumfüllung
im Braunit und Manganocalcit,
Bildbreite 4 cm
|

Weiße Gipsreste als Drusenfüllung im
brekziierten und mit Braunit imprägnierten Rhyolith aus
der Gangzone. Diese besteht unten aus stark altereritem
Gestein und weiter unten aus Hämatit mit Calcit,
Bildbreite 21 cm
|

Ausschnitt aus der Abb. links, darin
die weißen Reste aus Gips, der zum größten Teil weggelöst
worden ist.
Bildbreite 6 cm
|
Der weiße bis bräunliche Gips ist noch schwerer im Steinbruch zu
erkennen wie der Anhydrit. Ohne zur Hilfenahme von HCl ist es
nahezu unmöglich die feinkörnigen Carbonate von den Gipsmassen
unterscheiden zu können. Ein Hinweis sind die randlichen
Lösungserscheinungen. Im Steinbruch bleibt der Gips oft nicht
erhalten, da er aufgrund der geringen Härte bevorzugt abfällt -
wohl schon von der Sprengung geschädigt und unter Druck stehend
durch die Volumenzunahme bei der Umwandlung vom Anhydrit in den
Gips.
Devillin
CaCu4[(OH)6/(SO4)2]·3H20
Gemeinsam mit rissigem Chrysokoll
auf blau angelaufenem Chalkosin
in einer sehr dünnen Kluft im Rhyolith findet sich noch leicht
grünliche, bis zu 0,8 mm große Devillin-Täfelchen ohne markante
Begrenzungsflächen. Die überkrustete Fläche ist ca. 1 cm2
groß. Weder eine Radioaktivität wie eine Fluoreszenz wurde an dem
von der 4. Sohle stammenden Stück beobachtet.
Scheelit Ca[WO4]
In einem Hohlraum in der Braunit-Brekzie konnte ein ca. 1 cm
großes, weißes Mineralkorn, lose darinliegend, gefunden werden. Es
unterscheidet sich durch die gute Spaltbarkeit und mehr weißliche
Fluoreszenzfarbe - gelblich im langwelligen Bereich - vom Powellit.
Die nähere (röntgendiffraktometrische) Bestimmung ergab, dass es
sich um Scheelit handelt. Aufgrund der Fluoreszenzfarbe ist ein
deutlicher Mo-Gehalt anzunehmen.
Im Frühling 1991 konnte auf einem Stück aus dem Erzgang - aus Calcit, Seladonit, jedoch ohne
Mn-Mineralien - max. 0,5 mm messende, pyramidale bis dipyramidale,
graugrüne Scheelit-Kriställchen gefunden werden. Sie sitzen auf Rhodochrosit. Die
Untersuchung mit der Mikrosonde erbrachte neben W und Ca, einen
Mo-Gehalt von ca. 9 %. Es liegt somit Scheelit vor.
Powellit
Ca[MoO4]
Bei der Bestrahlung von Erzproben, bestehend aus Braunit, Calcit und etwas Manganit,
besonders mit kurzwelligem UV-Licht (254 nm) fallen kleine,
chreme- bis goldgelb fluoreszierenden Pünktchen oder dünne
Kluftbeläge auf. Bei Tageslicht betrachtet erkennt man gelbliche,
braune oder graue Krusten und glasige Körner, die eine maximale
Größe von 3 mm erreichen. Kleine Körnchen sind in geringen Mengen
in den Erzgängen weit verbreitet. Idiomorphe Kristalle werden bis
heute nicht beobachtet. Verbreitet treten auch körnige
Powellit-Einschlüsse in massigem Illit
auf. Begleitminerale sind Calcit und Todorokit.
In lagigen Erzstücken, aus Braunit, Seladonit, Calcit und
Kutnahorit können im Anschliff zehntel mm dünne Lagen aus Powellit
beobachtet werden. Da mehrere Lagen nebeneinander zu finden sind,
muss es mehrmals nacheinander abgeschieden worden sein.
Die Erzzone, die Aragonit und
Brandtit führt, ist ebenfalls
sehr stark mit kleinen Powellit-Körnchen durchsetzt.
Deber Braunit,
der neben etwas Todorokit
und Kryptomelan
in Drusen fast keine weiteren Mineralien führte, ist teilweise
auch mit Powellit durchsetzt. Es sind hier mehr bis zu 1 mm große,
oft deutlich sichtbare Körner, die im Braunit eingeschlossen
sind.

Gangstück mit Carbonaten aus Calcit mit Braunit und rechts
daneben Seladonit mit Calcit und darin Powellit am Rand des
Stückes im Tageslicht;
Bildbreite 7 cm.
|

Ausschnit wir links, jedoch unter UV-Licht. Hier sieht man
oben rechts der Mitte die stark gelb fluoreszierenden
Powellit-Körner;
Bildbreite 7 cm
|

Gelbliche Powellit-Körner in einem Gneis-Xenolith im
Rhyolith;
Bildbreite 3 cm
|

Braune, stark glänzende Powellit-Kristalle in Kutnahorit,
durch verdünnte HCl frei geätzt;
Bildbreite 5 mm
|

Derber Powellit als braunes Korn mit einem gegenüber dem
umgebenden Illit leicht glasigen Glanz abhebend. Das fast
bildfüllende Korn ist ohne die Hilfe von UV-Licht nicht zu
finden;
Bildbreite 5 mm
|

Kristallrasen aus hoch glänzenden Powellit-Kristallen, durch
verdünnte HCL frei geätzt;
Bildbreite 3 mm
|
Auch konnte ein Stück eines Biotit-Gneis-Xenolithes
gefunden werden, der völlig mit Powellit-Blättchen durchsetzt ist.
Zur Abgrenzung gegenüber dem Scheelit
wurde eine Untersuchung mit der Mikrosonde durchgeführt, bei der
eindeutig Ca, Mo, W und Y gefunden wurde. Das Verhältnis von MoO3
und WO3 verhält sich etwa wie 4 : 1. Mn und As wurden
als Bestandteile des Braunits gedeutet, mit dem der Powellit
verunreinigt ist.
"Gewöhnlich entsteht Powellit durch Zersetzung aus Molybdänit.
Dies ist aufgrund blättriger Strukturen in Powelliten auch für
Sailauf anzunehmen, weshalb mit dem Vorkommen von Molybdänit in
der Teufe zu rechnen ist." Mit diesem Absatz wurde vom Autor 1991
ein primäres Mo-Mineral gemutet. Mit dem Nachweis von Jordisit ist dann 1992 ein
primärer Mo-Lieferant nachgewiesen worden.
Dunkelbraune, glasige, bis zu 1 mm große, stark glänzende
Kristalle im Kutnahorit von der 4. Sohle konnten als Powellit
bestimmt werden. Sie fluoreszieren unter kurzwelligem (selten auch
im LW-UV-Licht) UV-Licht typisch gelblich. Die meist dipyramidalen
Kriställchen sind in Krusten im Carbonat randnah zum Rhyolith
eingewachsen und lassen sich leicht durch das Weglösen mittels HCl
gewinnen.
Bevorzugtes Auftreten der hier bis zu 5 mm großen, chremefarbenen
Einschlüsse wurde in den Bereichen des Ganges beobachtet, wo die
brekziöse Gangfüllung außer den Carbonaten keine weiteren
Mineralien führen.

Powellit-Kristalle im Carbonat;
Bildbreite 7 mm
In der Brandtit-Paragenese
der 4. Sohle konnten teils im Illit
bzw. im Calcit neben Brandtit eingewachsen, reichlich
prismatische, dunkelbraune Powellit-Kristalle entdeckt werden. Die
flächenreichen und z. T. transparenten, idiomorphen Kristalle
werden bis zu 2 mm groß, sind teilweise länglich ausgebildet und
fallen durch ihren lebhaften Glanz gegenüber den Carbonaten auf.
Die Körner sind sehr spröde und nur undeutlich spaltbar. Es ist
mit KW-UV-Licht eine dunkle, gelbliche Fluoreszenz zu beobachten.
Seltener sind die Powellit-Kristalle direkt auf einem Tilasit-Rasen aufgewachsen.
Der Powellit ist wohl weit verbreitet und wird wohl oft übersehen.
In der Störungszone ist er möglicherweise an dünne
Kutnahorit-/Calcit-Gänge gebunden, die nahe am Rhyolith verlaufen
und bei denen die sonst üblichen Mineralien fehlen. Als
Begleitmineral tritt lediglich Tilasit auf.
Die Fluoreszenfarbe ist abhängig von Mo-W-Verhältnis. Scheelit
mit <0,35 % Mo fluoresziert unter KW-UV-Licht bläulichweiß, bei
0,35 - 1 % Mo weiß, >1 % Mo zunehmend gelbstichig und über 4,8
- 48 % ausgeprägt gelb. Merkwürdigerweise können Mischkristalle
zwischen Powellit und Scheelit auch bei Bestrahlung mit
langwelligem UV-Licht gelb fluoreszieren.
Bassanit
Ca[SO4]·½H2O
Bassanit wurde von LORENZ 2004 beschrieben. Das Halbhydrat ist aus
dem Anhydrit durch Wasseraufnahme entstanden.
Zurück,
zum Anfang der Seite oder weiter