Eis als Eiszapfen auf den Rhyolith-Felsen. Sie bilden sich, wenn das Kluftwasser aus dem Rhyolith nach einem Regen bei Frost austritt;
aufgenommen am 11.01.2003.
Eis H2O
Im Winter gehört Eis zu den häufigen Mineralien im Steinbruch. Man
findet es in der Form von Schnee, Eiszapfen, Reif usw. Das Eis
hält sich hier immer länger wie in der Umgebung, da die
tiefstehende Sonne in den Wintermonaten nicht mehr den Boden den
tiefen Steinbruches erreicht.
Eis als Eiszapfen auf den Rhyolith-Felsen. Sie bilden sich, wenn
das Kluftwasser aus dem Rhyolith nach einem Regen bei Frost
austritt;
aufgenommen am 11.01.2003.

Der Steinbruch mit Schnee an einem sonnigen Wintertag,
aufgenommen am 13.12.20012
Ja, Eis ist ein Mineral (fest, kristallin
und natürlich entstanden) und auch der Name für ein Gestein (man
denke an Gletscher) und sogar sehr verbreitet: Es überzieht ganze
Kontinente.
Cuprit Cu2O
Dünne, rote Überzüge auf ged.
Arsen und Domeykit
erwiesen sich als derber Cuprit. Die cm-großen, unscheinbaren
Überzüge werden weiter von Chalkopyrit
und Uranospinit begleitet.
Hausmannit
Mn2+Mn3+2O4
Abweichend von den Mn-Erzen Braunit und Manganit, die meist in
körnigen bzw. strahligen Aggregaten vorkommen, fand sich in den
nordwestlichen Teilen der Vererzung derber, dichter Hausmannit. In
der Masse sind einzelne, oft gestreifte Kristalle nur
andeutungsweise auszumachen. Das Material ist sehr fest und
erreicht innerhalb von reinen Calcit-Gängen
eine Gangmächtigkeit bis zu 5 cm. Er wird von Baryt, Calcit, Mn-Calcit, Dolomit, Quarz und Arseniosiderit
begleitet.

Bruchfläche eines Hausmannit-führenden Ganges zusammen mit
Kutnahorit,
Calcit und Maganit;
Bildbreite ca. 7 cm

Rückseite des Stücken von oben, jedoch angeschliffen und poliert:
In
der brekziösen Gangmassen ist im Calcit reichlich Illit und
Seladonit,
Manganocalcit und Braunit zu erkennen. Im Hausmannit ist
Kutnahorit
verbreitet;
Bildbreite ca. 8 cm
Bis 3 mm große, verzerrte, zu Gruppen aggregierte Kristalle
konnten bis jetzt nur selten beobachtet werden. Einzigartig ist
der Fund eines ca. 3 mm großen, "oktaedrischen" Kristalls in einer
Braunit-Höhle.
Bemerkenswert ist das Auftreten eines unbeschriebenen Ca-Mn-Arsenates,
das in seinen schmalen Klüften, besonders gegen das Salband hin
und in den sich anschließenden Mn-Calcit-Partien auftritt.

Pseudooktaedrischer Hausmannit-Kristall,
Bildbreite 5 mm
Im derben Braunit -
begleitet von Kryptomelan
- von der 3. Sohle konnten bis zu cm große Butzen - als
Umwandlungsreste gedeutet - aus Hausmannit gefunden werden. Er ist
erkennbar an der typischen Zwillingsstreifung und dem starken
Glanz, welches sich gut vom stumpfen, derben Braunit abhebt.
Im derben Hausmannit von der 3. Sohle konnten in wenigen Spalten
zahlreiche stark verzerrte, bis zu 2 mm große, "oktaedrische"
Hausmannit-Kristalle beobachtet werden.

Rissiger Hausmannit-Kristall,
Bildbreite 7 mm
Aus einem Gangstück mit Calcit, Mn-Calcit und Braunit konnte reichlich Hausmannit gefunden werden. Die cm-großen, derben Massen sind nur schwer vom Braunit zu unterscheiden. Idiomorphe Kristalle bestehen meist aus sehr steile, tetraedrische Pyramiden mit der typischen Streifung quer zur Längsachse; sie sind bis zu 1 mm groß, parallel mit weiteren Individuen verwachsen und in kleinen Hohlräumen sitzend. Diese wurden völlig mit Carbonaten gefüllt. Typische Zwillinge wie von anderen Fundorten wurden nicht beobachtet. Der Hausmannit findet sich immer im Zentrum von Erzschmitzen, Braunit findet sich am Rand zu den Carbonaten.

Gangstück mit massivem Hausmannit mit etwas Kutnahorit im Zentrum,
darum Magano-Calcit als Pseudomorphose nach Manganit, zonierter
Braunit der partiell in Todorokit und Manganocalcit umgewandelt
ist. Im
farblosen Calcit ist noch reichlich Brandtit eingewachsen;
angeschliffen und
poliertes Stück,
Bildbreite 6 cm.
Im Calcit konnten linsenförmige, poröse Massen mit einem
Durchmesser von bis zu 15 cm beobachtet werden. Sie führen etwas
Calcit, Kutnahorit und
untergeordnet Brandtit.
Auch als dendritisch in den Calcit eingewachsene Massen tritt
Hausmannit, merkwürdigerweise mit Hämatit, auf. Die beiden Phasen
sind optisch nicht zu trennen. Die Bestimmung erfolgte
röntgendiffraktometrisch.
Achtung: Hausmannit ist auch in verdünnter, kalter HCl bei langer
Einwirkzeit löslich, so dass nur Calcit, nicht aber
Kutnahorit/Dolomit damit entfernt werden kann.
Arsenolith
As2O3
Arsenolith bildet auf dem ged.
Arsen bis 0,5 mm große, farblose bis weiße, vorwiegend
oktaedrische Kristalle und bis zu 3 mm große Kristallaggregate.
Sie finden sich bevorzugt auf den nicht mehr silbrig glänzenden
Flächen mit ged. Arsen.
Bei der Untersuchung der Erzminerale (vorwiegend ged. Arsen) der
"dunklen Flecke" wurde unter dem Raster-Elektronenmikroskop
festgestellt, dass die feinsten Klüfte bzw. die Bruchflächen des
ged. Arsens teilweise bis völlig mit einem "Rasen" aus
Arsenolith-Kristallen überzogen waren (die Proben waren zum
Zeitpunkt der Untersuchung ca. 7 Tage alt). Die Rasen entstehen
durch Oxidation des elementaren As mit dem O2 der Luft
nach wenigen Tagen bis Wochen. Sie sind mit dem Lichtmikroskop
deutlich als kleinste Kristallüberzüge auf dem ged. Arsen zu
sehen.
Nach einigen Jahren wachsen die Arsenolith-Kristalle zu einer
weißen, "zuckerkörnigen" Fläche über dem Arsen zusammen, so dass
das ehemals schwarze Arsen nur noch als grauer Schatten zu
erkennen ist.
Neben zahlreichen Pharmakolith-Rosetten
und kleinen Arsenolith-Oktaedern wurden bis 2 mm große Aggregate
aus farblosen, gedrungenen Kristallen bmerkt. Sie sind oft
radialstrahlig aggregiert und bilden bei tafeligem Habitus
sechseckige Formen. Bei kurzssäuligen, sich nach außen
verdickenden Kristallen ist eine parallele Streifung nach der
Längsachse zu beobachten.

Arsenolith-Kristalle auf ged. Arsen,
Bildbreite 5 mm
Bixbyit
(Mn,Fe)2O3
Lagige-schalige Massen aus wechsellagernd Bixbyit, Manganit, Hämatit, Dolomit, Braunit und Calcit bilden mit Braunit
chaotische Massen im Gang der 4. Sohle. Sie werden von Illit als inselförmige
Einschlüsse begleitet. Die Bereiche im Gang erreichen bei 10 cm
Mächtigkeit einige Meter an Ausdehnung. Die stark brekziöse und
chaotische Mineralisation wird von Calcit abgeschlossen.
Sie ist nur erklärbar, wenn man annimmt, dass der Gang mit einer
Wechsellagerung aus Hämatit, Manganit, Bixbyit, Braunit und Calcit
ausgekleidet wurde. Anschließend wurde die Abscheidung von den
Wänden gelöst und sie fiel in einen anderen Bereich des Ganges.
Anschließend erfolgte eine neue Mineralisation und möglicherweise
auch Umwandlung, die mit Braunit und Calcit abgeschlossen wurde.
Braunit
Mn2+Mn3+6SiO12
Im Frühjahr 1984 wurde auf der 2. Sohle eine mit 135° streichende
und mit 85-90° einfallende Störung angefahren. Sie wurde dann ab
1988 auf ihrer ganzen Ausdehnung auf der 3. Sohle aufgefahren. Im
SE-Teil trat Braunit als Hauptbestandteil mit Calcit, Mn-Calcit, Manganit, Baryt und Illit auf. In den Randzonen
ist er vollkommen derb und bis zu 10 cm mächtig und tritt ohne
Begleitminerale auf. Im derben Braunit sind ab und zu noch Reste
von Hausmannit
zu beobachten.

Braunit-Kristalle,
Bildbreite 7 mm
Im NW-Teil kreuzte die Störung den Hämatit-Gang und führte derben und grobkristallinen Braunit. Die drusenreichen Stücke führten häufig bis 10 mm lange und 5 mm dicke Pseudomorphosen von Braunit nach Manganit, ferner samtigen Todorokit und selten Arseniosiderit. Verbreitet sind gitterartige Verwachsungen, deren Hohlräume dünn mit Todorokit überzogen und mit rotem Ton gefüllt wurden. Rechteckig-prismatische Hohlräume deuten auf das ehemalige Vorhandensein von Baryt hin. Auch glaskopfartige Massen wurden beobachtet, welche teilweise von innen heraus in Todorokit umgewandelt wurden.
Drusenreiche Stücke von der 3. Sohle, die in den Hohlräumen Kryptomelan-Nadeln führten, enthielten reichlich Reste von nicht umgewandeltem Hausmannit, erkenntlich an der typischen Zwillingsstreifung und dem ausgeprägten Glanz im derben Braunit. Es ist somit anzunehmen, dass der größte Teil des derben Braunits aus Hausmannit entstanden ist.
Fein- bis grobkristalliner Braunit tritt gemeinsam mit den oben aufgeführten Mineralien auf. Er ist gewöhnlich im Calcit oder Mn-Calcit eingewachsen. In Drusen können hochglänzende Kristalle bis zu 3 mm beobachtet werden. Gleiches lässt sich durch Weglösen des Calcits mittels HCl erreichen. Der Braunit ist in kleinen Kristallen magnetisch.
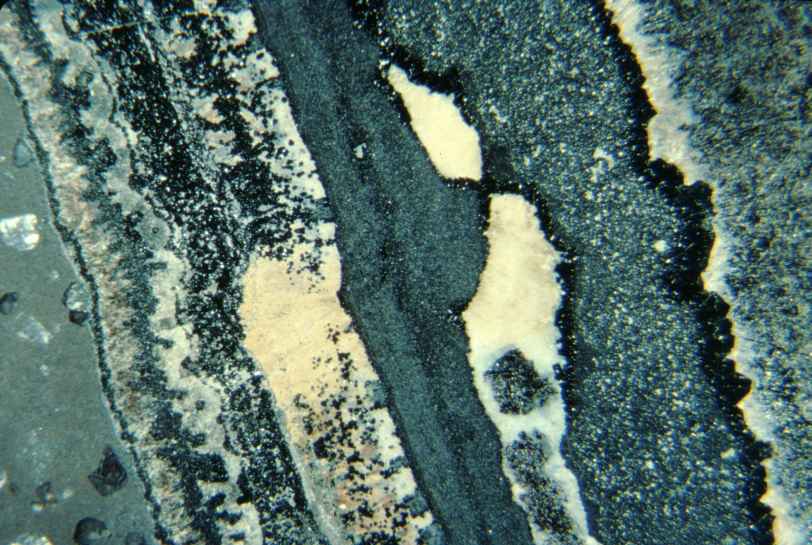
Braunit im Erzanschliff
Bildbreite 5 mm
Eine Stufe aus dem Gang besteht aus cm-großen, skalenoedrischen Braunit-Kristallen, die von leistenförmigen Kristallen überzogen sind. Wahrscheinlich handelte es sich ursprünglich um ehemalige Calcit-Kristalle mit daraufsitzenden Manganit-Kristallen, die beide vom Braunit pseudomorph verdrängt wurden. Inzwischen konnten auch solche Übergangsstadien gefunden werden, bei denen ein Calcit-Rest zu beobachten ist.
Bei der chemischen Untersuchung (Röntgenfluoreszenz-Analyse)
einer derben Braunit-Probe konnte ein deutlicher As-Gehalt von ca.
1% nachgewiesen werden. Inzwischen konnte auch ein geringer
Urangehalt in den derben Partien des Braunits nachgewiesen werden.
Er liegt deutlich messbar (bis ca. 10-fach) über dem Hintergrund
der anderen Mn-Mineralien.

Gangfüllung aus feinkörnigem Braunit mit Carbonaten im Rhyolith,
der
ausgehend von den Spalten mit Braunit imprägniert wurde. Im Innern
des
Rhyoliths ist fast keine Alteration zu erkennen,
Bildbreite 7 cm
Eine Erzbrekzie aus mit Braunit imprägniertem, dunklem Rhyolith und derbem Braunit stand im Sommer 1991 auf der 3. Sohle an. Der ca. 1 m mächtige Gang führte zum Liegenden hin fast nur Hämatit und ging nach oben hin in den beschriebenen Mn-Erzgang über.
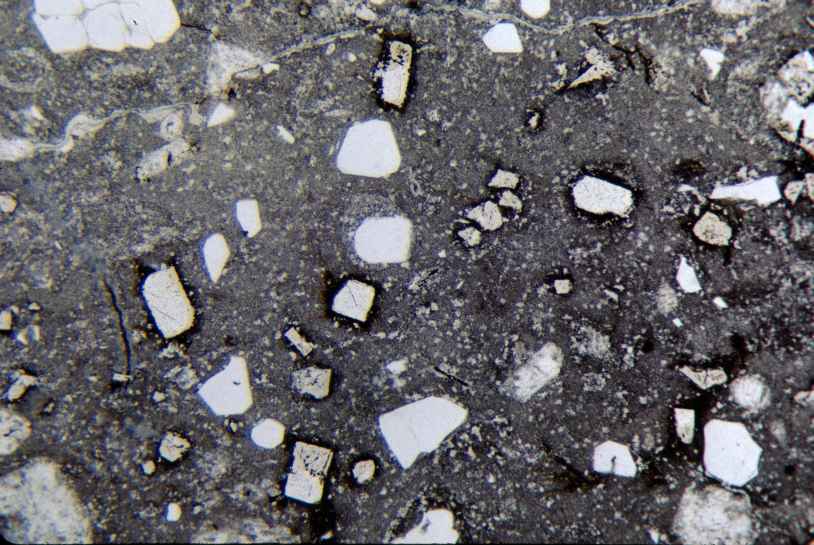
Partielle Verdrängung von Braunit im Feldspat des Rhyoliths,
Bildbreite 5 mm
An der Grenze zur 2. Sohle war der Gang nur ca. 0,3 m mächtig, bestand aber fast ganz aus Braunit. In der Mitte wurde er von einem ca. 2 cm breiten, drusigen Bereich durchzogen, in dessen Hohlräumen sich eine Vielzahl von interessanten Mineralien (Arseniosiderit, Quarz, Todorokit, Kryptomelan und Goethit) fanden.
Im Calcit-Gang der 4. Sohle konnte neben den verbreiteten
kleinen, "oktaederähnlichen" Kriställchen auf und im Calcit auch
derbe Massen in bis zu 5 cm großen Stücken gefunden werden. Sie
bestehen aus einem "Konglomerat" mm-großer, schalig aufgebauter
Aggregate, die gemeinsam mit imprägnierten Rhyolith-Stückchen
größere Stücke, die erneut vom schaligem, sehr feinkörnigem
Braunit umgeben sind (diese Strukturen sind nur im Anschliff
erkennbar). Die merkwürdigen Stücke sitzen regellos in weißem,
körnigem Calcit bzw. im damit verwachsenem Seladonit.
In der Paragenese mit dem Brandtit
der 4. Sohle konnten auch 0,5 mm große, braune Pseudomorphosen von
Mn-Calcit nach Braunit gefunden werden.
Der gleiche Gang lieferte zahlreiche, bis cm-große Drusen mit
herrlichen, stark glänzenden, aber nur max. 2 mm großen
Braunit-Kristallen auf weißem Calcit und von einer dünnen
Calcit-Schicht teilweise überkrustet. Als Begleitmineralien fanden
sich noch Mn-Calcit, Quarz und weißer Baryt.
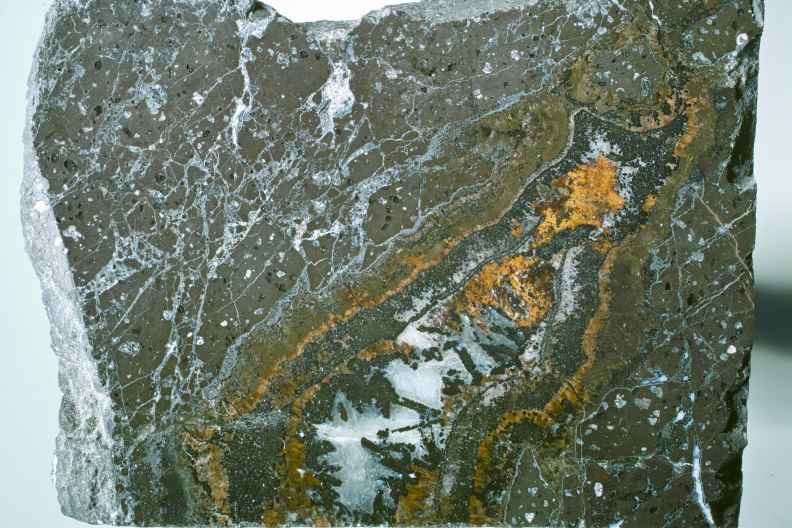
Im brekziösen, mit Braunit imprägnierten Rhyolith ist der einst
zentrale Ganginhalt
umlaufend mit Calcit und feinnadeliger Manganit gefüllt worden.
Die Braunite
sind hier zonar aufgebaut, der Manganit zum größten Teil in
Manganocalcit
umgesetzt und mit Braunit überkrustet; angeschliffen und poliertes
Stück,
Bildbreite 6 cm.
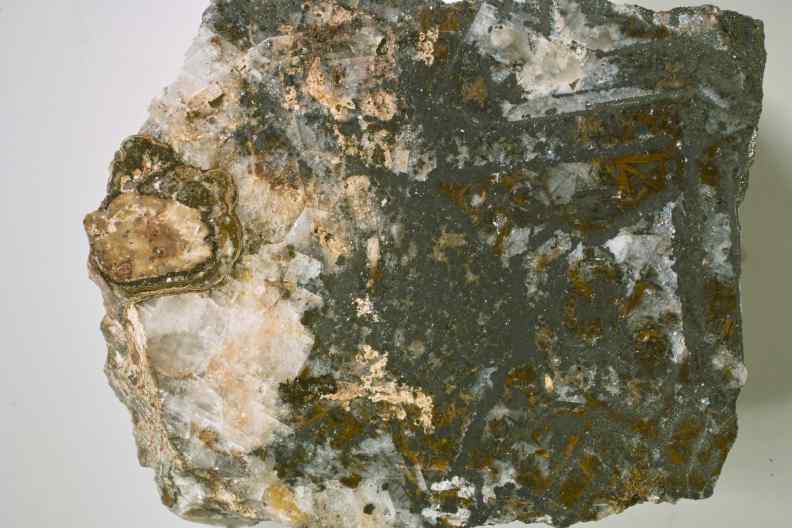
Königer Braunit im Calcit und Fluorit, teils im farblosen Calcit
die Pseudomorphosen
von Manganit nach braunem Manganocalcit. Ein Teil des Braunits ist
völlig in Mn-Calcit
und Illit umgewandelt, dazu gesellt sich noch Arseniosiderit. Ein
Rhyolith-Bruchstück ist
von Manganit, Calcit und Seladonit umkrustet, geschliffen und
poliertes Stück,
Bildbreite 6 cm.
Auf und im Calcit eingewachsen konnten zahlreiche, teils größere
Kristalle (<3 mm) gefunden werden. Teilweise sind die Spitzen
der tetragonalen Pyramiden durch die Basis begrenzt. Dabei handelt
es sich (röntgendiff. nachgewiesen) um einen Mn-Mn-Braunit.
Die Gänge erweisen sich weiter als sehr variabel. Nesterweise
tritt immer wieder Braunit mit etwas Hausmannit
auf. Für Teile davon wäre der Begriff Kokadenerz zu verwenden.
Zwei Stücke aus dem Bereich wurden angeschliffen, um die hübsche
Struktur erkennbar zu machen. Insbesondere ist interessant, dass
ein Teil des Braunits in den Carbonaten "schwimmend" gebildet
wurde.
Südlich der beiden bisher bekannten Gänge ist ein neuer, aber für die Teufe erstaunlich stark zersetzter Mn-Gang erkennbar. Er ist samt Imprägnationsbereich bis zu 50 cm mächtig. Zusammen mit gelbem Arseniosiderit auf 2 Generationen von Calcit aus dem Gang der 4. Sohle finden sich kleine, gesprenkelte, 0,5 mm große Braunit-Kristalle die alle in einen weißlichen Mulm unter Beibehaltung der "oktaedrischen" Form umgewandelt sind.
Zusammen mit den typischen, aus kleine Kristallen bestehenden Braunit wurde im Carbonat ein feinfaseriges Mineral beobachtet und als Manganit angesprochen. Die röntgendiffraktometrische Untersuchung erbrachte eindeutig Braunit, so dass hier eine Pseudomorphose von Braunit nach Manganit oder Pyrolusit vorliegt.

Ganginhalt aus Calcit mit Kutnahorit, darin wurmförmig
eingewachsene
Braunit-Kristalle, die im Innern teilweise oder ganz aus
Mangancalcit und
Tonmineralien (Pseudomorphosen) bestehen,
Bildbreite 4,5 cm.

Ungewöhnliches Gangsstück aus dem Rhyolith (links am Rand) aus
netzförmigem
Braunit, Rhodochrosit, Mn-Calcit (z. T. als Pseudomorphose
nach Braunit,
besonders unten), Arsensioderit (in der Mitte), Calcit in den
ehemaligen
Anhydrit-Hohlräumen,
Bildbreite 14 cm
Braunit
II Ca(Mn3+,Fe3+)14SiO24
Im Schliff erkennbar, wurden auch Partien gefunden, bei denen der
Braunit zum Teil fast ganz, von Mn-Calcit verdrängt wird.
Insbesondere das Innere der bis zu 2,5 mm großen Kristalle ist
davon betroffen.
Es scheint so zu sein, dass die randlich und auf den
Calcit-Kristallen sitzenden Braunit-Kristalle immer Braunit im
eigentlichen Sinn darstellt, während es sich bei den großen
Brauniten im Innern der Calcite bzw. die stumpf glänzenden
Kristalle in dem Gängen um den Braunit II handelt.
Hämatit
Fe2O3
Auf vielen Klüften tritt Hämatit bis einige mm dick als sogn.
"Eisenrahm" auf. Dies verursacht, gemeinsam mit dem im Gestein
selbst feinst verteilten Hämatit, die oft starke, rötliche
Färbung, besonders der stark geklüfteten Partien. Oft wird er
zusammen mit dem in den Klüften ebenfalls vorhandenen Tonen vom
Regenwasser ausgewaschen. Diese Klüfte treten insbesondere im
südwestlichen wie auch im nördlichen Teil des Bruches auf. Auch
auf den wenigen, N-S streichenden Klüften ist das Hämatit-Ton(Illit u. a.)-Gemisch zu
finden. Die Breite der Klüfte kann 5 cm erreichen. Sie können dann
völlig mit einem Gemisch aus erdigem bis schuppigem, feinsten
Hämatit und einer Gangbrekzie gefüllt sein. Der Hämatit hat einen
Anteil von >80%, weshalb das hohe Gewicht auffällt. Nach dem
Trocknen zerfällt das Gemenge zu einem staubfeinen, alles rot
färbenden und benetzenden Pulver. Einzelne Teilchen sind so fein,
dass sie auch auf Wasser, welches mit einem Netzmittel versehen
ist, schwimmen.

Schmierig-toniger Hämatit mit Wasser als breiige Masse aus einer
Kluft im
Rhyolith, Bildbreite ca. 15 cm,
aufgenommen am 24.08.2013 auf der untersten Sohle.

Mit Calcit verwachsener Hämatit aus einem Gang der 5. Sohle;
Bildbreite ca. 10 cm
Die ersten bemerkenswerten Hämatit-Funde waren strahlige Massen, die einige mm-dick die Kluftflächen des Rhyolithes auf der 1. Sohle überzogen. Sie erreichten Längen bis zu 5 cm. Weitere Begleitmineralien traten nicht auf.
In den intensiv zerrütteten Partien einer fast reinen
Hämatit-Vererzung tritt der Hämatit als "Kittmasse" auf, der
zusammen mit von Hämatit durchsetztem Rhyolith eine kompakte
Kluftbrekzie bildet. Im Handstück ist es dann oft schwer, die
einzelnen Komponenten visuell zu trennen. Bis zu m3 große Blöcke
konnten schon 1971 auf der 1. Sohle - allerdings nicht anstehend -
gefunden werden.
Häufig findet sich der Hämatit als Auskleidung aus tafeligen
Kristallen in schmalen Spalten und Hohlräumen. Die Farbe variiert
mit dem Grad der Verwitterung von metallisch blau (bei
unveränderten) über gelb (als "Anlauffarbe") bis hin zu braunen
Verwitterungsrinden als Überzug auf den Tafeln. Meist gesellt sich
noch - nicht entfernbarer - Ton hinzu. Dünne und kleine Kristalle
sind rötlich durchscheinend und zeigen einen lebhaften Glanz.
Selbständige, bis zu 8 cm mächtige, grobspätige Spaltenfüllungen aus hochglänzendem Hämatit - einzelne Hämatit-Tafeln erreichen cm-Größe - mit sehr wenig Calcit konnten auf der 3. Sohle innerhalb eines mächtigen, brekziösen Hämatit-Ganges beobachtet werden.

Hämatit im Anstehenden,
aufgenommen am 10.06.1993
Hier wurden als Besonderheit Umhüllungspseudomorphosen von Hämatit nach Calcit gefunden. Sie werden bis über 10 cm lang, 5 cm dick und zeigen skalenoedrischen Habitus. Die Flächen sind manchmal nach innen gewölbt und außen immer mit Hämatit-Tafeln überwachsen. Die Wandstärke liegt in der Regel bei ca. 5 mm, das Innere ist ebenfalls mit tafeligen Hämatit-Kristallen ausgekleidet und/oder mit undeutlichen Aggregaten, gitterartig ausgefüllt. Selten sitzen bis 2 mm große, farblose Quarz- oder angewitterte Siderit-Kristalle auf und zwischen den Hämatit-Tafeln. Teilweise ist der Hämatit angewittert und mit feinem, sedimentiertem Hämatit-Grus überschüttet. Alle Hohlräume sind mit einem roten, nur schwer entfernbaren Ton (Gemenge aus Illit und Kaolinit) gefüllt. Im Innern der mit Ton ausgekleideten oder gefüllten Hohlräume liegen lose, eiförmig runde Tonkügelchen, als hätte fließendes Wasser sie geformt. Wie die Bruchflächen am Hämatit zeigen - man kann die neuen Bruchflächen deutlich von den alten unterscheiden -, ist die Druse schon vor langer Zeit in einzelne Stücke zerfallen. Auch kommen Negativformen von Calcit-Kristallen in derbem Hämatit vor.
Faseriger, sphaerolithischer Hämatit bildet roten Glaskopf mit
rauher Oberfläche. Die runden Gebilde erreichen cm-Größe und
sitzen auf derbem Hämatit. Innerhalb des Calcits treten neben den
Mn-Mineralien auch cm-große, unregelmäßige, derbe
Hämatit-Einschlüsse auf. Die Einschlüsse sind meist mit einem Saum
aus Limonit mit
Calcit-Relikten umgeben.
Auf der 3. Sohle wurden innerhalb der Calcit-Gänge Rasen
rosettenartiger, hochglänzender Blättchen beobachtet. Sie
erreichen ca. 0,02 mm und sind mit dem Binokular wegen des Glanzes
kaum zu erkennen. Teilweise sind die Kristalle auch gänzlich im
Calcit eingewachsen und geben ihm ein bräunliches Aussehen. Vom
Todorokit und vom Mn-Analogon zu Arseniosiderit ist der Hämatit
nur schwer zu unterscheiden.

Idiomorphe, blättrige Hämatit-Kristalle (kein Braunit!) auf
Calcit,
Bildbreite 4 cm
Im Rhyolith - nahe der Vererzungen - kann beobachtet werden, dass ein Teil der Feldspäte, mit zunehmender Nähe zum Erzgang, teils oder ganz in Hämatit umgewandelt wurde. Der Hämatit bildet dann erst Blättchen zwischen den noch vorhandenen Feldspatresten, bei weiterer Einwirkung wird schließlich der ganze Feldspat vom Hämatit verdrängt. Es liegt somit eine Pseudomorphose von Hämatit nach Feldspat vor.
In Hohlräumen der Quarzgeoden (Lithophysen)
bildet der Hämatit, wenn auch selten, dicktafelige,
kantengerundete und stark glänzende Kristalle, die auf
Quarzkristallen oder seltener in diese eingewachsen sind. Häufig
sind die Hohlräume mit lockerem, blättrig-schuppigem Hämatit
ausgefüllt.
Selten wurden Pseudomorphosen von Hämatit nach Baryt gefunden.
Der brekziöse Erzgang - reich an erdigem Hämatit - führt an einer
Stelle an der Grenze 3. zur 4. Sohle einen Bereich mit
grobtafeligem, drusenreichem Hämatit. Dicktafelige Kristalle
kleiden bis zu faustgroße Hohlräumen aus. Sie bestehen aus vielen
sehr dünnen, parallel verwachsenen, dunklen und hochglänzenden
Tafeln. Ihre Größe erreicht in der Mitte max. 1 cm, um zum Rand
hin abzufallen. Diese Kristallbüschel zeigen einen seidenen
Schimmer in den Drusenhohlräumen. Orientierte, parallel
verwachsene Kristalle werden bei gleicher Größe bis zu 1,5 mm dick
- sie sehen aus, als blicke man auf die Seiten eines schlecht
gebundenes Buches. Sonst sind die Hämatit-Tafeln sehr dünn und
empfindlich. Die Blättchen sind gewöhnlich dunkel, zeigen oft den
typischen Metallglanz und sind teilweise auch bunt angelaufen. Sie
sind sehr empfindlich, insbesondere auch Matrixstücke mit noch
anhaftendem Rhyolith, was auch eine Folge der nahen Sprengung ist.
Grobtafelige bis strahlig-tafelige und feinkörnige Partien
wechseln einander ab.

Assymmetrische Gangfüllung aus brekziiertem Rhyolith, darüber
tafeliger Hämatit und reichlich Fluorit
(dunkel erscheinende Einschlüsse) und final ausgefüllt mit weißem
Calcit - erkennbar an den beiden kleinen
Drusen; gefunden auf der untersten Sohle 2011, angeschliffen und
poliertes Stück
Bildbreite 9 cm,
Teilweise ist das blättrige Eisenerz auch Bindemittel für die mit
feinstem Hämatit imprägnierte Rhyolithbrekzie. Der Bereich mit dem
bis zu 10 cm mächtigen, blättrigen Hämatit konnte vom Autor über
mehr als einen m² verfolgt werden. Die gesamte Ausdehnung war
nicht größer als ca. 3 - 4 m², wobei der größte Teil des Materials
in den Brecher gelangte.
An wenigen Stellen ist eine Verwitterung zu Limonit erkennbar. Die
brekziösen Randpartien im Übergang zum Rhyolith sind meist mit
dünnem, glaskopfartigem bis rosettigem Hämatit überzogen. Hier ist
der rote Ton auch mittels Ultraschall nur sehr schwer zu
entfernen.
Der von sedimentiertem Hämatit-Grus überzogene Kristallrasen ist
an einigen Stellen mit eindeutigen, netzartigen Schrumpfungsrissen
durchzogen. Die Risse werden bis zu 1 mm breit und 3 - 4 mm tief.
Die belegen möglicherweise einen gelartigen Zustand des
Eisenoxides während der Kristallbildung?


Massiver Hämatit im Calcit, mit Fluorit und Illit als Teil des
Ganginhaltes, im unteren Teil brekziös ausgebildet, .
Bildbreiten links 5 cm, rechts auf der angeschliffen und polierten
Seite 12 cm
Als weitere Begleitmineralien wurden noch samtige Überzüge aus Arseniosiderit, rissige,
schalige Pusteln von Pitticit
und glaskopfartige Massen von Uraninit gefunden.
Seltener ist auch warziger Todorokit. Die genannten Mineralien
werden max. 0,5 mm groß. Winzige Siderit-Kristalle
überziehen teilweise neben farblosen Quarzkristallen den Hämatit.
An den Übergängen zum unveränderten Rhyolith ist reichlich weißer,
erdiger Illit zu sehen.
Seltener sind schneeweiße, wirrtafelige Kristallaggregate in den
Hohlräumen der mit wenig Hämatit ausgekleideten Zwickel der
Brekzie.
Bemerkenswert ist auch eine deutliche, weit über dem gewöhnlichen
Hintergrund liegende, Aktivität von ca. 2 Bq/6cm².
Nördlich an den Gang anschließend konnte erneut ein dm-großer
Hohlraum - der leider schon vor langer Zeit zusammenfiel - mit den
cm-großen Pseudomorphosen von Hämatit nach skalenoedrischem Calcit
gefunden werden. Die Größe der "Kristalle" reicht von 0,5 bis zu 5
cm. Im Innern sind sie meist hohl und mit tafeligen
Hämatit-Kristallen, die auch rosettenförmig angeordnet sein könne,
ausgekleidet. Die Orientierung der tafeligen oder blättrigen
Hämatit-Kristalle liegt senkrecht zur den Kristallflächen.
Wenige der cm-großen Pseudomorphosen sind auch rundlich umgebogen
(Kristallspitzen oder auch bei größerer Flächen nach innen
gewölbt), was bei einigen Stücken für eine Umhüllung mit Hämatit
und nachfolgende Auflösung des Calcites spricht. Es handelt sich
dabei um Umhüllungspseudomorphosen, die manchmal auch aus mehreren
Schichten besteht.



Spektakuläre Pseudomorphose:
Skalenoedrische Hämatit-Kristalle als Pseudomorphosen nach Calcit.
Im mittleren Bild ist eine abgebrochene Spitze des ehemaligen
Calcit-Kristalls sichtbar, im rechten Bild sieht man, dass die
Oberflächen der Pseudomorphosen mit blättrigem Hämatit überwachsen
ist. Gefunden am 08.04.1990, damals völlig von Ton verdeckt.
Bildbreiten links 12 cm, Mitte 11 cm, rechts 8 cm.
Es wurden aber auch "echte" Pseudomorphosen gefunden, bei denen
eine Hämatit-Generation den Calcit ersetzt hat (im Querbruch oder
-schnitt erkennbar). Die Oberflächen der skalenoedrischen Flächen
sind samtig bis glänzend mit kleinen Hämatit-Täfelchen
überwachsen. Die Kristallnegative im Hämatit sind meist mit
glänzenden, rosettenartigen bis samtigen Hämatit-Überzügen
ausgekleidet. Selten treten auch bis zu mm-breite Schrumpfrisse in
den Pseudomorphosen auf.
Teilweise sind hier einzelne Partien mit mm-dicken Überzügen aus
traubigem, samtigen Todorokit und etwas Arseniosiderit
überkrustet. Weit seltener waren Umhüllungspseudomorphosen nach
einem tafeligen Mineral, welches in bis zu cm großen und mm-dicken
Platten vorkam. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um den im
Bruch verbreiteten Baryt.
In einem Fall konnte ein hochglänzender, leicht gewölbter und gestreifter Harnisch geborgen werden. Er belegt den seltenen Fall der Bewegung der Störung nach Ausscheidung der Mineralien.
Tonig erscheinende, graubraune Gemenge aus Hämatit, Quarz und sehr untergeordnet Calcit füllen bis zu 10 cm lange und 5 cm breite Calcit-Drusen des Calcit-Ganges der 4. Sohle. Als bemerkenswertes Begleitmineral tritt am Rand zum Calcit Bertrandit auf.
Tiefschwarze, glaskopfartig aufgebaute und oft stark glänzende Hämatit-Kügelchen mit einem Durchmesser von bis zu 0,5 mm fanden sich in den Drusen des dunklen, erzreichen Teiles des Calcit-Ganges der 4. Sohle. Auf den Bruchflächen ist der radiale, blättrige Aufbau und ein auffallender Glanz zu beobachten. Die Kügelchen sitzen auf einem Kristallrasen aus Kutnahorit. Als Begleitminerale, eingewachsen im Calcit, traten weiter auf: violetter Fluorit, kleine Braunit-Kristalle, Hämatit-Täfelchen, schuppiger, goldgelber Arseniosiderit und grünlicher, derber Seladonit und Dolomit.

Hämatit-Kugeln auf Kutnahorit,
Bildbreite 3 mm
Im grauen, von weißen Flecken durchzogenen Rhyolith von der 3. Sohle konnten aus der Ostwand auch runde Flecken aus Hämatit-Imprägnationen gefunden werden. Sie sind selten, auffallend dunkel und haben keinen ausgeprägten, scharfen Rand, sondern gegen diffus in den Rhyolith über. In den bis zu 3 cm großen und bis zu 5 mm dicken Linsen sind auch einzelne, bis zu 1 mm große Hämatit-Täfelchen erkennbar.
Kleine, stark glänzende, gedrungene Hämatit-Kristalle finden sich merkwürdigerweise im Calcit des Ganges von der 4. Sohle. Die bis zu 3 mm großen Massen sind regellos im Calcit verteilt.

Glaskopfartiger Hämatit als dünner Kluftbelag auf Rhyolith mit
einer finalen
Füllung aus Tilasit mit Calcit,
Bildbreite 5 mm
Als feinkristalliner, fast faseriger Hämatit findet sich auf und von Calcit durchzogen als eine der frühen Ausscheidungen unter weißem Calcit. Die bis zu 3 mm dicken Überzüge sind auch kugelig-schalig ausgebildet, besitzen aber eine "rauhe" und damit matte Oberfläche, so dass die Trennung vom Calcit nicht leicht möglich ist. Das gemeinschaftlich Vorkommen mit den anderen Mn-Mineralien ist so zu erklären, dass der Hämatit an anderer Stelle gebildet wurde und infolge tektonischer Bewegungen gelöst und mittels der hydrothermalen Flüssigkeiten an andere Stellen transportiert wurde.
Als kleine, gedrungene Kriställchen und strahlige Büschel von bis zu 2 mm große findet sich stark glänzender Hämatit im Calcit und Kutnahorit der 4. Sohle. Die Körnchen sind magnetisch und besitzen keinen roten Strich! Mittels Röntgendiffraktometrie wurde das Mineral sicher als Hämatit bestimmt.

Außen unscheinbares Stück aus der Gangzone der 6. Sohle (gefunden
2009 als loses Stück
im Haufwerk, angeschliffen und poliert) mit einer bemerkenswerten
Mineralisation:
Ganz links erkennt man den alterierten Rhyolith, dann folgt eine
braune Zone aus Calcit mit
Arseniosiderit. Der sich anschließende dunkle Streifen besteht aus
Hausmannit und Braunit,
dazwischen Calcit und Mangancalcit; ein Teil der Braunite sind
extrem zoniert. Nach rechts
schließt sich eine Zone aus Calcit mit Illit und Seladonit an.
Über den bogenförmigen
Calciten ist Hämatit eingewachsen und den Abschluss nach rechts
bildet ein Rasen aus
gelblichen Calcit-Kristallen in nadeliger Form.
Bildbreite 13 cm.

Calcit-Gang mit eine mittigen Drusenzone, ausgekleidet von weißen,
skalenoedrischen Calcit-Kristallen. Diese sind überstäubt von
kleinen
Hämatit-Kristallen als Blättchen,
Bildbreite 4 cm.
Quarz SiO2
In den Hohlräumen und Rissen der "Knollen" (Lithophysen) treten,
besonders wenn sie wenig Chalcedon
enthalten, bis zu 10 mm große Quarzkristalle auf. Sie sind farblos
bis weiß, auch gelblich, durchscheinend bis durchsichtig. Sie
fluoreszieren bei der Bestrahlung mit UV-Licht, besonders bei
kurzwelligem UV-Licht (254 nm) sehr intensiv gelblichgrün. Die
Fluoreszenz wird wohl durch den Einbau von Uranyl-Ionen
hervorgerufen.

In den verkieselten Partien des Rhyoliths der 1. Sohle treten quarzgefüllte Risse auf. Sie werden bis zu 3 cm mächtig und sind drusenreich. In ihnen erreichen schmutzigweiße bis bräunliche Kristalle Größen bis zu 1,5 cm. Teilweise sind sie mit kleinen, parallel zur c-Achse orientierten Kristallen, die auf den Prismenflächen aufgewachsen sind, versehen (Sprossenquarze).
Selten sind auf Hämatit-Rosetten aus den Erzgängen kleine (1 mm) farblose Quarzkristalle aufgewachsen, die ihrerseits mit Calcit überzogen sind. Auf der 3. Sohle wurden als Seltenheit bis zu 1 mm große, doppelendige Quarzkriställchen gefunden. Sie sind in Hohlräumen weißen Calcits auf dessen Kristallen aufgewachsen. Die klaren, farblosen Kristalle sind durch "wolkige" (?) Todorokit-Einschlüsse dunkel gefärbt. Bis 3 mm große Quarzkristalle, die ein einseitig mit Hämatit-Schüppchen bestäubtes Phantom erkennen lassen, wurden im Quarz aus der Kontaktzone des Muskovit-Biotit-Gneises geborgen.
Klüfte oder Harnischflächen, die später mit Baryt gefüllt wurden zeigen deutliche Lösungserscheinungen auf den Gesteinsflächen. Davon sind besonders die Feldspäte betroffen. Die in die Kluft regenden Quarze wuchsen als farblose, bis zu 5 mm großen idiomorphen, glänzenden Kristallen heran. Merkwürdigerweise liegt oft die c-Achse der Kristalle parallel zur Kluftwand.
Selten lassen sich in gelben, limonitisierten Partien der Fe-Mn-Konkretionen aus den Zechstein-Sedimenten, bis 0,5 mm lange, gelbe Quarze beobachten.
In mit Todorokit
ausgekleideten Hohlräumen des derben Braunits von der 3. Sohle
können bis zu 1 mm große, farblose, klare, stark glänzende
Quarzkriställchen und -aggregate gefunden werden. Auf Todorokit
aus dem Erzgang der 3. Sohle sitzen oft rundliche, löchrig-poröse,
weiße bis schmutzigbraune, bis zu 3 mm große Quarz-Aggregate. An
einigen Stellen sind die typischen Pyramiden des Quarzes zu
erkennen. An einem ungewaschenen Stück konnten noch Blättchen aus
Arseniosiderit innerhalb
des Quarzes beobachtet werden. So ist anzunehmen, dass in den
Hohlräumchen der Quarzaggregate einst Arseniosiderit-Blättchen
saßen. Nach dem Weglösen blieben die porösen Quarze übrig.
In den weißen Calcit-Adern
treten selten auch weiße, "pfeilförmige", stark verzerrte
Quarzkristalle auf. Sie sind max. 3 mm groß, völlig mit
Ätzgrübchen bedeckt. Sie treten auch als bis zu 10 mm große,
flache, schmutz-weiße Aggregate auf und lassen sich nur nach
Weglösen des Calcites mit Säuren finden.
Im Grenzbereich zwischen Rhyolith und dem benachbarten Muskovit-Gneis auf der 1. Sohle konnten senkrecht einfallende und West-Ost streichende, cm mächtige Gänge mit Quarzkristallrasen und strahlige Quarz-Aggregate gefunden werden. Die Kristalle sind durchscheinend bis durchsichtig, grau bis farblos, glänzend, oft radial angeordnet und werden bis max. 15 mm lang. Teilweise sind in ihnen kleinste, schwarze Körnchen (wahrscheinlich Fe-Erz) eingeschlossen.
Undeutlich kristallisierter bis körniger, weißer Quarz findet
sich eingestreut in den Calcit-Gängen der 4. Sohle. Die bis zu 10
mm großen, flachen Aggregate sind schmutzig-weiß und lassen sich
nur durch Weglösen des Calcits gewinnen. Einzelne Kristalle zeigen
Lösungserscheinungen.
Zusammen mit Hämatit füllt eine "tonige" Masse aus feinstem Quarz
mit Hämatit die Hohlräume und Drusen im Calcit aus. Als
Begleitmineral tritt Bertrandit auf.
Auf einer sehr dünnen Kluft der 4. Sohle konnten durch den
einstigen Riss gespaltene Quarz des Rhyolithes in den Kluftraum
weiterwachsen. Die farblosen, flachen bis länglichen Kristalle
erreichen ohne weitere Begleitmineralien Größen bis zu 2 mm.
Stark glänzende, farblose, bis zu 1 mm große Quarz-Kristalle
finden sich als letzter Überzug auf Calcit-Kristallen der
Paragenese mit dem Brandtit.
Völlig farblose, hochglänzende Quarzkristalle (bis zu 3 mm) sind
oft in den Calcit-Drusen innerhalb des Kutnahorit aufgewachsen.
Dazwischen sitzt eine zuckerartige Masse aus winzigsten,
sedimentierten Quarzkriställchen. Einzelne Calcit-Kristalle ragen
daraus hervor.
Chalcedon
SiO2
In der Kontaktzone zum
Muskovit-Biotit-Schiefer, die zu einem zähen, grauen Ton
verwittert ist, treten an Konkretionen erinnernde "Knollen"
(Lithophysen) auf, welche eine Größe von 1-25 cm erreichen (das
größte Stück liegt in der Sammlung BEISLER, Glattbach). Sie sind
länglich-oval bis kugelrund mit "blumenkohl-ähnlichen"
Ausbuchtungen. Die Hälfte von ihnen enthält eine Quarz- oder Chalcedon-Füllung.

Lithophyse mit einer warzigen Oberfläche,
Bildbreite 12 cm
Die Füllung ist bei Lithoophysen von der gleichen Fundstelle (Bereich von etwa 1 m) ähnlich; d. h. es konnten Bereiche beobachtet werden, die sehr viele, gut ausgebildete Knollen führten, die aber alle keinen Chalcedon enthielten! Andere Bereiche führten Knollen mit Hämatit, Limonit und Ton. Nur wenige Stellen - meist ein grauer, zäher und "fetter" Ton führte die Chalcedon haltigen Knollen. Die Bereiche lagen recht nahe an der Grenze zu den Zechstein-Sedimenten.

Achat in einer Lithopyhse aus Sailauf,
Bildbreite 10 cm
Weniger als 10 % der Chalcedon führenden Knollen enthalten Risse
und verbliebene Hohlräume. Der Chalcedon ist meist mehr oder
weniger deutlich gebändert (Achat) und zeigt als Besonderheit
waagrechte Schichtung ("Uruguay-Achat"). Die Farbe wechselt von
farblos, weiß, grau, braun bis zu einem intensiven Rot. An Stücken
mit weißen Lagen ist beim Bewegen manchmal ein "wogender Schimmer"
festzustellen. Es liegt nahe, dehalb auf einen faserigen Aufbau zu
schließen, ähnlich dem des sogenannten "Tigerauges". In
Wirklichkeit handelt es sich um einen optischen Summen-Effekt.
Rasterelektrionenmikroskopische Unttersuchungen haben ergeben
ergeben, dass der Chalcedon aus winzigen Körnern <1 m besteht.
Der Wechsel der Korngröße und -packung erzeugt gemeinsam mit
färbenden Bestandteilen die Bänderung. Auch wurden transparente
Teile und sehr fein gebänderte Formen gefunden .
In wenigen Fällen können ganz mit grobkristallinem Quarz gefüllte
Hohlräume beobachtet werden. Auch die umgekehrte oder wiederholte
Abfolge (Chalcedon-Quarz-Chalcedon-Quarz) kommt vor.
Selten sind die Stücke, in denen mit Quarzen ausgekleidete Drusen
vorhanden sind. Die einzelnen Kristalle sind farblos bis braun, es
wurden auch schöne Rauchquarze (bis 5 mm, Sammlung VORBECK,
Goldbach) und selten schwach violett gefärbter Amethyst in den
Chalcedon-Geoden gefunden (Sammlung STOLZENBERGER,
Alzenau-Hörstein).
Die Quarzkristalle können
hochglänzend sein, sind jedoch oft angeätzt oder von einem sehr
dünnen Rasen einer 2. Generation kleinster Quarze überkrustet.
Bedeutende Belegstücke befinden sich auch in den Sammlungen
BEISLER, Glattbach, GRÄSSEL, Aschaffenburg, STOLZENBERGER,
Hörstein, VORBECK, Goldbach und WEIS, Schneppenbach.
Rechteckig-prismatische Hohlräume, die bis zu einigen cm Größe
erreichen, innerhalb des Chalcedons oder an dessen Rand zum
Rhyolith deuten auf weggelöste Baryte
hin.
Erstaunlicherweise verändern sich die Farben der Achate trotz dunkler Lagerung im Keller. Die beim Aufschneiden kräftigen Farben verblassen leider zu grauen und braunen Tönungen. Nur die kräftigsten Rottöne bleiben gut erhalten. Bekannt ist dieses Phänomen auch von brasilianischen und sächsischen Achaten.

Unscheinbare Lithophyse von der 1. Sohle mit einer länglichen
Füllung aus Achat und Quarz; im weißlichen
und grauen Rhyolith sind kleine Turmalin-Aggregate als dunkle
Punkte zu erkennen; das angeschliffene
und polierte Stück ist ca. 10 cm breit und wurde von Lothar STAAB
aus Mainaschaff gefunden.
Selten konnte in den verbreiteten Hohlräumen des derben Braunits spröder, brauner, Chalcedon beobachtet werden. Die bis zu 3 cm großen, blumenkohlartigen Aggregate sind von einer weißen Verwitterungsrinde überzogen. Bei der Bestrahlung mit kurzwelligem UV-Licht tritt eine dunkelgrüne Fluoreszenz auf.
Nierig-traubiger, milchig-trüber Chalcedon überzieht in mm-dicken, glasigen, weißen bis grauen, auch himmelblauen, glaskopfartigen Massen mit Calcit- und Arseniosiderit-Kristallen ausgekleidete Drusen innerhalb des Kutnahorit. Die Überzüge erreichen bis zu 15 cm2 Fläche. Einzelne, bis zu 3 cm lange Calcit-Drusen mit hellbraunem Calcit im rosafarbenen Kutnahorit sind völlig mit farblosem Chalcedon ausgefüllt (im Anschliff ist der feinfaserige Aufbau des Chalcedons zu erkennen). Zwischen dem Calcit und dem Chalcedon ist oft ein dünner Spalt zu beobachten. Einzelne weiße Calcit-Nadeln oder farblose Brandtit-Täfelchen sitzen manchmal auf dem Chalcedon. Zwischen nadeligen Calcit-Rasen schauen gelegentlich kleine, völlig farblose Kügelchen aus Chalcedon heraus, dir nur deshalb gut erkennbar sind, weil sich im Innern ein weißer Kern befindet. Die der Beschreibung zugrunde liegenden Funde stammen aus der Störung der 4. Sohle.
Ende April konnte erneut leicht bläulicher (insbesondere im
frischen, feuchten Zustand) Chalcedon aus dem Haufwerk gelesen
werden. Er ist teils von farblosen Quarzkristallen überzogen. Die
Besonderheit der cm-großen und bis zu 2 mm dicken Drusenüberzüge
ist die starke, sattgrüne Fluoreszenz bei Bestrahlung mit LW- und
KW-UV-Licht. Sehr undeutliche hellbraune, ca. 1 mm große,
rundliche Aggregate konnten ebenfalls als Chalcedon bestimmt
werden.

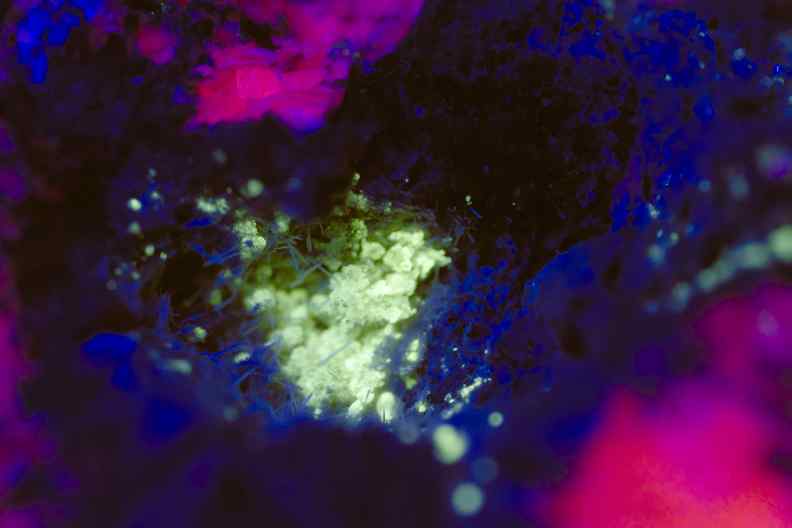
Zwischen braunem Kutnahorit und Calcit-Nadeln in einer Druse im
Gangmaterial aus Rhyolith, Calcit und Braunit, sitzen die
glaskopfartigen Massen
eines Chalcedon (links), der unter UV-Licht (rechts) gelb
fluoresziert,
Bildbreite 4 cm.

Calcit-Druse, überkrustet von einer mm-dicken Lage aus
transparentem
Chalcedon (ausnahmsweise nicht fluoreszierend),
Bildbreite 9 cm

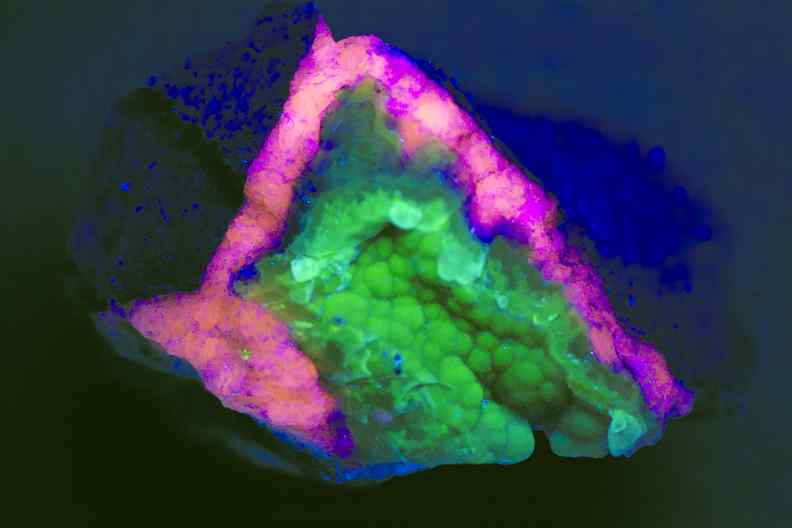
Chalcedon mit einem Rasen aus Quarzkristallen im Calcit des
Rhyolithes von Sailauf, links im Tageslicht, rechts im UV-Licht
mit der grünlichen
Fluoreszenz des Quarzes und der roten Fluoreszenz des Calcits,
Bildbreite 7 cm
Schneeweißer Chalcedon bildet 0,5 mm große, porzellanartige Kügelchen mit strahligem Aufbau auf braunem Kutnahorit. Daneben tritt noch etwas Arseniosiderit auf.
Auf der 1. Sohle konnte das Vorkommen von rotem Chalcedon nach
den ergiebigen Regenfällen des Winters erneut belegt werden. Die
Stücke aus einer mit Chalcedon (Karneol) verkitteten Brekzie mit
weißem Rhyolith finden sich in dem Hangschutt und bis heute nicht
an primärer Stelle, so dass über das Vorkommen im Anstehenden
nichts gesagt werden kann. Im Chalcedon sind Hohlräume sehr
selten. Begleitmineralien treten außer Quarz nicht auf. Die
geschnittenen und polierten Stücke sind recht hübsch anzuschauen.
Dabei ist zu erkennen, dass der im Bruch unscheinbare rote
Chalcedon im anpoliertem Zustand in der Regel aus lagigem
Chalcedon mit einer gemeinen Bänderung besteht. Die bis zu 5 mm
dicken Rissfüllungen enthalten daneben auch noch grauen bis weißen
Achat, selten auch mit einen Hohlraum, der von farblosen
Quarzkristallen ausgekleidet wird. Die Stücke der Rhyolithes
wurden bereits vor der Abscheidung des roten Chalcedons zerbrochen
und mit einem nicht gebändertem, grauen Chalcedon verkittet, wie
sich an den Bruchstellen feststellen lässt. Der Rhyolith ist stark
zersetzt und macht beim Anschleifen aufgrund der enormen
Härteunterschiede Probleme.
Opal SiO2·nH2O
In dünnen, jüngeren Klüften der Mn-Erzgänge treten in an Braunit
armen Partien mm-dicke Beläge aus farblosem bis gelblich-braunem,
wachsglänzendem Opal auf. Die im Bruch bis cm-großen Flächen
unterscheiden sich vom Chalcedon durch den charakteristischen
Glanz. Begleitminerale sind Calcit, Kutnahorit und sehr
untergeordnet Braunit.
Wie beim Chalcedon aus den hydrothermalen Mn-Vererzungen lässt
sich bei der Beleuchtung mit kurzwelligem UV-Licht (254 nm) eine
grüne Fluoreszenz beobachten.
Pyrolusit
MnO2
Der Pyrolusit besteht aus bis zu 8 mm langen und längsgerieften,
ca. 1 mm dicken, wirrstrahlig angeordenten Stengeln von
stahlgrauer Farbe und lebhaftem Glanz. Aufgrund der Form ist es
wahrscheinlich, dass es sich um eine Pseudomorphose nach Manganit handelt.
Begleitminerale sind Braunit,
Kryptomelan
und Todorokit.
Auffällig ist das völlige Fehlen Calcit. Das Stück stammt
wahrscheinlich aus der auffälligen, manganreichen Störung an der
Grenze zw. 2. und 3. Sohle.
Gemeinsam mit dem Hollandit
wurde in dem Gang mit Manganmineralien von der 3. Sohle mit
unscheinbaren Mn-Mineralien pulveriger Pyrolusit nachgewiesen. Es
handelt sich dabei um poröse, sehr weiche - von Todorokit nur
scher unterscheidbare -, bis zu cm-große Massen, die sehr stark
schwarz an den Fingern abfärben. Sie treten als partielle
Spaltenfüllungen wie auch als Hohlraumfüllungen innerhalb des
Hollandits auf. Die Größe erreicht dabei durchaus Flächen von bis
zu 1 dm² bei nur wenigen mm Dicke. Die rissigen Massen fallen
leicht ab bzw. aus den Hohlräumen des härteten Hollandits.
Manganomelane
Nicht näher bestimmbare Fe-Mn-Minerale, bilden auf Klüften häufig
und sehr weit verbreitet, hübsch mit dem hellen Rhyolith konstrastierend, sehr schöne
Dendriten. Neben den üblichen, moos- oder bäumchenförmigen
Dendriten treten auch gekeulte und punktförmige Dendriten auf. Die
Größe schwankt zwischen wenigen mm und 0,5 m für zusammenhängenden
Gebilde. Manche Klüfte sind jedoch über einige Meter verfolgbar,
mit Dendriten belegt.

Dendriten auf Rhyolith,
Bildbreite etwa 20 cm

Dendriten aus Manganoxiden als Kluftbelag im Rhyolith, Bildbreite
ca. 40 cm,
aufgenommen am 09.05.2013
Dendriten entstehen aus einem Hydroxid-Sol, welches in wässerigen Systemen leicht mitgeführt werden kann. Es wird somit selbst auf dünnsten Spalten aufgrund der kapillarer Wegsamkeit verteilt. Das frisch gefällte Mn-Hydroxid-Sol ist elektrisch negativ geladen und hydrophob. Es ballt sich zusammen und verliert dabei seine Kolloid-Eigenschaften und setzt sich als H2O-haltiges Mn-Mineral ab. Die immer getrennten und nie ineinanderwachsenen Dendritenenden sind auffällig. Die Ursache ist in der gegenseitigen Abstoßung der hydrophoben Kolloidteilchen in der Lösung zu suchen.
An der Nordwand der 4. Sohle wurde reichlich Mn-Mineralien neben
dem ged. Arsen gefunden.
Die senkrechten Klüfte waren reichlich mit bis zu 1 mm dick mit
dem Mn-Mineral überkrustet.
Bei einem schwarzen, spröden Mn-Mineral wurde neben reichlich Mn
auch noch Ca und K gefunden. Hier erbrachte die XRD eine
röntgenamorphe Phase. Somit liegt ein nicht näher bestimmbarer
Manganomelan vor. Es wäre nach gängiger Nomenklatur als Manganogel
zu bezeichnen; da der Grad der kristallinität auch von dem Gerät
abhängt, mit dem die Untersuchungen gemacht wurden, wird auf eine
Zuordnung vorläufig verzichtet.
Dendriten sind auch auf der 4. Sohle sehr weit verbreitet und oft hübsch anzuschauen. Auch tintenklecksartige Formen wurden um einen 1 cm großen, hellen Hof beobachtet. Im Zentrum fand sich nur etwas Illit und möglicherweise Arseniosiderit.

Tintenklecksartig verbreiterte Dendriten auf dem Quarzporphyr,
gefunden am 01.06.2014,
Bildbreite ca. 10 cm

Eigenartig sternfömrige Dendriten auf dem Rhyolith, gefunden am
01.06.2014,
Bildbreite ca. 15 cm
Kryptomelan
K<2(Mn4+,Mn2+)8O16
In bis zu cm-großen Hohlräumen des derben Braunits, der auch noch
Reste von Hausmannit
führte, fanden sich braune bis tiefschwarze, samtige Überzüge. Es
handelt sich um ca. 1 mm starke Krusten aus strahligem
Kryptomelan. Einzelne Nädelchen zeigen unter dem Mikroskop
lebhaften metallischen Glanz. Sie werden bei einem Durchmesser von
0,005 mm max. 0,2 mm lang. Die Kristalle besitzen quadratischen
Querschnitt. Die Kristallform und die Paragenese schließt eine
Verwechslung mit Todorokit aus. Eine Unterscheidung vom Manganit
ist schwierig. Der Kryptomelan geht in Kluftnähe in Todorokit
über. In einem Fall konnte auch derber Kryptomelan nachgewiesen
werden.
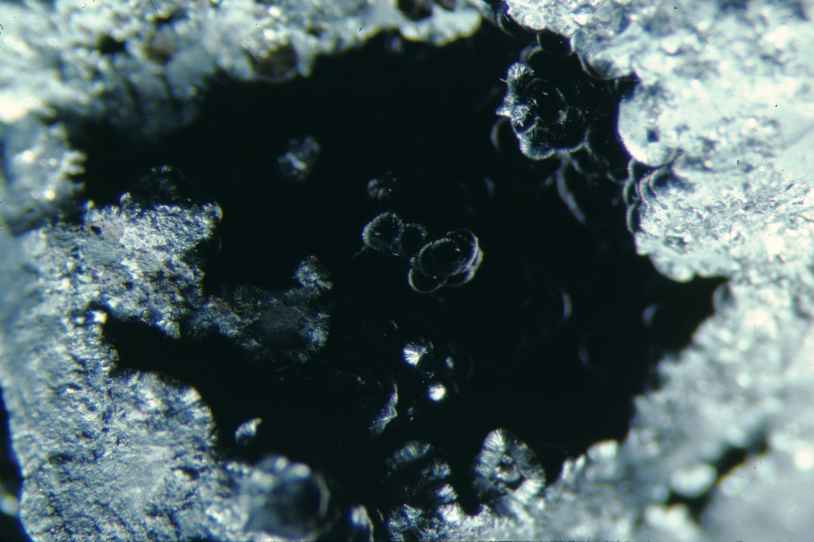
Samtige Kryptomelan-Nadeln,
Bildbreite 5 mm
Im Anschliff ist gut am sich absetzenden Kryptomelan zu sehen, dass sich um die mit nadeligen Kristallen ausgekleideten Drusen Bereiche aus derbem Kryptomelan-Erz befinden. Sie zeigen lagigen Aufbau und sind aus dem derben Braunit gebildet worden.
Zusammen mit den Manganmineralien Hollandit und dem
Pyrolusit wurden auch deutliche Mengen an Kryptomelan gefunden.
Der Fund des visuell kaum ansprechbaren Minerals innerhalb der
Verwachsungen mit weiteren Phasen stammte von der 3. Sohle
Westwand. Untersucht wurde die weiche, stark abfärbende Phase.
Hollandit
Ba2Mn8O16
Auf der 3. Sohle wurde beim weiteren Abbau der Manganmineralien
führende Gang erneut abgebaut. Er war stark aufgefiedert und
erreichte im Zentrum Mächtigkeiten von nur wenigen cm. Die
brekziöse Masse aus nur wenig verändertem Rhyolith war mit
hohlraumreichen Manganerzen gefüllt. Manchmal sind die schmalen
Klüfte völlig ohne Mineralien. Die meist nur wenige mm starke
Erzbändchen bestehen aus 2 Phasen, die stark miteinander
verwachsen sind, sich aber leicht unterscheiden lassen:
Todorokit
(Mn2+,Ca,Mg)Mn4+3O7·H2O
Er findet sich in der Form strahliger und blättriger Aggregate als
jüngste Neubildung in den Erzgängen in
Form samtiger und strahlig-knolliger Überzüge von silbergrauer bis
schwarzbrauner Farbe. Sie erreichen in nierig-traubiger Form
Größen bis 2 cm, ausnahmsweise auch 5 cm. Die strahligen Massen
sind von winzigen Braunit-Kristallen
durchsetzt. Die größeren Stücke sind sehr weich, stark abfärbend
und sehr leicht.

Todorokit mit Calcit,
Bildbreite 5 cm
Große Flächen der oft nur mm-dicken Klüfte können gänzlich von strahligem Todorokit überzogen sein. Sie sind dann im Querbruch nur schwer von den ähnlich aussehnden mit dem ged. Arsen zu unterscheiden. Hier hilft das Strahlenmessgerät schnell weiter. Todorokit ereicht nur in den zersetzten Partien selten eine Aktivität von max. 2 Bq/6cm2.
Der Calcit kann in weiten
Bereichen von Todorokit-Schüppchen durchsetzt sein. Im Extremfall
ist er dunklebraun bis fast schwarz und gänzlich von Wolken aus
feinstschuppigem Todorokit durchsetzt. Die sich in diesem Bereich
findenden Drusen beinhalten ebenfalls eine dichte Auskleidung aus
schuppigem Todorokit.
Einzelne Schüppchen, besonders wenn sie im Calcit eingelagert
sind, glänzen so, dass sie an Hämatit erinnern; diese und zu
Rosetten aggregierte Blättchen finden sich besonders in den
Calcit-Drusen. Verbreitet sind Überzüge auf anderen Mn-Mineralien
wie z. B. Braunit.
In den nur cm mächtigen Gängen mit Kutnahorit (auch auf der 4. Sohle) ist derber bis strahliger Todorokit das Verwitterungsprodukt des Kutnahorits. Er bildet hier nach Fortführung der Carbonate samtschwarze, rundliche Gebilde mit strahligem Aufbau, die von weißlichen bis gelblichen Resten der Carbonate begleitet werden. Der Todorokit durchsetzt netzartig bis knollig verdickt die zersetzten Carbonate. Nach Fortführung derselben bleibt nur noch der Todorikt übrig. Auch sind in der gleichen Paragenese deutliche Spuren von ehmals anwesendem Baryt bzw. Anhydrit zu sehen.
Die Unterscheidung von Arseniosiderit ist manchmal schwer, da beide Minerale nebeneinander vorkommen können und ähnliche, undeutlich ausgebildete Kristalle bilden. Ein gutes Unterscheidungsmerkmal ist die Farbe, Todorokit-Aggregate sind meist silbrig-grau bis samtbraun im Gegensatz zu Arseniosiderit, der in gelben bis goldenen Tönen vorkommt.
Im drusenreichen, derben Braunit
der 3. Sohle wurden schöne, strahlig aufgebaute, kugelig-nierige
Todorokit-Aggregate gefunden. Sie erreichten die Größe von
mehreren cm, sind meist samtig braun oder seltener mit glänzenden
Blättchen (erinnert an Hämatit) an der Oberfläche belegt. In der
Bruchfläche fällt lebhaft glänzend, der strahlige Aufbau auf.
Begleitet werden sie von Arseniosiderit, Quarz, Kryptomelan und
selten etwas verwittertem Siderit oder Pharmakosiderit.
Ab und zu sind auch Pseudomorphosen von Todorokit nach einem
grob-stengeligen, tetragonalen (?) Mineral (wahrscheinlich
Manganit) zu beobachten. Sie werden bis zu 10 mm lang und 2 mm
dick.
In einem Fall konnte Todorokit als kleine, samtschwarze Halbkugel
in einer Lithophyse
neben Baryt und Quarz festgestellt werden.

Dendriten aus Todorokit auf dem Rhyolith,
Bildbreite 20 cm
In den sedimentären Fe-Mn-Konkretionen der Zechstein-Sedimente am Rande bzw. über dem Rhyolith kommt typischer, strahlig-poröser, nierig-traubiger, samtgrauer Todorokit als letzte Abscheidung der bis zu mehreren cm großen Drusen auf Goethit vor. Die Aggregate erreichen kaum 1 cm Länge.
Auch der Todorokit ist in kleinen Stückchen (mg) deutlich
magnetisch!
Eine 3 mm starke Kluftfüllung aus derbem, teil strahligem
Todorokit, gemeinsam mit farblosem Apatit
als rasenartiger Belag aus winzigen, prismatischen Kristallen aus
wurde auf der 4. Sohle geborgen. Der Todorokit zeichnet sich durch
eine bemerkenswerte Radioaktivität aus (bis 25 Bq/6 cm2). Da keine
U-Mineralien zu erkennen sind, ist das U Todorokit enthalten.
Auch der samtige Todorokit in Teilen des stark brekziösen, locker
aufgebauten Erzganges, welcher neben etwas schuppigem Hämatit nur
noch braunen Goethit führt, ist deutlich radioaktiv.
Derbe, grauschwarze, ca. 0,5 mm dicke und cm2-große Beläge auf
gangparallelen Klüften innerhalb des derben Braunites von der 3.
Sohle bestehen aus Todorokit. Der Todorokit fällt durch seinen
halbmetallischen Glanz und den bläulichen Schimmer einer
Anlauffarbe (?) gegenüber den anderen, stumpfen Formen auf. Als
Begleitmineralien treten grauweißer Illit, körniger Braunit und in Drusen
Todorokit auf.
Romanechit
(Ba,Mn2+...)3(O,OH)6Mn8O16
Bis zu kopfgroße Anreicherungen von "Psilomelan" werden von
BÜLTEMANN erwähnt. Sie fanden sich in brekziösen Partien der 1.
Sohle und wurden von BÜLTEMANN als "offensichtlich
sekundärdeszendet verkittete Partien" gedeutet. Nach der
Beschreibung handelte es sich dabei um die inzwischen abgebauten,
obersten Zonen der Mn-Erzgänge. Eigene
Nachweise des Minerals stehen aus. Der Name Psilomelan wurde 1982
aus Prioritätsgründen von der IMA verworfen.
amorphes
Mn-Mineral (Manganogel)
Der größte Teil der Fe-Mn-Konkretionen aus den Zechstein-Sedimenten besteht aus einem
leichten, zellig-porösen, sehr weichen bis mittelharten, fast
erdigen bis glaskopfartigen Mn-Mineral. Da z. Zt. dafür kein Name
festgelegt wurde, kann auf den Begriff Manganogel zurückgegriffen
werden. Bei der Untersuchung mittels Röntgendiffraktometrie
stellte es sich als röntgenamorph heraus. Untersuchungen über die
chemische Zusammensetzung konnten bis heute nicht durchgeführt
werden.
Schwarze, rissige und muschelig brechende Massen füllen mm-dicke
Spalten auf m2-Flächen auch auf der 4. Sohle, oft schwarz
abgesetzt zum hellen Rhyolith. Auch sie erwiesen sich als völlig
röntgenamorph.
Brookit
TiO2
Im stark zerklüfteten, mit Baryt durchsetzten und von kleinen Quarz- und Hämatit-Kriställchen ausgekleideten
Klüften des an den Rhyolith grenzenden Muskovit-Biotit-Gneises
sind kleine, flaschen- bis lauchgrüne, durchsichtige, stark
blaugrün glänzende, tafelige Brookit-Kriställchen zu beobachten.
Die bis 0,5 mm großen Kriställchen sind im Baryt eingewachsen oder sitzen auf
den Klüften. Sie werden von Quarz begleitet und lassen sich leicht
mit dem ebenfalls hier häufig vorkommenden Hämatit verwechseln.
Uraninit
UO2
Auf Klüften des Rhyolithes treten metallisch, glänzende, dunkle
Flecken auf (siehe weiter unten). Sie bestehen zum größten Teil
aus ged. Arsen. Ein
kleiner Teil der Stücke enthält (unter dem Mikroskop deutlich zu
erkennen) pechartige, schwarze Massen von mehreren cm2 Fläche und
max. 1 mm Dicke. Sie sind von Schrumpfrissen durchzogen. Selten
sind in kleinsten Spalten nierige, schwarze Beläge oder runde
Pusteln, oft am äußeren Rand des ged. Arsens, der amorphen Form
des Uraninits als "Pechblende" zu beobachten. Als Begleitminerale
treten auf: ged. Arsen, eingewachsene, kleine unregelmäßige Pyrit-Körnchen, Calcit, Fluorit und
seltener, mit der UV-Lampe gut sichtbare, Uranospinit-Höfe auf.

Uraninit in Seladonit,
Bildbreite 7 cm
Im grünen Seladonit des über einige Meter verfolgbaren Ganges waren - wie bei dem ged. Arsen, hier aber schwarz und von Schrumpfrissen durchzogen - Flecken und Imprägnationen von Uraninit zu beobachten. Sie fallen durch ihre deutlich höhere Aktivität als beim ged. Arsen auf. Auch fehlt der typisch silberne Glanz frischer Bruchflächen. In schon etwas zersetzten Kluftteilen sind die rundlichen-linsigen Uraninit-Einschlüsse herausgewittert. Die sonst verbreiteten Alterationshöfe sind hier nur sehr schmal ausgebildet oder nicht vorhanden. Sekundäre Uranmineralien konnten hier nicht gefunden werden.
Auf Klüften des Rhyolithes kann wachsartig glänzender, muschelig brechender Uraninit bis zu 15 mm große Butzen bilden. Im Uraninit sind kleine Pyritkörner eingewachsen. Das Uranerz besitzt meist einen auffallenden Hof aus gelblichem Illit, Uranospinit und weiteren, noch nicht bestimmten "Uranglimmern".
Der Nachweis erfolgte aufgrund der starken Radioaktivität (es
wurde mit einem Spektrometer am VAK in Kahl 235U und 238U
nachgewiesen) und des Aussehens. Ein weiterer Hinweis ist das
Auftreten von Uranospinit-Höfen und das Fehlen des Überzuges aus
Arsenolith (Unterscheidung von ged. Arsen). Bei einer
röntgendiffraktometrischen Untersuchung vermeintlichen Arsens
wurde neben Illit eine nicht näher bestimmbare UxOy-Phase
gefunden. Aufgrund der recht geringen Radioaktivität handelt es
sich dabei um eine möglicherweise geologisch junge, amorphe
Uranoxid-Phase, möglicherweise U3O8.
Bemerkenswert ist auch das Vorkommen von glaskopfartigem Uraninit
(bis zu 2 mm) gemeinsam mit Todorokit, an der
Stelle, wo ein Auskeilen des Seladonits
auftrat und der Gang eine stärkere Zersetzung zeigte.
In einer Hämatit-Druse aus dem
Hämatit-Gang - nur wenige Meter von der Fundstelle des Uraninits
im Seladonit entfernt - konnten neben samtigen Arseniosiderit-Pusteln,
zahlreiche 0,5 mm große, glänzende Uraninit-Kügelchen festgestellt
werden.
Als Erstausscheidung in den dünnen Carbonatgängen von der 4. Sohle konnte neben wenig ged. Arsen auch etwas pechartiger Uraninit gefunden werden. Die cm-großen Flecke fallen durch ihre Radioaktivität auf.
Vom ged. Arsen nur schwer zu unterscheiden sind fast gleich
aussehende, runde Flecke, die jedoch ged. Arsen nur als
Nebengemengeteil führen. An diesen Stücken wurden bis zu 90
Impulse/6cm2 an Radioaktivität gemessen.

Unscheinbarer Uraninit (als Pechblende) mit ged. As auf
Rhyolith,
Bildbreite 4 cm
Kugelige, schwarze, oft isolierte Aggregate von nur 0,01 mm Größe
im ged. Arsen bzw. im Calcit konnten als Uraninit angesprochen
werden. Sie besitzen gegen den Calcit einen kleinen, deutlich
abgesetzten Bestrahlungshof. Die Kügelchen sind zu Gruppen
aggregiert. Die Entdeckung erfolgte im Anschliff; ohne diesen ist
ein Ansprechen nur aufgrund der Strahlung möglich.
"Limonit"
FeOOH·nH2O
Limonit als hell- dunkelbraunes, erdiges Gemenge verschiedener,
wasserhaltiger Fe-Hydroxide, ist weit verbreitet als Überzug auf
Hämatit und in dendritischer Form auf Klüften. Es konnten bis zu
faustgroße, weiche Klumpen in den Erzgängen festgestellt werden.
Seltener sind noch erkennbare Pseudomorphosen nach Hämatit oder
Siderit.
Auf der ersten Sohle fanden sich in den Zechstein-Sedimenten, lagenweise angereichert, zahlreiche, nur cm mächtige Fe-Mn-Konkretionen, die größten Teils aus Limonit, einem röntgenamorphen Mn-Mineral und Goethit bestehen. Hier ist der Limonit ebenfalls als Zersetzungsprodukt in mulmiger Form aufgetreten.
Auf den tieferen Sohlen konnte der Limonit nicht mehr so häufig
gefunden werden. Hier dominieren die primären Fe-Mineralien. Nur
in dem südlichen und östlichen, sehr tiefgründig zersetzten
Rhyolith tritt er noch häufig auf.
Goethit
FeO(OH)
Brauner, massiver und glaskopfartiger Goethit bildet bis zu 10 cm
dicke Lagen innerhalb der Fe-Mn-Vererzungen, die die Zechstein-Sedimente lagenartig
durchziehen. Den größten Anteil hat dabei ein röntgenamorphes
Mn-Mineral von erdiger bis glaskopfartiger Ausbildung. In kleinen
Hohlräumen ist er als dunkelbraune, im Querbruch als
faserig-seidenglänzende, glaskopfartige Masse ausgebildet.
Eingeschlossen finden sich weiße, kantige
Rhyolith-Stückchen.

Goethit in der Form von Dendriten auf dem Rhyolith,
aufgenommem am 02.03.2013,
Bildbreite ca. 30 cm
Eigenartigerweise sind hier an sehr wenigen Stücken (die meisten zeigen keine größere Aktivität als das umgebende Gestein) deutliche U-Gehalte vorhanden. Sie äußern sich durch die Radioaktivität, welche hier die größten Werte von allen Nicht-Uranmineralien erreicht.
An der Ostwand der 3. Sohle stand 1992 sehr stark zersetzter grauer bis weißer, fleckiger, felsitischer bis grobkörniger Rhyolith an. Teilweise waren auch deutliche, bogenförmige Fließstrukturen ausgebildet. In den hellen Schlieren und Partien wie auch an punktförmigen Bleichungshöfen war neben Illit und erdigem Goethit auch strahlig aufgebauter Goethit im Zentrum als bis zu 5 mm große Aggregate zu finden. Teils war der Goethit girlandenförmig auf Klüften aufgewachsen. Der Goethit zeigt eine deutliche Radioaktivität.
In den hydrothermalen Gängen tritt Goethit in Form von strahligen, bis ca. 5 mm großen, unregelmäßigen Butzen auf. Er ist in Calcit gemeinsam mit etwas feinem Hämatit und Kutnahorit eingewachsen. Die Farbe ist metallisch grau, wobei einzelne Schüppchen bräunlichgelb durchscheinend sind (Innenreflexe).
In Calcit-Drusen der 3. Sohle, aus dem Bereich der Hämatit-Erzzone bildet glaskopfartiger Goethit braune, teilweise lackartige oder bunt schillernde Überzüge auf dem Calcit. Teilweise ist er pseudomorph nach Calcit und Siderit und geht in erdigen Limonit über.
In Hohlräumen und auf Klüften des derben Braunits von der 3. Sohle fanden sich hellgelbe Krusten und gelbe, erdige Füllungen. Teilweise lassen sich auch Pseudomorphosen von max. 1 mm großen, ehemaligen Braunit-Kristallen beobachten. Eine röntgendiffraktometrische Untersuchung erbrachte, dass es sich dabei um Goethit handelt.
In den Quarzdrusen der Lithophysen ist
als Seltenheit Goethit in Form dünner Nadeln oder als
glaskopfartiger Überzug aufgewachsen.
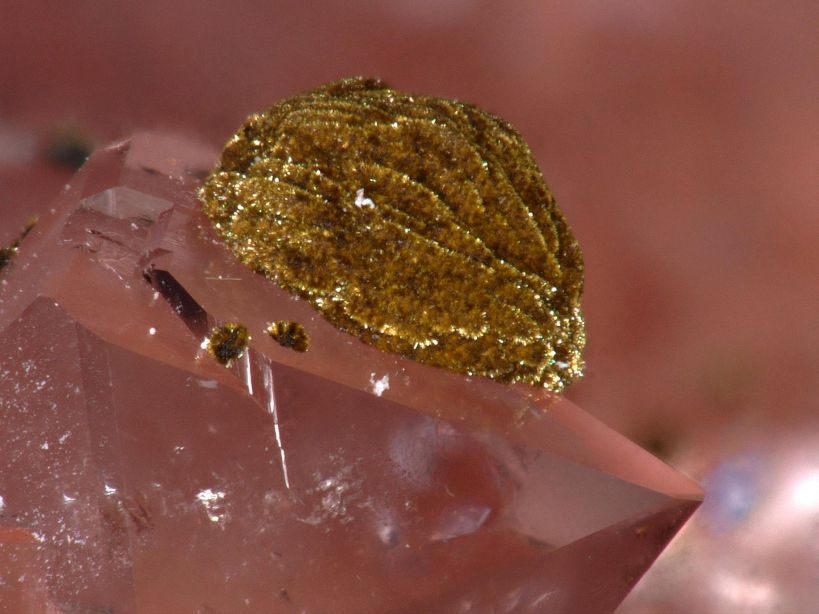
Blättriger Hämatit, überkrustet von gelbem Goethit als dünne,
blättrige
Kristalle auf einem Quarzkristall in einer Lithophyse,
Bildbreite 2 mm.
Glaskopfartiger bis stalagmitischer Goethit fand sich als
glänzender Überzug von kleinen Hohlräumen und Spaltenfüllungen
gemeinsam mit Hollandit und Pyrolusit. Die Bereiche erreichen bis
zu 2 cm² Größe. Die Schichtdicke erreicht meist nur 0,5 mm; im
Bruch zeigt sich der typische, strahlige Aufbau mit den
Innenreflexen.
Im sehr stark brekziösen Gangteilen findet sich hellbrauner
Goethit als limonitische Imprägnation am Rand der Mn-Minerale bis
in den Rhyolith hinein.
Manganit
MnO(OH)
Stahlgraue bis braune, seidenmatt glänzende, strahlig-nadelige
Überzüge und Füllungen der Erzbrekzie konnten als Manganit
bestimmt werden. Er bildet eine bis 10 mm dicke, alles
überwachsende Schicht und wird oft von grobspießigem, stark
glänzendem Manganit oder von Calcit
überwachsen. Manchmal sind durch den klaren Calcit die einzelnen,
nadeligen Kristalle deutlich zu beobachten. Häufig sind im Calcit,
Baryt und Mangano-Calcit
eingestreut, größere, max. 5 mm lange und 1 mm dicke,
längsgestreifte Manganit-Kristalle eingewachsen. In hohlen
Calcit-Kristallen können hochglänzende, bis 2 mm lange,
längsgestreifte Manganit-Kristalle beobachtet werden. Sie treten
am Salband gehäuft auf. Pseudomorphosen von Braunit nach Manganit sind
weit verbreitet; es konnten auch röhrenförmige, langprismatische
Kristalle, mit innen aufgewachsenen Braunit-Kristallen gefunden
werden.

Manganit-Nadel im Calcit;
Bildbreite ca. 7 mm

Gangfüllung aus Braunit mit Illit, Calcit und Manganit, dann nach
Innen mit Kutnahorit
und einer finalen Füllung aus Hausmannit als Pseudomorphose nach
Manganit-Nadeln;
Bildbreite des angeschliffen und polierten Stückes ca. 8 cm
Innerhalb der Calcit reichen Braunit-Gänge finden sich als Nebengemengeteile kleine, einzelne Manganit-Kristalle. In einem, mit Kristallflächen ausgekleideten, kleinen Hohlraum innerhalb von grobspätigem Calcit konnten lebhaft metallisch glänzende, dünne Nadeln mit meißelförmigen Enden beobachtet werden. Im Hohlraum sitzen kleine, spaltrhomboederförmige Calcit-Kristalle. Durch eine Untersuchung mit der Mikrosonde konnte in den Nadeln nur Mn aufgefunden werden; somit handelt es sich sehr wahrscheinlich um Manganit.
In klaren Calcit-Spaltstücken sind ab und zu orientiert eingewachsene Manganit-Nädelchen zu beobachten. Die kreuzförmig verwachsenen Nadeln laufen scheinbar V-förmig auseinander. Dies ist eine Auswirkung der Doppelbrechung, die sich dabei schön beobachten lässt.
Dunkelbrauner Calcit erweist sich beim Blick durchs Mikroskop an Spaltstücken oder im Anschliff als von feinfaserigen, goldbraunen, seidigen Manganit durchwachsen. Die sphaerolithisch aggregierten Nadeln sind nur wenige m dick und bis zu 3 mm lang.
Der frische, strahlige Manganit kann deutlich radioaktiv sein (siehe Tabelle 4). Er weist von allen Mn-Mineralien die höchste Aktivität auf.
Im farblosen Calcit konnte wie auf der 3. Sohle feinste
Nadelbüschel aus Manganit gefunden werde. Sie treten in einem
Gangtrum mit Braunit, Hausmannit und
Mn-Calcit auf. Der
Manganit erreicht 2 mm Länge. Selten sind kleine, kurzprismatische
Kristalle, die unter einem Winkel von ca. 60° verwachsen sind.
Manganit ist wohl sehr weit verbreitet, aber immer im Calcit
eingewachsen. Er erscheint dann braun und die Nadeln sind erst im
Anschliff zu erkennen. Manchmal sind die Manganit-Nädelchen auch
in braunen, orientiert gewachsenen Mn-Calcit umgewandelt und von
Braunit durchwachsen. Solche Aggregate sind bis zu 3 mm dick, von
blumenkohlartigem Aufbau und mit einem Rasen aus Braunit unter
weißem überzogen.
Die Überwachsung erfolgte sehr unregelmäßig, so dass auch hier
deutlich erkennbar ist, dass die Mineralisation von Bewegungen der
Störung unterbrochen wurde. Dabei kam es auch während der
Mineralbildung zu umfangreichen Bewegungen der Stücke durch die
Fluide in dem Gang. Sie wurden dann an der neuen Stelle anders
mineralisiert bzw. damit fixiert.
Magnetit
Fe2+Fe23+O4
Magnetit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Jakobsit
MnFe23+O4
Jakobsit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Hetaerolith
ZnMn2O4
Hetaerolith wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Bixbyit-(Mn)
(Mn,Fe)2O3
Bixbyit wurde von LORENZ 2004 beschrieben. Das Mineral bildet
würfelige, oft zonierte Strukturen in dem Manganerzgängen.
Nsutit
Mn(O,OH)2
Nsutit (sprich Ensitit) wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Hollandit (Ba,K)(Mn,Ti,Fe)8O16
Hollandit wurde von LORENZ 2004 beschrieben. Nach der neusten
Nomenklatur wäre das Mineral als Ferrihollandit zu bezeichnen.
Manjiroit
(Na,K)Mn8O16·nH2O
Manjiroit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Takanelit
(Mn2+,Ca)2+(Mn3,54+O8)2·3H2O
Takanelit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Ranciéit
(Ca,Mn2+)2+(Mn3,54+O8)2·3H2O
Rancieit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.
Birnessit
~(Na0,8,Ca0,4)0,8(Mn3,24+Mn0,83+O8)0,8·3H2O
Birenessit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.