Das Kalkspat-Bergwerk "Schacht Heinrich"
zwischen Schweinheim und Gailbach
bei Aschaffenburg
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Steinbruchwand aus Marmor,
aufgenommen am 13.12.2002
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Steinbruchwand aus Marmor,
aufgenommen am 13.12.2002
Hier sieht man die sehr steil stehenden, angewitterten Marmorlagen in dem Vorkommen zwischen Schweinheim und Gailbach bei Aschaffenburg. Dieser Marmor wurde hier im 19. und 20. Jahrhundert - auch untertägig - abgebaut. Ein langer, tiefer Steinbruch ist als Zeuge übrig.


Lage:
Schacht "Heinrich" (ehemaliger, schluchtförmiger Steinbruch im
Marmor, der später untertägig fortgeführt wurde), ca. 700 m SE der
Dümpelsmühle und südlich der Elterhöfe. Zugang über die Straße von
Aschaffenburg-Schweinheim nach Gailbach, gegenüber einer
Bushaltestelle (siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 186, Aufschluss Nr.
76).
Die überwchsenen und kaum mehr erkennbaren Halden befinden sich
unmittelbar an der Straße, am ehemaligen Maschinenhaus, von dem
auch nichts mehr zu sehen ist.. Das Gelände ist sehr stark
verwachsen (nach MATTHES & OKRUSCH war es dies schon 1963 so!)
und ist also nicht ungefährlich, wie die an der Wand abgebrochenen
Felsmassen belegen! Der nördöstliche Rand des Steinbruches wird
als "Biomüllplatz" von den Landwirten genützt. Im tiefsten Teil
rostet und gammelt Hausmüll vor sich hin.

aufgenommen am 13.12.2002
Der Aufschluss ist seit mind. 50 Jahren aufgelassen und sehr stark
verwachsen, aber mit etwas Mühe wegen des dichten Pflanzenwuchses
zugänglich. Das Stollenmundloch ist zugemauert, wurde aber auch
aufgebrochen und ist das Innere bedingt zugänglich. Eine Befahrung
der Weitungen zum Sammeln von Mineralien ist sinnlos, weil das
Gestein im Innern auch nicht frisch ist. Wie aus den
Hinterlassenschaften geschlossen werden kann, werden die Höhlungen
temporär von Wohnsitzlosen benützt.
Historie:
Um 1870 begann man den Abbau für die Zellstoff-Fabrik in
Aschaffenburg Damm, die den Kalk für die Papierherstellung
verwandte. Man baute nur nach Bedarf ab.
Erst im Spätsommer des Jahres 1928 übernahm die Fa.
Spessart-Industrie Aschaffenburg den Abbau im Tagebau und gegen
Ende des Jahres im Untertagebau.
Die bis zu 200 m langen Strecken wurden ausgebeutet, verfüllt und
dann darüber wieder abgebaut. 1929 traten massive Wasserzuflüsse
auf, für die man weitere Pumpen installieren musste. 1942 war der
Wasserzufluss so groß geworden dass die Pumpen das Wasser nicht
mehr sümpfen konnten. Dies war wohl der wesentliche Grund für das
Einstellen des Bergwerkes.
Mit der Anlage des Kulturrundweges "Marmor, Stein und Spessartit"
in Gailbach wurde im Herbst 2005 der Bewuchs des in Gailbaches
"Weißer Steinbruch" genannten Lokalität entfernt und ein gut
begehbarer Zugang mit Stufen angelegt.
Die einst gefährliche, weil randlich überhängende, Schachtpinge
des
Tiefbaues,
aufgenommen am 11.01.2003
Die Einbrüche und der Schacht wurden dabei dauerhaft gesichert, so dass ein gefahrloser Besuch möglich ist.
Geologie:
Im Raum Schweiheim - Gailbach - Bessenbach - Klingerhof - Haibach
stehen innerhalb der Schweiheim-Elterhof-Formation (kristalline
Schiefer, Amphibolite, Quarzite, ....) an vielen Stellen Marmore
an. Diese werden von wenigen dm bis max. 20 m mächtig und sind von
stark schwankender Zusammensetzung. Die nicht reinweißen Partien
enthalten reichlich silikatische Mineralien (siehe Bild und Liste
unten).
Es handelt sich bei dem Marmor wohl um prävariskische dolomitische
bis kalkige Sedimente (z. B. Korallenriffe), die lagenweise reich
an anderen Bestandteilen waren (Sand, Ton, Mergel, ....). Diese
Sedimente (es gibt sie übrigens auch im Odenwald) wurden während
der variskischen Gebirgsbildung durch Hitze und Druck
(Metamorphose) zusammen mit den diese umgebenden Gesteinen zu den
Marmoren und Silikatmarmoren umgewandelt. Dies ist auch der Grund
warum die Marmore aus dem Spessart nicht der üblichen Vorstellung
von Marmor im Sinne der weißen, polierfähigen Gesteine* entsprechen. Eine
diesbezügliche Nutzung als Werksteine gab es wohl auch nicht.

Im Bild oben sieht man ausgesucht weiße Marmore vom Schacht
Heinrich bei Gailbach. Links die rauhe Bruchfläche eines weißen,
nahezu fremdmineralfreien Marmors aus den hier sehr groben
Calcit-Körnern (bis 1 cm), deren glänzende Spaltflächen das
"zuckerkörnige" Gefüge erzeugen. Im Bild rechts sieht man die
geschliffen und polierte Fläche eines Marmors. Hier sind Lagen
erkennbar, die unterschiedlich große Gehalte an anderen Mineralien
enthalten und sich deshalb farblich etwas abheben. Der dunkle
Streifen ist eine Störung. Die schwarzen Punkte sind alterierte
Mineralien. Die Außenflächen beider Stücke sind sehr rauh durch
das Anlösen der Karbonate durch das Regenwasser (Haldenfunde).
Die Bildbreite beträgt ca. 25 cm.
Die Marmore aus dem Spessart wurden wohl ausschließlich als
Zuschlagstoff für die chemisch Industrie, für die
Papierfabrikation und zur Herstellung von Steingut im 19. und 20.
Jahrhundert abgebaut. Dazu wurde das Gestein am Ort gebrochen,
weshalb in den alten topgraphischen Karten noch die Schrift
"Schotterwerk" am Heinrichschacht bei Gailbach aufgeführt war.
Näheres über den Abbau kann man der Tafel am Schacht entnehmen.

In dem ca. 20 cm breiten Marmor-Stück erkennt man die normale,
typische Ausbildung der spessarter Marmore. Helle, Calcit-reiche
Partien ohne weitere Mineralien wechseln mit silikatischen Lagen
ab. Die dunklen Punkte sind kleine Kristalle eines
Schichtsilikates (siehe Liste unten) und waren früher
wahrscheinlich ein Chondrodit (siehe Abb. ganz unten zum
Vergleich). Der Chrondrodit ist an und nahe der Erdoberfläche in
unserm Klima nicht stabil, so dass das Mineral in z. B. Chlorit
umgewandelt wurde.
Mineralien:
Viele Mineralien wurden aus den Marmoren in der vorwiegend älteren
Literatur beschrieben. Es handelt sich dabei um die mehr oder
minder großen Einschlüsse in einer Calcit-Matrix, oft nur unter
dem Mikroskop und im Dünnschliff erkennbar. Idiomorphe Kristalle
sind selten und Drusen kamen wohl kaum vor. In den älteren
Sammlungen deutscher Universitäten und Institute finden sich daher
kaum Belegstücke. Das häufigste Mineral ist der Glimmer Phlogopit:

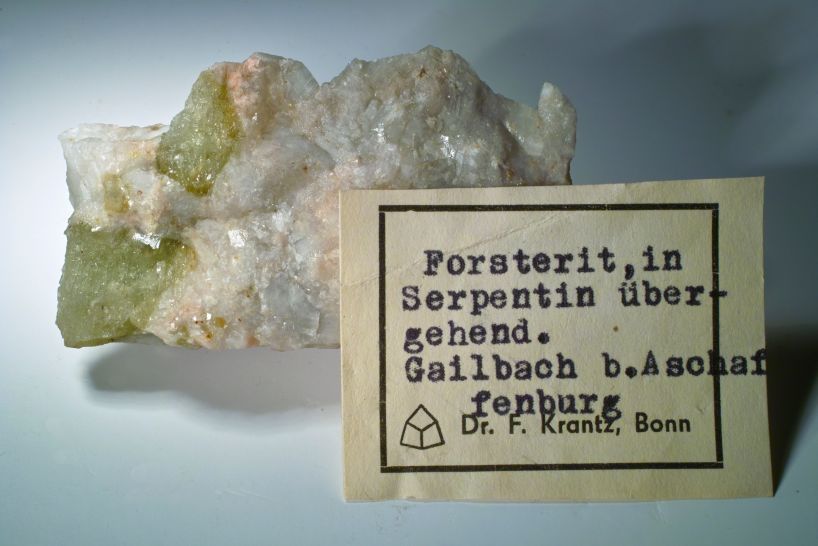




Die Liste der Mineralien wurde erstellt, als der Bergbau hier
umging. Infolge der leichten Verwitterung des Marmors und der
schlechten Aufschluss-Situation lassen sich die oben aufgeführten
Mineralien kaum mehr auffinden. Der grösste Teil konnte auch in
all den Jahren von mir nicht gefunden und somit auch nicht
überprüft werden. In öffentlichen Sammlungen wurde kaum Material
aus der Betriebszeit hinterlegt.
Aktuelle Situation:
Der inzwischen weiter verfallene Schurf am Heinrich-Schacht
erbringt keine der angeführten Mineralien mehr. Aber Vorsicht -
das Steinbruch-ähnliche Gelände wird seit mind. 50 Jahren nicht
mehr bebaut. Es ist mit großer Vorsicht zu betreten! Von
der Absperrung aus ist jetzt die weiße Wand des Steinbruches sehr
schön zu sehen.
Auch die anderen Marmorvorkommen der Region sind nicht besser
aufgeschlossen und es gab weitere untertägig bebaute Stellen (bei
Gailbach und am Klingerhof). Man kann allenfalls noch
Marmorbrocken auf Wegen und seltener bei Bauarbeiten bergen. Da
diese kaum durch eine besondere Struktur oder durch eine
auffallende Farbe bestechen oder idiomorphe Kristalle aufweisen,
werden diese auch kaum gesammelt.
Eine kurzfristige Ausnahme waren die Marmorfunde während des Tunnelbaues zwischen Laufach
und Heigenbrücken. Dort ist kein Marmor mehr aufgeschlossen.
Marmor im gesteinskundlichen Sinn sind metamorphe Kalke und Dolomite die es in der Natur oft in einer rein weißen Form gibt (z. B. die berühmten Steinbrüche in der Umgebung von Carrara, Oberitalien, die seit der Antike genutzt werden). Man erkennt sie am "zuckerkörnigen" Gefüge der Spaltflächen der Calcit-Kristalle. Man nutzt aber auch hier nur die besten Partien für die Herstellung von Marmorprodukten. Je nach der Zusammensetzung des Ausgangsgesteins gibt es weltweit eine unglaubliche Fülle von Marmoren in fast allen Farben und mit einer großen Variabiliät der Zusammensetzung.
Aber Industrie und Handwerk der Steingewinnenden und -verarbeitenden Zunft bezeichnet nahezu jedes polierfähiges Gestein als "Marmor" (bei den Römern war das auch schon mal so), meist um eine Aufwertung zu erfahren (im Gegensatz dazu ist alles andere dann eben ein "Granit"). So ist der für Fensterbänke und Treppenstufen oft zu eingebaute "Treuchtlinger Marmor" ein Kalkstein - erkennbar an den eingeschlossenen Fossilien. Diese wären nach einer Metamorphose nicht mehr vorhanden.
Die heute hier verwendeten Rohsteine kommen aus der ganzen Welt nach Deutschland und werden dann meist zu Platten verarbeitet. Je nach Aussehen und Seltenheit können echte Marmore dann erhebliche Preise erzielen. Der Interessent wird auf den nächsten Friedhof oder ein Geschäft der (Grab-)steinindustrie verwiesen. Wem das nicht reicht, dem sei der Besuch der alle zwei Jahre stattfindenden Messe "stone + tech" in Nürnberg empfohlen.
Das sichere Erkennen von Marmoren im petrographischen Sinne ist im Handstück nicht immer leicht möglich. Selbst im Spessart kommen metasomatisch veränderte Sedimente des Zechsteins vor, die selbst im Dünnschliff nur schwer von einem Calcit- bzw. Dolomit-Marmor unterschieden werden. Sichere Hinweise sind dann die typischen metamorphen Nebenbestandteile, also Neubildungen wie Glimmer.
Weiter können Calcit- und Dolomit-Marmore beim flüchtigen Betrachten sogar mit weißem Baryt (mit Unterscheidungsmatrix) und weißem Quarz verwechselt werden.
GÜMBEL, K. W. von (1894): Geologie von Bayern. Geologische
Beschreibung von Bayern.- II. Band, S. 612 ff, mit
zahlreichen Zeichnungen und Profilen im Text und einer Geologische
Karte von Bayern als gefaltete Beilage, [Verl. v. Theodor Fischer]
Cassel.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 647ff, 791.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 49, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,
Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei
Joh. Walch] Augsburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, S. 123 f, Berlin.
MOSEBACH, R. (1934): Die körnigen Kalke von Auerbach-Hochstädten
a. d. Bergstraße und der Umgegend von Aschaffenburg.-
Senckenbergiana, Bd. 16, Nr. 4/6, S. 175 - 188, Frankfurt.
MOSEBACH, R. (1934): Die kontaktmetamorphen Kalke des kristallinen
Spessarts.- Chemie der Erde 8, S. 622 - 662, 8 Abb., [Verlag v. G.
FISCHER] Jena.
NEUBAUER, D. & REISS, W. (1967): Mineralien aus dem Spessart.-
Der Aufschluss 18, S. 215 - 218, Heidelberg.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- S. 35 ff, S. 194, München.
WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN, W., STREIT, R. &
WEINELT, W. (1984): Oberflächennahe mineralische Rohstoffe von
Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der Steine und
Erden.- Geologica Bavarica 86, S. 101 - 102, [Bayerisches
Geologisches Landesamt] München.

Gelbe Chondrodit-Körner ((Mg,Fe)5[(F,OH)|SiO4]2)
im Calcit eines sehr frischen
Chondrodit-Kalksilikat-Marmors aus Los Hälsingland in Schweden;
Bildbreite 2 cm
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite